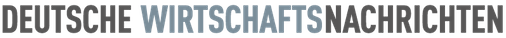Die Schwellenländer wurden in den vergangenen Jahren massiv von der Finanzindustrie gehypt. Jahrelang gab es in der Propaganda der Finanzindustrie für die großen Schwellenländer nur eine einzige Richtung: Wirtschaftlichen Erfolg und damit den Weg in eine glanzvolle Zukunft.
Finanziert wurde der Hype mit dem billigen Geld der Zentralbanken.
Waren es früher die US-Immobilien, wurden es nach dem ersten Crash die Schwellenländer.
Bernanke, Draghi und die anderen druckten wie verrückt.
Das Geld suchte nach Anlagen. Suchte nach Hypes.
Die BRICS wurden zum Paradies für die Spekulanten.
Nun ist diese Party auch vorüber.
Und plötzlich ist die Euphorie verfolgen. Die Zahlen sind schlecht, die Schulden hoch. Die Märchen, die den Investoren versprochen wurden, erfüllen sich nirgendwo.
Die BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien und China) werden von der Wirklichkeit eingeholt.
Und das ist eine ganz schlechte Nachricht für die Finanzwirtschaft.
Das ist auch eine ganz schlechte Nachricht für die deutschen und die europäischen Banken.
Denn natürlich haben alle mitgemacht bei dem Hype.
Die Zahlen sind ernüchternd.
Die Forderungen allein aller deutscher Banken an die BRIC-Staaten belaufen sich nach Statistiken der Deutschen Bundesbank wie folgt: Brasilien 3,4 Milliarden Euro, Russland 16,5 Milliarden Euro, Indien 5,8 Milliarden Euro und China 13,4 Milliarden Euro.
Noch deutlicher sehen die Forderungen der europäischen Banken gegenüber allen Schwellenländern bzw. den „emerging markets“ aus. Laut Statistik der Bank für Internationalen Zahlungsverkehr (BIZ), die den DWN vorliegen, betragen die gesamten Forderungen aller europäischen Banken – einschließlich vergebener Kredite und Staatsanleihen – an die Schwellenländer 3,4 Billionen Dollar.
In der Weltwirtschaft ist alles miteinander so vernetzt, dass man am Ende nicht mehr genau sagen kann, warum das ganze System in die Luft fliegt.
Während sich alle Welt über die Euro-Krise Gedanken gemacht hat, sind die Probleme der Emerging Markets aus dem Blick geraten.
Doch die Probleme sind nicht mehr zu übersehen.
Alarmierende Anzeichen wie hohe Inflationsraten und steigende Arbeitslosigkeit machen sich bemerkbar. In Brasilien gingen die Menschen wegen einer Fahrpreiserhöhung von (umgerechnet) sieben Cent auf die Straße. Dies war jedoch nicht der eigentliche Grund. Es war vielmehr ein Anlass, gegen die herrschende Korruption, Milliardenausgaben für die Fußball-WM, mangelnde Bildungschancen und ungerechte Verteilung des Wohlstands zu protestieren – mit der Folge gewaltsamer Auseinandersetzungen (mehr hier).
Die Revolutionen in Tunesien, Ägypten und Syrien sowie die Unruhen in der Türkei haben wirtschaftliche Gründe: Kein Regime hat es geschafft, die Wirtschaft in seinem Land nachhaltig zu festigen. In den meisten Fällen ist das Wachstum auf Schulden aufgebaut.
Im Vergleich zu Europa ist diese Schuldenkrise noch viel gigantischer, weil die Staaten zwar eine junge Bevölkerung haben, in der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung jedoch noch oftmals ganz am Anfang stehen.
In den vergangenen Wochen wurden auch die Kapitalmärkten der BRIC’s-Staaten erstmals von starken Abstürzen erschüttert.
Die Revolutionen und Abstürze an den Börsen sind Vorboten von größeren Verwerfungen.
Erst setzte eine Kapitalflucht ein, dann kamen Aktien, Anleihen und selbst die die Währungen unter Druck.
Die Weltwirtschaft setzte zu lange auf die Hoffnungsträger und exportierte wie wild in die Staaten. Nun versiegen die Quellen, und die Exportnationen wie Deutschland geraten unversehens selbst unter Druck.
Brasilien benötigte dringend Investitionen in seine Infrastruktur, Gesundheitswesen und vor allem Bildung, um weiterhin wirtschaftlich erfolgreich bestehen zu können.
Russland setzte bisher hauptsächlich auf Energie und Gasexporte. Eine erfolgreiche, zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik verlangt allerdings mehr Rechtssicherheit für ausländische Investoren, um neue Ideen und Produkte zu generieren.
Indien profitiert bislang durch die unternehmerische Mittelschicht, die wiederum unzählige ungelernte, unterbezahlte Arbeiter beschäftigt. Daneben existieren als wirtschaftliche Leuchttürme lediglich die Technologiezentren. Generell hat die indische Wirtschaft hat mit einer ausufernden Bürokratie und dem Mangel an moderner Infrastruktur zu kämpfen.
Chinas Wirtschaftsleistung stieg während der letzten drei Jahrzehnte um jährlich etwa 10 Prozent und liegt derzeit bei 7,8 Prozent mit einer erwarteten Aussicht von etwa 6,5 Prozent jährlich. Steigende Lohnkosten und die Währungsaufwertung behindern die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft.
Ein derart deutlicher wirtschaftlicher Abschwung wird auch als „hard landing“ bezeichnet. Es bedeutet den Rückfall einer aufstrebenden Volkswirtschaft in das Abgleiten in die Rezession. Gerade das „hard landing“ Chinas wird weltweit auch andere Schwellenländer hart treffen.
Die deutsche Industrie, die vor allem Investitionsgüter, Industrieanlagen und Fahrzeuge aller Art nach China liefern, profitierte bisher vom exorbitanten Wachstum in China. Gerät China in eine Rezession, zeitigt dies auch schwerwiegende Rückschläge für die deutsche Exportwirtschaft.
Insgesamt lassen sich weitere Faktoren berücksichtigen, um die gesamtwirtschaftliche Situation der Schwellenländer oder auch „emerging markets“ auf die Entwicklungen in der Eurozone und damit auch auf Deutschland abzuschätzen:
Argentinien, das zwar nicht den BRIC-Staaten, jedoch den Schwellenländern zuzurechnen ist, ist derzeit mit Forderungen nach Schuldenrückzahlungen konfrontiert. Allein Deutschland gegenüber belaufen sich die Schulden auf 2,43 Milliarden Euro. Darüber hinaus ringt das Land mit Rückzahlungen von umgeschuldeten Anleihen, die zu Krisenzeiten Argentiniens nicht von einem Schuldenschnitt betroffen waren. Sollte Argentinien diese Schulden abtragen müssen, drohte ein erneuter Staatsbankrott (mehr hier).
Indessen sorgt sich auch Italien um die Entwicklung in Argentinien, da die italienische Wirtschaft traditionell eng mit der des südamerikanischen Landes verwoben ist. Insbesondere würde es für Italien prekär, falls es in Argentinien tatsächlich zu einer wiederholten Staatsinsolvenz käme. Dies hätte einen Bail-Out Italiens durch die Eurozone zur Folge (hier).
Allein im Jahr 2012 trugen die BRIC-Staaten etwa 62 Prozent zum weltweiten Wirtschaftswachstum bei. Sollten sich die Wirtschaftsdaten in diesen Ländern weiterhin abschwächen, droht eine Blase zu platzen. Womöglich stehen in den Schwellenländern neben Argentinien auch weitere Staatspleiten an.
Mit der Folge von massiven Ausfällen der Forderungen der europäischen Banken.
In den offiziellen Zahlen noch nicht enthalten sind die Derivate. Die Deutsche Bank hat in ihren eben veröffentlichten Zahlen ein massives Deleveraging vorzuweisen: Das heißt, sie hat Risiken aus ihren Büchern gebracht. Und zwar in einem Tempo wie keine Bank es seit 2011 mehr gemacht hat.
Wohin die Risiken sind, weiß niemand.
Aber dass die Deutsche Bank nervös ist, belegt: Die Lage ist ernst.
Der Fall der italienischen Monte dei Paschi di Siena zeigt: Banken schieben sich gerne Risiken selbst zu, etwa in Form von Swap-Geschäften. Solche Geschäfte standen am Beginn der griechischen Tragödie.
Wenn es noch eines Beweises bedarf, dass die Lage auf den globalen Märkten vermutlich wegen der Emerging Marktes besonders angespannt ist: Goldman Sachs hat aktuell bekanntgegeben, verstärkt in europäische Unternehmen investieren zu wollen. In der etwas kryptischen Meldung stand sinngemäß zu lesen, dass die Goldmänner zwar nicht wissen, wann sich Europa erholen wird, dass aber europäischen Assets besser seien als andere.
Durch die Derivate und die Vernetzung der Banken hat ein Crash in Argentinien oder in China für die Europäer dieselbe Wirkung wie ein Crash in Italien oder Frankreich.
Ein Domino-Effekt wäre die Folge.
Das europäische Kartenhaus, in dem gerade wieder das Griechenland-Thema mit neuen Milliarden-Löchern hochkocht, ist nicht gewappnet gegen einen Tsunami aus dem Osten.
Alle behelfsmäßigen Brandmauern, Bazookas und Rettungsschirme der Europäer sind zu klein, um die Banken der Euro-Zone vor einem „Event“ in Schwellenländern wie China zu schützen.
Der Schwarze Schwan, so scheint es, könnte aus den Schwellenländern kommen.
Wegen der verantwortungslosen globalen Schuldenmacherei schwimmt der nächste Schwan jedoch nicht auf einem Teich.
Er kommt auf einer Flutwelle der Spekulationen, Risiken und Betrügereien daher, auf der die Finanzwirtschaft in den vergangenen Jahren mit Riesen-Profiten gesurft ist.
Die Flutwelle kann jederzeit aufschlagen.
Wenn sie wirklich kommt, bleibt nicht mehr viel Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. Beobachter wollen festgestellt haben, dass sich bestimmte Banken wie die Deutsche Bank, Barclays oder Citigroup nur noch mit Mühe über die Nächte retten können, um nicht einen Overnight-Crash mit ihrer Liquidität zu produzieren.
Die Lage ist ernst.
Die Ruhe trügerisch.
Im Computer-Zeitalter gibt es keine Vorwarn-Zeiten mehr.
Der Schwarze Schwan wird plötzlich da sein.
Und schon ist es zu spät.
Für alle.