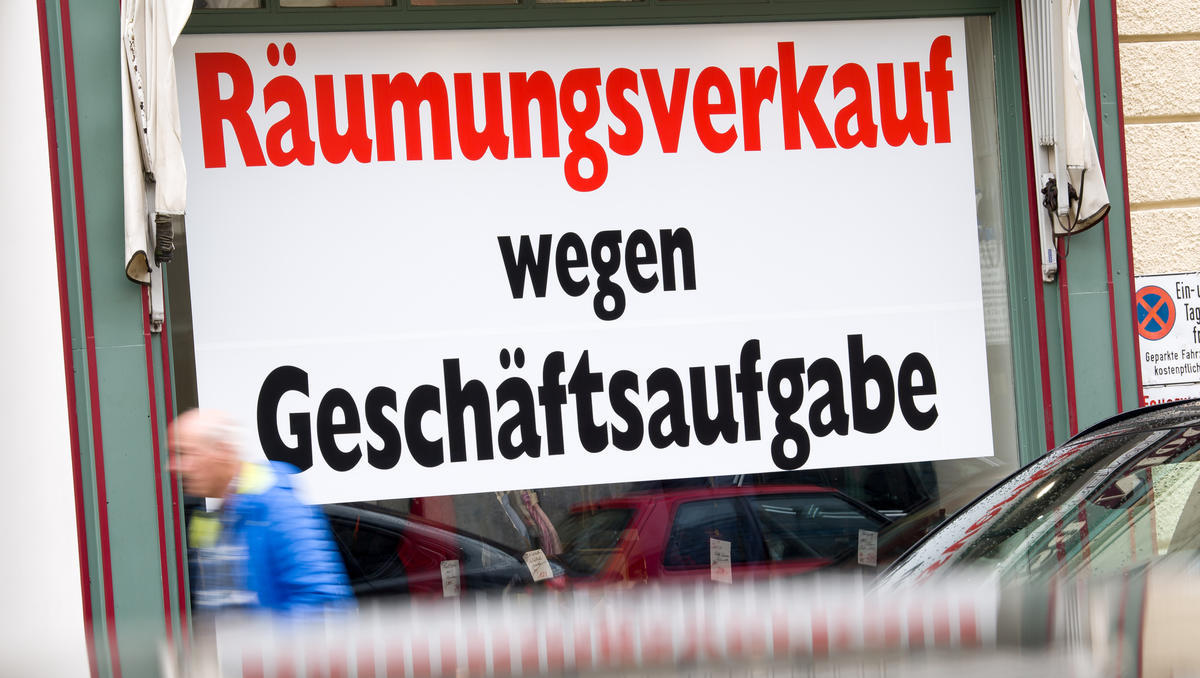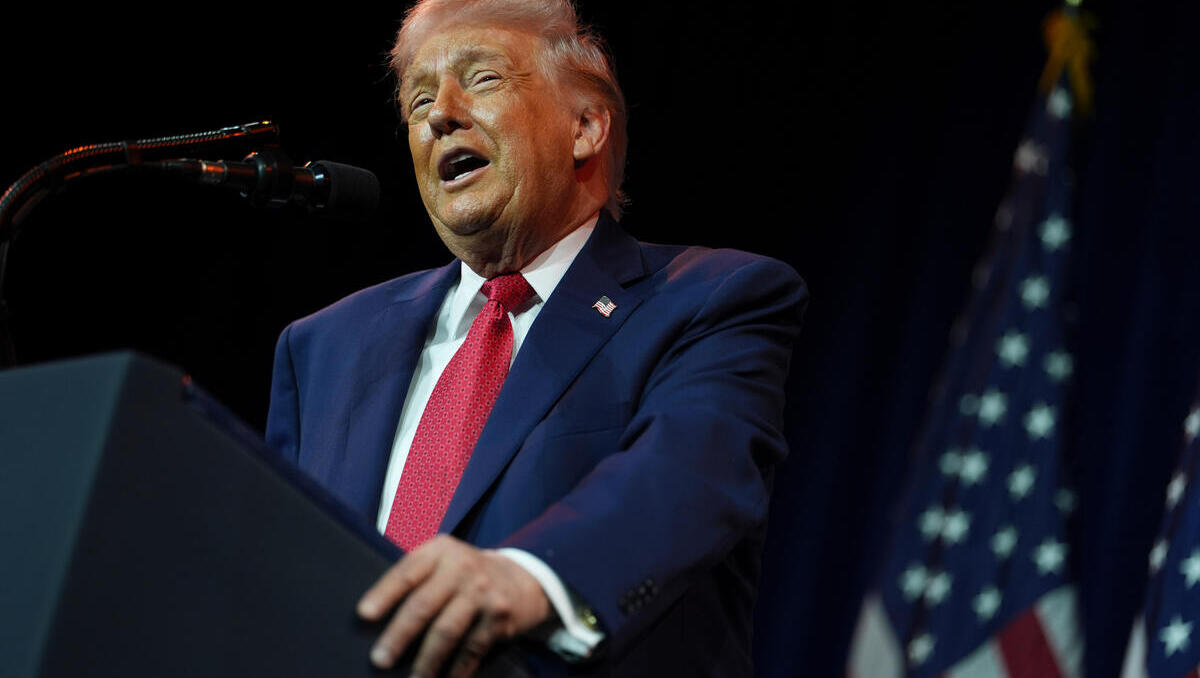Es sieht ganz danach aus, dass der Euro die große Krise, in die er vor zehn Jahren gestürzt war, überwunden hat. Zumindest war die Zustimmung unter den europäischen Bürgern zur Gemeinschaftswährung noch nie so groß wie jetzt. So befürworten drei Viertel der Europäer den Euro, dessen Ansehen durch die Finanz- und Schuldenkrise massiv gelitten hatte. Dieses Rekordergebnis lässt sich aus dem aktuellen Eurobarometer ablesen.
„Der Euro ist heute stärker als jemals zuvor“, freute sich Valdis Dombrovskis. „Indem er 19 unterschiedliche Währungen ersetzt hat, bringt er den Bürgern, Unternehmern und Ländern viele Vorteile“, sagte der Vertreter der Kommission, der dort für Euro-Fragen zuständig ist. „Es besteht kein Zweifel, dass uns die Gesellschaft ein Mandat dafür übertragen hat, damit wir die Wirtschafts- und Währungsunion stärken und die internationale Rolle des Euro vergrößern“, erklärte Dombrovskis.
Doch gibt es ein Problem: Viele EU-Mitgliedsländer, die nach wie vor ihrer nationalen Währung vertrauen, wollen den Euro eigentlich gar nicht oder zeigen sich zumindest ihm gegenüber sehr skeptisch. Dazu gehören die östlichen EU-Staaten Polen, Tschechien und Ungarn, die in ihrer Region aufgrund ihrer Größe eine politische und wirtschaftliche Schlüsselrolle einnehmen.
Kaczyński: „Euro nützt nur Deutschland“
Der Vorsitzende der nationalkonservativen Regierungspartei PiS, Jarosław Kaczyński, hat sich im April des laufenden Jahres klar dagegen ausgesprochen. „Es gibt nicht den geringsten Grund, diese Währung bei uns einzuführen“, erklärte Kaczyński, der zwar in Polen kein Regierungsamt hat, doch als entscheidender Strippenzieher hinter den Kulissen gilt. „Die Zahlen lügen nicht“, sagte der PiS-Vorsitzende, der darauf hinwies, dass sich die Wirtschaft Polens besser als die Eurozone entwickele. „Von der Euro-Einführung profitieren überwiegend nur Deutschland, die Niederlande und im gewissen Sinne auch Österreich“, so Kaczyński. „Alle anderen hingegen verlieren nur“, ereiferte sich der Politiker im Interview mit dem Polnischen Radio.
Und auch der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki äußerte sich gegenüber der Gemeinschaftswährung ablehnend: „Unser wichtigstes Postulat ist nicht, dass wir den Euro übernehmen, sondern im Gegenteil, dass unser Zloty den Polen Wohlstand garantiert“, erklärte der Regierungschef. „Unser Postulat ist, dass die Polen damit beginnen, so viel zu verdienen wie ihre Kollegen in den westlichen Ländern“, sagte Morawiecki.
Ähnlich sieht dies auch die polnische Bevölkerung: So ziehen es 65 Prozent der Polen vor, weiter mit dem einheimischen Zloty zu bezahlen. Das geht aus einer Umfrage der konservativen Boulevard-Zeitung „Super Express“ hervor. „Ein Großteil der Befragten befürchtet, dass sich dadurch die Löhne und Gehälter verringern“, schreiben die Journalisten. „Außerdem glauben sie, dass so die Preise steigen werden“, berichtet das Blatt.
Tschechen klar dagegen
Auch in Tschechien ist die Einstellung klar – und zwar gegen den Euro. Weder die politische Führung noch die Bevölkerung sind davon sonderlich begeistert. Der Grund: Die Wirtschaft des Landes entwickelt sich auch mit der einheimischen Krone solide und ohne größere Störungen – ähnlich wie in Polen. Grundsätzlich muss den Tschechen am Euro gelegen sein, weil das Land pro Jahr nicht wesentlich mehr als 200 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung generiert und über 16 Millionen Konsumenten verfügt. Damit ist die Volkswirtschaft eher klein und relativ stark vom Außenhandel abhängig. Insbesondere die einheimische Autoindustrie ist eng mit Deutschland verbunden.
Doch spielt das Thema aktuell überhaupt keine Rolle. Unvergessen ist ein Interview, das der tschechische Premier Andrej Babiš im Frühjahr 2019 der tschechischen Tageszeitung „Mladá fronta Dnes“ gegeben hat. Dort betonte Regierungschef, dass er grundsätzlich viel von der europäischen Idee halte. „Allerdings vertrete ich den Standpunkt, dass die Gemeinschaftswährung in der nächsten Zeit bei uns nicht eingeführt werden sollte“, so Babiš. Denn die EU hat seiner Meinung nach politisch versagt.
„Hätte sich Brüssel an die eigenen Regeln gehalten, dann hätte Tschechien heute durchaus schon dem Euroraum angehören können“, erklärte der Regierungschef, dem das Verhalten der EU während der Finanz- und Schuldenkrise nicht gefallen hat. Aus seiner Sicht hat die Gemeinschaft, die finanziell angeschlagenen Mitgliedsstaaten mit zu vielen finanziellen Mitteln versorgt und damit die eigenen Prinzipien verletzt.
Und so lehnt auch der Großteil der Tschechen die Gemeinschaftswährung ab: Nach den Umfragen des Eurobarometers vom Frühjahr des laufenden Jahres wollen 60 Prozent der Tschechen die einheimische Krone behalten.
In Ungarn ist gibt es keine klare Haltung gegenüber der Gemeinschaftswährung. Grundsätzlich wäre die Einführung des Euro für das Land nützlich, weil seine Exportquote bei fast 80 Prozent liegt. Ein Großteil der Waren und Dienstleistungen findet in Deutschland seine Abnehmer. Mit einem jährlichen Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 125 Milliarden Euro und knapp zehn Millionen Einwohnern gehört Ungarn zu den kleineren Volkswirtschaften, die erfahrungsgemäß relativ mehr vom Euro profitieren als die größeren. Auch dieser objektive Fakt spricht für die Übernahme für die Gemeinschaftswährung.
Grundsätzliche Zustimmung ja, konkrete Vorhaben nein
Deshalb ist die Zustimmung dafür auch grundsätzlich bei den wichtigsten Vertretern des Staates zu hören: So hat der Chef der ungarischen Zentralbank Magyar Nemzeti Bank (MNB), Matolcsy György, gerade Mitte November betont, dass Ungarn mit dem EU-Beitritt im Jahr 2004 auch die Verpflichtung übernommen habe, die Gemeinschaftswährung einzuführen. „Die Regierung ist dafür verantwortlich, den Beitrittsprozess einzuleiten“, sagte György auf eine Anfrage von Péter Jakab – eines Abgeordneten der populistischen Partei Jobbik.
Doch fehlt es bisher an konkreten Initiativen, um den Euro tatsächlich zu übernehmen. „Ich habe kein Zieldatum, wann der Euro in Ungarn eingeführt wird“, hatte beispielsweise Ministerpräsident Victor Orbán noch zu Jahresanfang 2019 erklärt. „Ich kann mir die Zukunft der Gemeinschaftswährung noch nicht vorstellen“, hatte der Regierungschef gesagt. „Der Bereich, wo der Euro derzeit eingesetzt wird, ist nicht das, was wir uns ursprünglich vorgestellt haben“, so Orbán, der zudem in unzähligen politischen Auseinandersetzungen mit Brüssel befindet. Schon aus diesem Grund dürfte sein Wille, sich noch enger an die EU zu binden, nicht allzu groß sein.
Ähnlich hat sich auch die Zustimmung zum Euro unter den Ungarn verringert. So haben beim letzten Frühlingsbarometer 2019 nur noch 38 Prozent der befragten Ungarn die Gemeinschaftswährung unterstützt. Zwölf Monate zuvor waren es noch fast 60 Prozent gewesen.