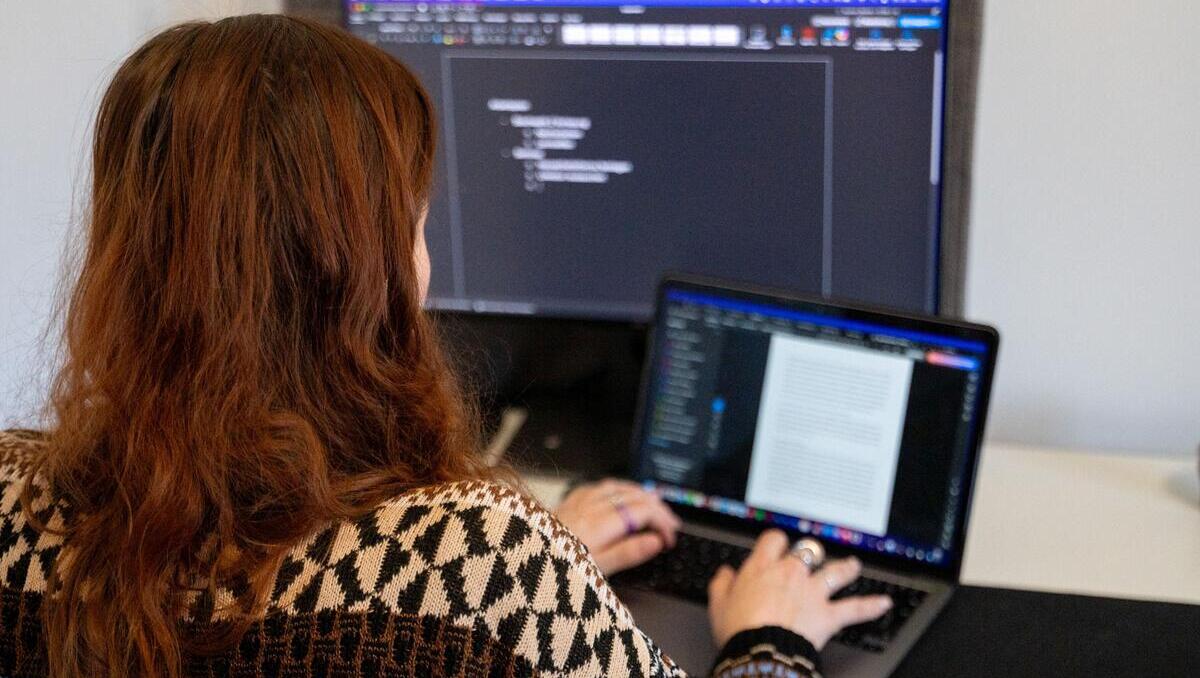DWN: Herr Professor Schnabl, manche Ökonomen bezweifelten zuletzt, dass Deutschland unter einer ernsthaften Deindustrialisierung leidet. Die Bruttowertschöpfung sei in den letzten Jahren nur leicht gesunken, argumentieren beispielsweise zwei ifo-Ökonomen in einem Fachaufsatz. Sehen Sie Anzeichen für eine Deindustrialisierung?
Gunther Schnabl: Ob es sich bereits um eine Deindustrialisierung handelt, ist noch nicht ganz klar, da nur begrenzt Daten vorliegen. Die Bruttowertschöpfung in der Industrie ist tatsächlich nur leicht niedriger als in den Jahren vor der Corona-Krise. Gleichzeitig ist aber die Industrieproduktion erheblich zurückgegangen. Die Standortbedingungen in Deutschland haben sich spürbar verschlechtert. Das erhöht die Attraktivität anderer Länder und dürfte zu einer Abwanderung von Unternehmen führen. Die Gefahr einer Deindustrialisierung ist also real.
DWN: Warum wäre eine solche Entwicklung für Deutschland problematisch?
Schnabl: Die Industrie ist von zentraler Bedeutung für den deutschen Wohlstand. In der Industrie können Produktivitätssteigerungen in einem Ausmaß erzielt werden, das in anderen Sektoren – insbesondere im Dienstleistungsbereich – nur schwer möglich ist. Das Lohnniveau eines Landes basiert letztlich immer auf der Produktivität seiner Wirtschaft. Die enormen Wohlstandsgewinne der letzten 150 Jahre wurden im Wesentlichen in Industrie und Landwirtschaft erzielt. Im Dienstleistungssektor hingegen, zu dem auch der staatliche Sektor gehört, waren die Produktivitätsgewinne geringer.
DWN: Die deutsche Industrie schwächelt ja schon länger. Seit 2017 ist die Industrieproduktion um 16 Prozent gesunken, und die Arbeitsproduktivität – gemessen am Bruttoinlandsprodukt pro Erwerbstätigen – ist leicht niedriger als 2018. Was sind die Ursachen?
Schnabl: Die Produktionsfaktoren – Energie, Arbeit und Kapital – sind in Deutschland teurer geworden. Die Energiekosten sind durch die Klima- und Energiepolitik stark gestiegen, was sich durch den Ukraine-Krieg noch verschärft hat. Zwar sind die Energiepreise inzwischen wieder gesunken, doch sind die Strompreise immer noch sehr hoch. Zweitens sind die Lohnkosten deutlich gestiegen, unter anderem durch die Inflation und die wachsende Verhandlungsmacht der Gewerkschaften. Zuletzt forderte etwa Verdi ein Lohnplus von 8 Prozent, zudem Arbeitszeitverkürzungen. Gleichzeitig haben wir seit Jahren nur geringe Produktivitätszuwächse.
DWN: Warum haben die Produktivitätszugewinne abgenommen?
Schnabl: Die niedrigen Zinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) haben über viele Jahre die deutsche Industrie indirekt subventioniert. Auch staatliche Subventionen waren beträchtlich – die 40 DAX-Konzerne haben allein in den letzten acht Jahren 44 Milliarden Euro an Subventionen erhalten. Diese Maßnahmen haben den Druck von den Unternehmen genommen, Effizienzgewinne voranzubringen. In Kombination mit steigenden Lohnkosten führt das zu höheren Lohnstückkosten – also höheren Arbeitskosten pro hergestelltem Produkt. Das belastet die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie zusätzlich.
DWN: Die Lohnkosten in Deutschland sind schon lange relativ hoch. Warum sind sie in den letzten Jahren noch stärker gestiegen?
Schnabl: Der Staat hat in mehrfacher Hinsicht zu einer Überhitzung auf dem Arbeitsmarkt beigetragen. Zum einen haben die Rettungsmaßnahmen der EZB nach der Finanz- und Schuldenkrise zu einem Wirtschaftsboom und steigenden Steuereinnahmen geführt. Diese Mehreinnahmen wurden genutzt, um die Beschäftigung im öffentlichen Sektor massiv auszubauen – seit 2008 sind gut 2,5 Millionen zusätzliche Stellen entstanden. Gleichzeitig wurde die Regulierung stark ausgeweitet, was den Bedarf an Arbeitskräften in Unternehmen und Banken erhöht hat, um diese neuen Vorschriften umzusetzen. Zudem haben Sozialleistungen wie das Bürgergeld das Arbeitsangebot reduziert. Vier Millionen erwerbsfähige Bürgergeldempfänger stehen laut Statistischem Bundesamt dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung.
DWN: Was hatte das für Auswirkungen auf die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer?
Schnabl: Die Arbeitnehmer konnten ihre stärkere Position in mehrfacher Hinsicht nutzen. Einerseits haben sie höhere Löhne durchgesetzt – in den letzten Jahren waren im Zuge der stark gestiegenen Inflation die Lohnforderungen erheblich, und sind es immer noch. Andererseits fordern die Arbeitnehmer vermehrt Arbeitszeitverkürzungen, sei es durch zusätzliche Urlaubstage oder eine kürzere Wochenarbeitszeit. Auch die steigende Zahl an Krankheitstagen hat die Lohnstückkosten erhöht. Darunter leiden die Unternehmen erheblich.
DWN: Die CDU hat mit der “Agenda 2030” einige wirtschaftliche Reformvorschläge vorgelegt, etwa den Abbau von 10 Prozent der Stellen in den Bundesministerien, die Abschaffung des Bürgergelds zugunsten einer Grundsicherung, Einkommenssteuersenkungen und flexiblere Arbeitszeitregelungen. Was halten Sie davon?
Schnabl: Die Vorschläge gehen in die richtige Richtung. Die großen wirtschaftspolitischen Fehler der letzten 15 Jahre waren eine zu expansive Geldpolitik, der Aufbau übermäßiger staatlicher Ausgabenverpflichtungen und eine ausufernde Regulierung. Um die Wirtschaft wiederzubeleben, müssen alle drei Probleme angegangen werden. Steuersenkungen sind dabei ein wichtiger Schritt. Deutschland hat eine der höchsten Steuer- und Abgabenlasten unter den Industrieländern – Leistung muss sich wieder lohnen. Allerdings müssen dann die Staatsausgaben reduziert werden, um eine steigende Verschuldung zu vermeiden. Bei den Kürzungen schweigen sich die Parteien aber weitgehend noch aus. Es braucht insgesamt weitreichende Maßnahmen, insbesondere einen Abbau der Beschäftigten im öffentlichen Sektor.
DWN: Warum wird denn kaum Bürokratie abgebaut, obwohl sich praktisch alle einig sind, dass das dringend nötig wäre?
Schnabl: Beschäftigte im öffentlichen Sektor profitieren davon – sichere Arbeitsplätze, gute Bezahlung, ausgewogene Work-Life-Balance. Sie möchten diese Vorteile behalten und viele engagieren sich politisch. Rund 30 Prozent der Bundestagsabgeordneten kamen in der letzten Legislaturperiode aus dem öffentlichen Dienst. Sie haben also eine starke Lobby.
DWN: Sie sprachen sich gerade für “weitreichendere Maßnahmen” beim Bürokratieabbau aus – wie könnte das konkret aussehen?
Schnabl: Trotz der deutlich höheren Beschäftigung im öffentlichen Sektor habe ich das Gefühl, dass dieser 2008 besser funktioniert hat als heute. Daher könnte man diese Stellen abbauen, ohne die Leistungsfähigkeit zu gefährden. Man würde also gut jede fünfte Stelle im öffentlichen Sektor streichen. Das muss schrittweise geschehen, etwa durch einen Einstellungsstopp, wie ihn Trump für die US-Bundesbehörden angekündigt hat. So wäre bei den zahlreichen anstehenden Eintritten in den Ruhestand eine relativ rasche Anpassung möglich.
DWN: Wie könnte sich die Wiederwahl von Trump auf die deutsche Wirtschaft auswirken?
Schnabl: Trump setzt auf Deregulierung, Steuersenkungen und eine verstärkte Energieförderung, was die Energiekosten in den USA senken kann. Diese Maßnahmen würden das Wachstum in den USA ankurbeln. Die Federal Reserve wäre möglicherweise nicht mehr gezwungen, Staatsanleihen zu kaufen, weil alle drei Maßnahmen die Konjunktur beleben beziehungsweise den Staatshaushalt konsolidieren helfen. Die Federal Reserve könnte die Zinsen deutlich höher belassen als die EZB.
DWN: Wären das nicht schlechte Nachrichten für Deutschland?
Schnabl: Der Druck auf Deutschland und den Euroraum würde immens steigen. Höhere Zinsen und ein höheres Wachstum in den USA würden den Euro unter Abwertungsdruck bringen und die Inflation verstärken. Das würde den Reformdruck im Euroraum weiter erhöhen.
DWN: Wäre es ökonomisch betrachtet nicht sinnvoller, wenn Deutschland angesichts dieser Risiken aus dem Euro austreten würde?
Schnabl: Der Euro ist eine Fehlkonstruktion, da der Euroraum eine gemeinsame Geldpolitik, aber keine gemeinsame Finanzpolitik hat. Das führt zu asynchronen Konjunkturverläufen in den Mitgliedsländern, weshalb die EZB nicht den richtigen Zins für alle Mitgliedsländer setzen kann. Die EZB sieht sich zunehmend gezwungen, die wachsenden Gräben im Euroraum mit einer ultralockeren Geldpolitik zu überbrücken. Billiges Geld schwächt langfristig das Wachstum und führt zu Inflation, die wiederum soziale und politische Spannungen verstärkt. Eine Rückkehr der EZB zu einer stabilitätsorientierten Geldpolitik oder der Austritt Deutschlands aus dem Euro würden die Möglichkeit schaffen, die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie langfristig zu stärken. Denn ein Aufwertungsdruck auf den Euro würde die Unternehmen zu Effizienzgewinnen zwingen.
DWN: Wenn Sie drei Maßnahmen vorgeben könnten, die die Politik umsetzen sollte, welche wären das?
Schnabl: Erstens, eine restriktivere Geldpolitik, um den Euro zu stabilisieren und den Inflationsdruck zu mindern. Zweitens, eine deutliche Reduzierung der Staatsausgaben, um den öffentlichen Sektor effizienter zu machen. Drittens, weniger Regulierung, um den Unternehmen wieder mehr Freiraum zu geben, insbesondere sollte man das Lieferkettengesetz, die Klimazölle und die europäische Taxonomie abschaffen.
Info zur Person: Gunther Schnabl (*1966 in Starnberg) ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Leipzig und leitete dort bis Oktober 2024 das Institut für Wirtschaftspolitik. Er ist Direktor des Kölner Flossbach von Storch Research Institute. Vor seiner Berufung als Professor arbeitete er unter anderem für die EZB. Zuletzt erschien sein Buch "Deutschlands fette Jahre sind vorbei” (2024). Die Schweizer Zeitung NZZ listete ihn auf Platz 59 der einflussreichsten Ökonomen 2024 aus Deutschland.