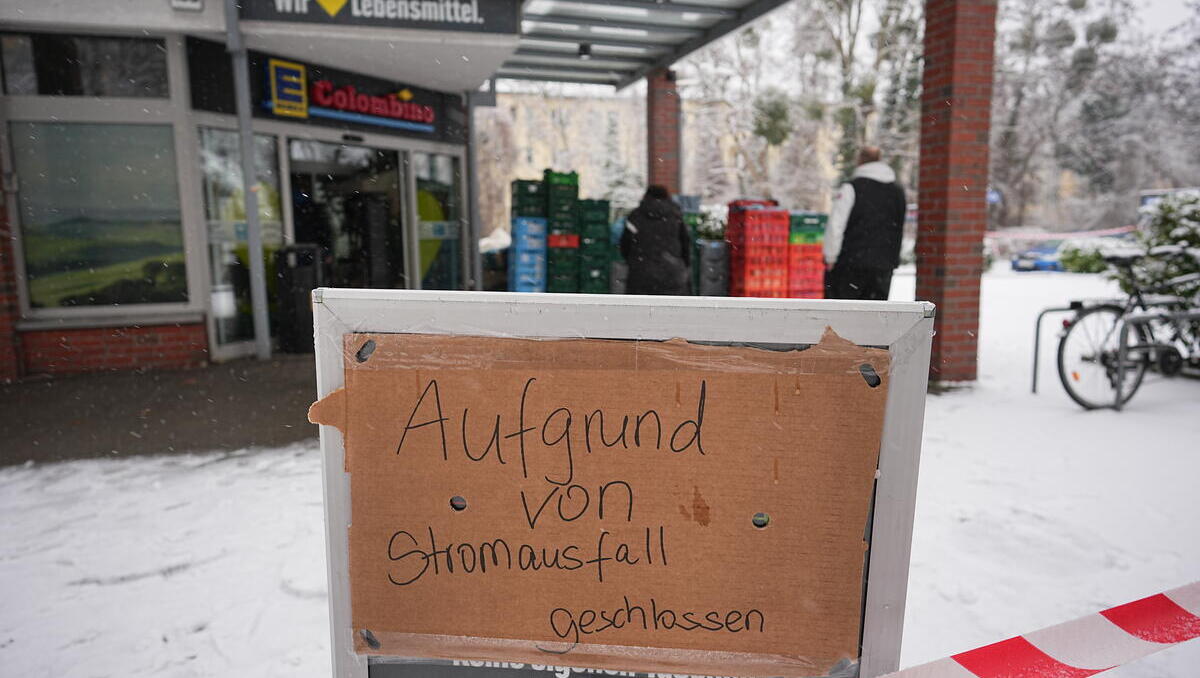Weniger Menschen leisten Überstunden
Mehrarbeit ist in immer weniger Berufen gefragt. Wer dennoch Überstunden macht, erhält meist einen Ausgleich. Doch es gibt weiterhin Ausnahmen.
Nur für eine Minderheit der Beschäftigten in Deutschland gehören Überstunden laut amtlichen Daten zum Alltag. Rund jeder und jede Neunte hat im vergangenen Jahr mehr gearbeitet, als vertraglich vereinbart war, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.
Grundlage sind Selbsteinschätzungen aus der 2024er-Ausgabe des Mikrozensus, der jährlichen Haushaltsbefragung der Statistikämter. Hochgerechnet leisteten knapp 4,4 Millionen Personen regelmäßig Mehrarbeit. Das entspricht einem Anteil von elf Prozent der rund 39,1 Millionen Erwerbstätigen. Ein Jahr zuvor hatte es noch etwa 200.000 Menschen mehr gegeben, die regelmäßig länger gearbeitet haben. Bei den Männern liegt der Anteil mit Überstunden aktuell bei 13 Prozent, etwas höher als bei den Frauen, von denen nur jede zehnte Überstunden gemacht hat.
Arbeitszeitkonten weit verbreitet
In den meisten Fällen landen die Überstunden auf einem Arbeitszeitkonto, können also später in Freizeit umgewandelt werden. 71 Prozent der Betroffenen nannten diese Option. 16 Prozent erhielten hingegen eine direkte Vergütung für die zusätzliche Arbeitszeit. Unbezahlte Überstunden haben laut eigener Angabe 19 Prozent der Befragten geleistet. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 20 Prozent. Mehrfachnennungen und damit Mischformen waren möglich.
Für 45 Prozent der Überstundenleistenden bleibt es bei höchstens fünf Stunden pro Woche. Jeder Siebte (15 Prozent) arbeitete jedoch auch mehr als 15 Stunden zusätzlich. Besonders häufig ist die Mehrarbeit im Bereich Finanz‑ und Versicherungsdienstleistungen, am seltensten im Gastgewerbe.
Neue Dynamiken durch KI und Homeoffice
Unternehmerinnen und Unternehmer sehen sich im Jahr 2025 verstärkt mit Veränderungen bei der Arbeitszeitorganisation konfrontiert. Laut der Studie "Wie wird KI die Produktivität in Deutschland verändern?" des Instituts der deutschen Wirtschaft plant die Bundesregierung eine Umstellung auf wöchentliche Arbeitszeitgrenzen. Gleichzeitig steigert KI die Effizienz und reduziert Überstunden durch automatisierte Prozesse. Flexibles Arbeiten im Homeoffice ermöglicht individuellere Arbeitszeiten, birgt aber zugleich das Risiko zeitlicher Entgrenzung, etwa durch ständige Erreichbarkeit. Für Unternehmen im unternehmerischen Umfeld bedeutet dies: Die Erfassung von Arbeitszeit wird komplexer, und es bedarf klarer Regeln. Laut dem IW-Kurzbericht fördern viele Betriebe die KI-Kompetenzen ihrer Mitarbeitenden gezielt. So zeigt eine Befragung, dass Beschäftigte, die KI nutzen, stärker an Weiterbildung interessiert sind – ein Hebel für Innovationskraft und Mitarbeiterbindung. Unternehmen, die diesen Wandel aktiv gestalten, stärken ihre strategische Position angesichts Fachkräfteengpass und Digitalisierung. Gerade KMU sollten transparente Arbeitszeitmodelle und Weiterbildungsstrategien etablieren, um sowohl Produktivität zu steigern als auch qualifiziertes Personal zu halten.