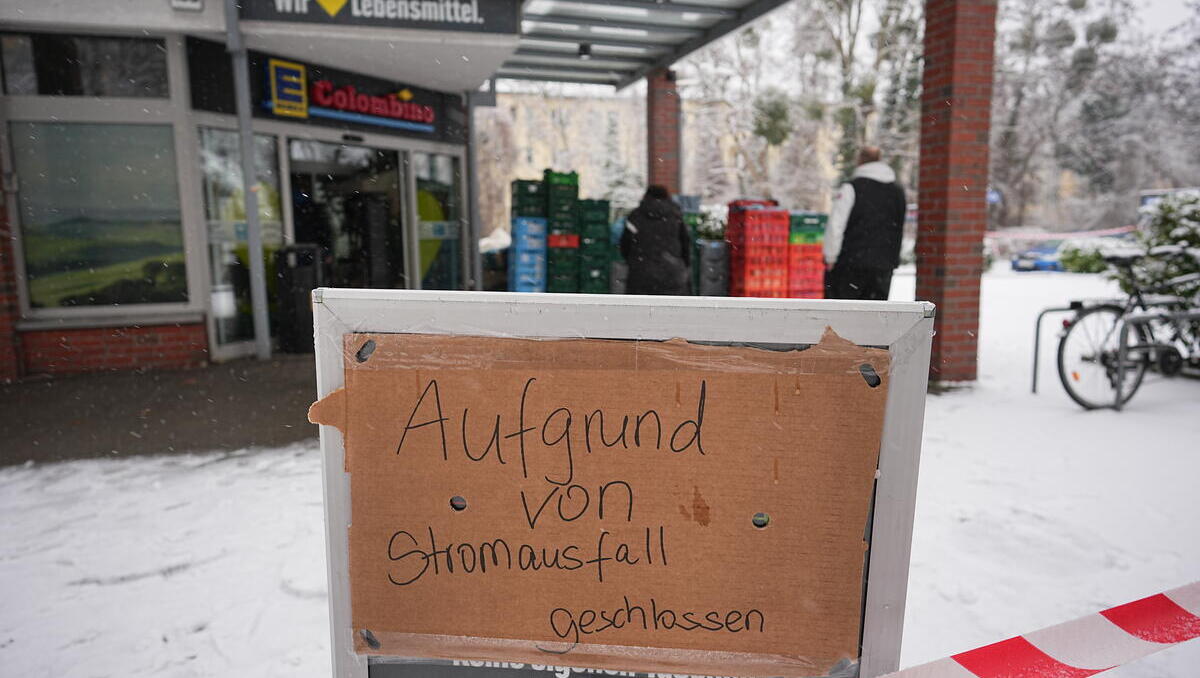Wie Schott Energieautarkie strategisch denkt
Wenn bei Schott die Schmelzwannen glühen, herrschen Temperaturen von bis zu 1.700 Grad Celsius. Das Unternehmen mit Sitz in Mainz zählt zu den weltweit führenden Produzenten von Spezialglas und Glaskeramik. Es beliefert unter anderem die Haushaltsgeräte-, Pharma- und Raumfahrtindustrie und beschäftigt am Standort Mainz rund 2.900 Mitarbeitende. Bekannt ist Schott für Cerankochfelder und Glasampullen für die Pharmaindustrie sowie für optische Fasern zur Lichtsteuerung in der Automobilindustrie, der Luftfahrt und in medizinischen Geräten.
Für Schott ist die Herstellung von Spezialglas ein energieintensives Geschäft. Die Produktionsprozesse erfordern konstant hohe Temperaturen und machen Energie zur zentralen Kostenvariable. Als 2022 die Preise für Strom und Gas in Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine durch die Decke gingen, reagierte das Management schnell. Der Krieg hatte nicht nur die europäische Gasversorgung ins Wanken gebracht, sondern auch globale Lieferketten unterbrochen und die Nachfrage nach alternativen Energiequellen rasant steigen lassen. Die Folge: massive Ausschläge auf Energie auf dem Großhandels- und Spotmarkt.
„Für uns war klar: Ohne langfristige Absicherung wird es kritisch”, sagte Dr. Achim Gleissner, Director New Ventures bei Schott, gegenüber dem Handelsblatt. Schott entschied sich deshalb für ein Power Purchase Agreement (PPA) mit einem süddeutschen Solarpark zu einer Partnerschaft über 15 Jahre. Der Vertrag garantiert planbare Grünstrompreise, ohne Zwischenhandel, ohne Börsenspekulation. „Die Investition in sauberen Strom ist nicht nur ESG”, so Gleissner weiter, „sie ist ein ganz nüchterner betriebswirtschaftlicher Vorteil.”
Energiesicherheit durch Power Purchase Agreements
Sogenannte Power Purchase Agreements (PPAs) gelten als strategisches Instrument, um langfristige Versorgungssicherheit und stabile Strompreise zu gewährleisten. Dabei schließen Unternehmen direkte Lieferverträge mit Erzeugern ab, meist über viele Jahre. Laut Deutscher Energie-Agentur (dena) können Corporate PPAs Preisrisiken reduzieren und gleichzeitig zum Klimaschutz beitragen. Für kleine und mittlere Unternehmen ist der Zugang jedoch anspruchsvoll, denn Vertragsvolumina, juristische Beratung sowie eine gründliche Risikoabschätzung des PPA überfordern viele Unternehmen.
Eine Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC hat analysiert, wie Unternehmen auf die gestiegenen Energiekosten reagieren. Danach verfolgen insbesondere Betriebe mit mehr als 100 Mitarbeitenden zunehmend strategische Ansätze wie PPAs. In der Studie heißt es: „Es gibt eine zunehmende Bereitschaft, in strukturelle Energielösungen zu investieren.” Der PwC-Experte Andreas Jentgens sieht dennoch Nachholbedarf: „Der Mittelstand braucht verständliche Instrumente und vor allem Beispiele, wie es funktionieren kann.”
Während größere Mittelständler auf langfristige Vertragslösungen wie PPAs setzen, suchen kleinere Betriebe nach einfacheren Wegen, ihre Energiekosten zu stabilisieren. Besonders Photovoltaikanlagen, kurz PV-Anlagen, gewinnen in diesem Kontext mehr und mehr an Bedeutung.
Photovoltaik-Anlagen: ESG ist nicht der Hauptgrund
PV-Anlagen auf dem eigenen Firmendach sind für viele Mittelständler längst mehr als ein ökologisches Bekenntnis. Eine E.ON-Studie zur Energiewende im Mittelstand aus dem Jahr 2023 zeigt: Betriebe mit Eigenstromnutzung sparen teils über 100.000 Euro jährlich, vor allem dann, wenn Stromproduktion und Stromverbrauch zeitlich zusammenfallen. Dabei gilt: Je höher der Eigenverbrauchsanteil, desto kürzer die Amortisationszeit.
Hinzu kommen sogenannte weiche Faktoren. Eine PwC-Umfrage aus dem Jahr 2024 unter 500 mittelständischen Entscheidern ergab: Rund 61 Prozent der Betriebe mit eigenen PV-Anlagen berichten von gestiegener Mitarbeitermotivation. „Die eigene Stromproduktion wirkt identitätsstiftend”, sagt Studienleiterin Dr. Jana Schumann. Sie leitet bei PwC den Bereich Sustainability Transformation und verweist auf eine weitere Erkenntnis: „PV-Projekte führen oft zu einem unternehmensweiten Kulturwandel. Energie wird vom Kostenfaktor zum strategischen Thema.” Darum empfehlen die Studienautorinnen und -autoren, interne Kompetenzen im Energiemanagement gezielt auszubauen und praxisnahe Erfolgsbeispiele stärker sichtbar zu machen.
Ein Beispiel für erfolgreiche Umsetzung liefert die Konservenfabrik Feinkost Dittmann aus dem hessischen Taunusstein. Bereits 2019 nahm das Unternehmen eine eigene PV-Anlage in Betrieb und koppelte sie mit einem intelligenten Lastmanagement. Die Investition hat sich laut der PwC-Studie in weniger als fünf Jahren amortisiert. In der Erhebung heißt es dazu: „Solche Leuchtturmprojekte zeigen, dass technische Umsetzung und kultureller Wandel Hand in Hand gehen können, gerade im Mittelstand.“
Seit 2019 haben sich die regulatorischen Voraussetzungen für Eigenstromprojekte im industriellen Umfeld jedoch deutlich verändert. Neue Regeln im Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), Vereinfachungen bei der Direktvermarktung und erweiterte Möglichkeiten der Eigenverbrauchsoptimierung haben Investitionen in PV-Anlagen attraktiver gemacht. Förderinstrumente wie die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) oder das Programm „Energieeffizienz in der Wirtschaft“ stehen auch 2025 zur Verfügung, allerdings oft mit reduziertem Fördersatz oder höherem Antragsaufwand. Entscheidend bleibt eine frühzeitige Planung, idealerweise in Verbindung mit einem Last- und Speicherkonzept. Darauf verweisen mehrere Erhebungen, darunter die PwC-Studie.
Eigenstromlösungen im Mittelstand: Technologien und Praxisbeispiele
Photovoltaikanlagen auf dem eigenen Dach sind der bekannteste Weg zur Energieautarkie, doch längst nicht der einzige. Mittelständische Betriebe nutzen heute ein breites Spektrum an Eigenstromlösungen: von Blockheizkraftwerken (BHKW) über Batteriespeicher bis hin zu Kombinationen aus PV, Wärmepumpe und intelligentem Energiemanagement.
Nach Zahlen der dena aus dem Frühjahr 2025 betreiben rund 28 Prozent der mittelständischen Produktionsbetriebe in Deutschland eine eigene Stromerzeugungsanlage. In mehr als zwei Dritteln der Fälle kommt Photovoltaik zum Einsatz, zunehmend ergänzt durch Speichersysteme. Die durchschnittliche Amortisationszeit liegt laut KfW bei sechs bis acht Jahren, bei steigenden Strompreisen sinkt sie weiter. Seit der Reform des EEG gelten zudem vereinfachte Regelungen für Eigenverbrauch und Einspeisung, insbesondere für Anlagen unter einem Megawatt installierter Leistung.
Ein Beispiel ist das Unternehmen Laserplast in Nordrhein-Westfalen. Der Kunststoffverarbeiter mit 120 Beschäftigten investierte 2023 in eine 600-kWp-Dachanlage inklusive Batteriespeicher und Energiemanagementsystem. Der Eigenverbrauchsanteil liegt heute bei rund 70 Prozent, die Stromkosten sanken um über 40 Prozent. Laut dem Whitepaper „Cloudlösung Energiemonitoring“ von Janitza (2024) nutzt Laserplast darüber hinaus tagesaktuelle Verbrauchsdaten zur Feinsteuerung seiner Produktion und erstellt CO₂-Bilanzen für die Kundenkommunikation. „Für uns war das kein Imageprojekt, sondern ein echter Effizienzhebel“, sagt Geschäftsführer Jens Althoff im Anwenderbericht. Neben PV spielen auch Kraft-Wärme-Kopplung und biogene Reststoffe als Energiequelle eine wachsende Rolle, etwa in der Lebensmittel- oder Holzverarbeitung. In Gewerbegebieten entstehen zunehmend lokale Energiekooperationen, bei denen mehrere Betriebe gemeinschaftlich in Erzeugung und Speicher investieren, mit geldwerten Vorteilen bei Investitionsvolumen und Betriebskosten.
Wichtig für den Erfolg solcher Projekte sind laut DIHK insbesondere klare Zuständigkeiten im Unternehmen, kompetente Projektpartner und eine realistische Wirtschaftlichkeitsrechnung. Hinzu kommen steuerliche Rahmenbedingungen und Beratungsangebote, Energieagenturen oder branchenspezifische Plattformen. Wer Eigenstrom systematisch plant, kann seine Energieabhängigkeit spürbar senken und neue Wertschöpfung im eigenen Betrieb erschließen.
Batteriespeicher: Der Schlüssel zur Flexibilität
- Ergänzend zu den genannten Maßnahmen hebt der DIHK in seinem aktuellen Leitfaden „Gewerbliche Stromspeicher – Orientierung für Industrie und Gewerbe“ (2024) die Rolle von Speichersystemen hervor. Sie ermöglichen es Unternehmen, Strom bedarfsgerecht zu nutzen, Lastspitzen abzufedern und die Eigenverbrauchsquote zu steigern. Sechs Praxisbeispiele aus dem Leitfaden verdeutlichen das Potenzial.
- Der Metallverarbeiter KMS in Brandenburg nutzt seinen Batteriespeicher gezielt für den Betrieb in Nachtschichten. Das Ergebnis: geringere Netzentgelte, eine verbesserte CO₂-Bilanz und eine schnellere Amortisation der gesamten Eigenstromlösung.
- Die Vulkan-Brauerei in Rheinland-Pfalz nutzt einen 250 kWh-Batteriespeicher zur Abdeckung von Lastspitzen bei der Kühlung und Abfüllung. Ergebnis: rund 20 Prozent geringere Strombezugskosten und ein CO₂-sparender Betrieb durch optimierten Eigenverbrauch.
- Die K+S-Tochter REKS, ein Spezialist für Recycling und Entsorgung im Kalibergbau, erprobt an einem hessischen Industriestandort die Integration eines Großspeichers mit 1.000 kWh zur Eigenverbrauchsoptimierung bei gleichzeitiger Netzdienstleistung. Ziel ist es, flexible Lastverschiebung mit CO₂-Reduktion zu verbinden.
- Die Schreinerei Wiedmann aus Baden-Württemberg koppelte ihre PV-Anlage mit einem Lithium-Ionen-Speicher. So konnten Lastspitzen um 30 Prozent reduziert und teure Leistungsspitzen vermieden werden.
- Der Maschinenbauer Sieber GmbH aus Bayern betreibt seit 2023 ein Speicher- und Lastmanagementsystem mit 500 kWh Kapazität, das über eine zentrale Plattform die Produktion mit PV und Stromtarifen synchronisiert – Ergebnis: 35 Prozent geringere Strombezugskosten.
- Die Feinmechanik-Firma Ares in Bayern setzte auf ein hybrides System aus PV und Redox-Flow-Speicher. Der Clou: die hohe Zyklenfestigkeit bei gleichbleibender Kapazität – ideal für hohe Ladefrequenz im 3-Schicht-Betrieb.
Laut DIHK eröffnet der Einsatz von Stromspeichern mittelständischen Betrieben nicht nur ökonomische, sondern auch strategische Spielräume, etwa bei Netzausbaukosten, Versorgungssicherheit und der Erfüllung von Nachhaltigkeitszielen. Wer Eigenstrom systematisch plant, kann seine Energieabhängigkeit spürbar senken und neue Wertschöpfung im eigenen Betrieb erschließen.
Energiemanagementsysteme: Der unsichtbare Hebel
Wirtschaftlich erfolgreich wird Eigenstromnutzung erst dann, wenn Verbrauch und Erzeugung konsequent aufeinander abgestimmt sind. Dafür braucht es ein funktionierendes Energiemanagement. „Transparenz ist die Voraussetzung für Effizienz“, sagte Louisa Jantos auf dem Mittelstandsforum 2024 in Göttingen, organisiert vom Institut für Handwerksforschung. Gerade für kleinere Betriebe sei eine belastbare Datenbasis entscheidend, um Energieprojekte wirtschaftlich zu bewerten und gezielt umzusetzen. Gemeinsam mit Dr. Lukas Meub entwickelte sie das E-Tool, ein niedrigschwelliges Energiemanagementsystem speziell für Handwerksbetriebe. Es zeigt Amortisationszeiten, CO₂-Bilanzen und Förderfähigkeit und funktioniert ohne große IT-Abteilung.
Cloudbasierte Systeme wie das von Janitza, einem der führenden Anbieter für Energiemesstechnik und Monitoringlösungen in Deutschland, liefern minutengenaue Verbrauchsdaten und ermöglichen punktgenaues Lastmanagement. Janitza mit Sitz im hessischen Lahnau veröffentlichte 2024 ein Whitepaper zur firmeneigenen Cloudplattform GridVis, das die technischen Funktionen, Einsatzmöglichkeiten und Effizienzvorteile seiner Lösung praxisnah aufzeigt. „Was früher manuell in Excel gepflegt wurde, geht heute automatisiert, und das auch bei kleinem Budget“, so der Tenor des Whitepapers.
Doch laut dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) stehen viele Mittelständler beim Energiemanagement vor strukturellen Hürden. In einer gemeinsamen Veröffentlichung mit Wirtschaft Digital BW, dem Mittelstandsportal der baden-württembergischen Landesregierung zur digitalen Transformation, heißt es: „Gerade kleinere und mittlere Unternehmen verfügen oft nicht über das notwendige Personal und die Ressourcen, um ein Energiemanagementsystem selbstständig einzuführen und dauerhaft zu betreiben.“
Besonders die Verstetigung von Energiecontrolling-Prozessen gilt als zentrale Herausforderung. Der DIHK fordert deshalb gezielte externe Begleitung, niedrigschwellige Tools und vor allem verlässliche Rahmenbedingungen, die Investitionen in dauerhaftes Energiemanagement absichern. Denn trotz wachsender technologischer Möglichkeiten ist die Umsetzung oft eine Frage der politischen Rahmenbedingungen. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen stoßen hier an ihre Grenzen, nicht bei der Technologie, sondern bei Förderlogik, Planungssicherheit und bürokratischer Komplexität.
Diese politischen Unsicherheiten schlagen sich zunehmend auch im Stimmungsbild der Unternehmen nieder. Dies zeigen neue Zahlen aus dem Transformationskompass des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW): 55,7 Prozent der befragten Unternehmen sehen ihr Geschäftsmodell durch steigende Klimatransformationskosten gefährdet, nur 41,3 Prozent glauben, sich erfolgreich anpassen zu können.
Energiepolitik: Rationalisierung statt Schub
Erschwerend kommt für viele mittelständische Betriebe hinzu, dass das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unter Leitung von Katharina Reiche (CDU) das Fördersystem für Energieeffizienz und Eigenstromversorgung verschlankt hat. Viele Programme existieren zwar weiterhin, doch Zugang und Förderquoten wurden reduziert. Besonders kritisch: Die Reduktion der Energieberatungsförderung von 80 auf 50 Prozent. Gleichzeitig gilt die Förderung meist nur für Neubauten, Bestandsgebäude fallen hingegen häufig durchs Raster.
Zwar beschlossen CDU und SPD im Juni eine befristete Absenkung der Stromsteuer auf den EU-Mindestsatz von 0,05 Cent/kWh für Unternehmen des produzierenden Gewerbes sowie der Land- und Forstwirtschaft. Die Maßnahme gilt rückwirkend zum 1. Januar 2024 und soll laut Bundesregierung zu Entlastungen von über drei Milliarden Euro jährlich führen.
Kritiker bemängeln jedoch, dass vor allem große Industrieunternehmen profitieren, energieeffizientere Mittelständler hingegen leer ausgehen. So kritisierte Markus Jerger, Vorsitzender des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW), in einer Verbandsmitteilung, dass große energieintensive Unternehmen profitieren würden, aber der Mittelstand das Nachsehen habe. „Die Politik sendet das Signal: Effizienz zählt weniger als reine Verbrauchsmengen.“