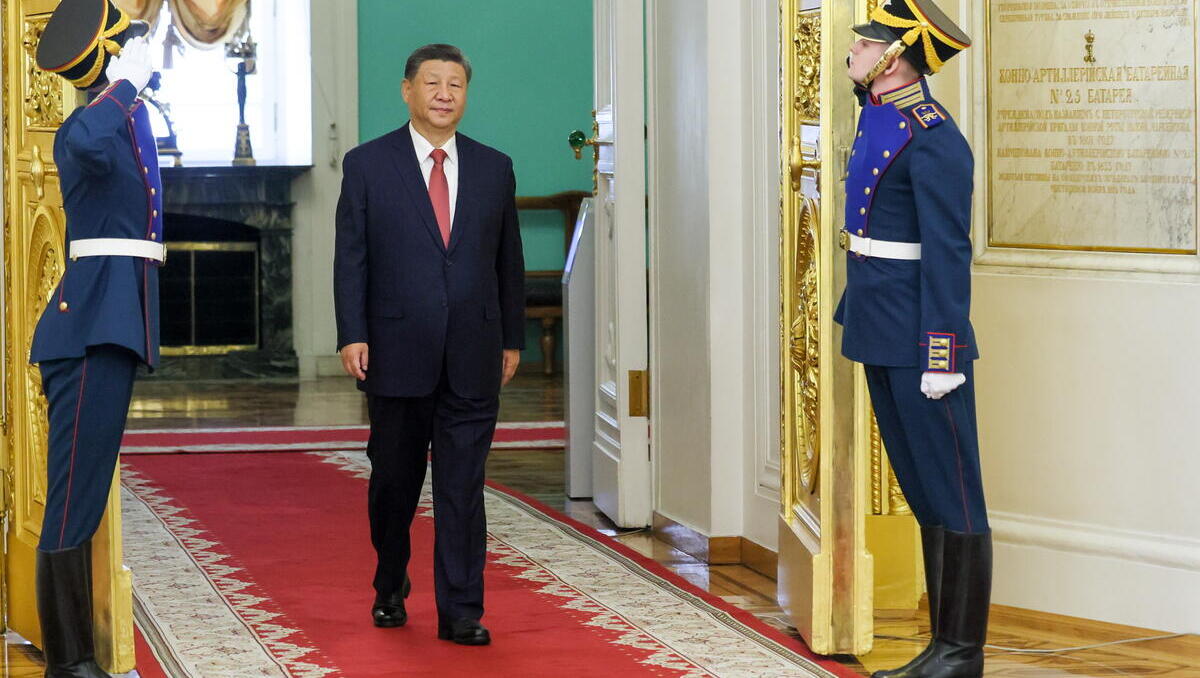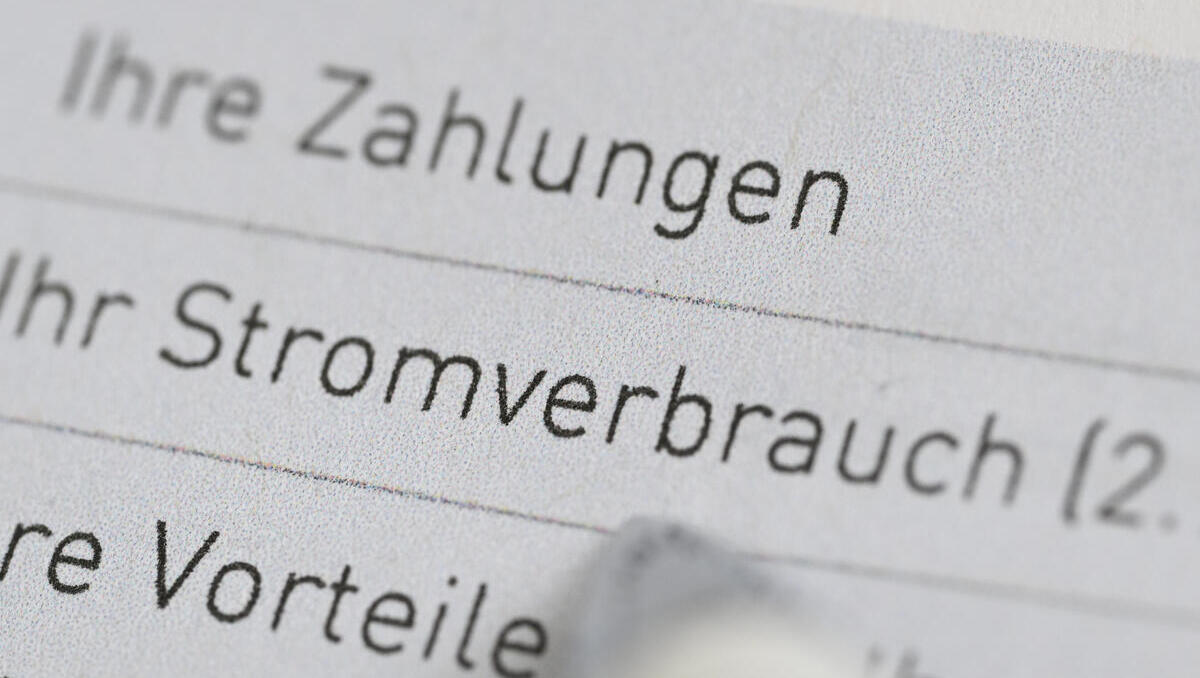Die Deutschen könnten jährlich insgesamt 4,6 Milliarden Euro bei den Ausgaben für Medikamente sparen. Ärzte müssten einerseits konsequent günstigere Generika verschreiben. Andererseits müsste das Preisniveau patentgeschützter Medikamente auf das Niveau der Preise in Frankreich herabgesetzt werden. Hier sind patentgeschützte Präparate im Schnitt ein Drittel günstiger als in Deutschland.
Auch in Großbritannien, Schweden und in den Niederlanden sind die Preise niedriger als in Deutschland. Der Staat kann in diesen Ländern als größter Abnehmer der Arzneimittel hohe Rabatte in Verhandlungen mit der Pharmaindustrie herausschlagen.
„Würde jeweils das günstigste Generikum verordnet, könnten 1,6 Milliarden Euro eingespart werden“, heißt es in einer Studie der AOK. Im Durchschnitt kosten patentgeschützte Arzneimittel zehnmal mehr als Generika-Präparate, die die gleiche Wirkung haben, so die AOK-Studie.
Die teureren Patent-Arzneien der großen Pharmahersteller würden dann in den Regalen der Apotheken liegen bleiben. Was gut für den Steuerzahler, die Krankenkassen und Patienten sei, sei aber schlecht für die Arzneimittelforschung, sagen Vertreter der Pharmaindustrie.
Im vergangenen Jahr gaben die Krankenkassen 30,6 Milliarden Euro für Medikamente aus, das sind 2,6 Prozent mehr als im Jahr 2011.
Weitere Einsparmöglichkeiten gibt es im Bereich der Analogpräparate. Anders als bei alternativen Generika, die den gleichen Wirkstoff wie patentgeschützte Medikamente besitzen, unterscheiden sich Analogpräparate in ihrer Zusammensetzung minimal von ihren Vorgängerprodukten. Es werden neue Wirkstoffe verwendet, die aber ähnlich oder genauso wirken wie das Vorgänger-Medikament. Dadurch entstehen Scheininnovationen. Diese Präparate würden meist zu teureren Preisen verkauft und verursachten zusätzliche Kosten, die vermieden werden könnten, so die Autoren der Studie.
„Pharmafirmen lassen durch Analogpräparate die Kassen klingeln“, beklagt Wolf-Dieter Ludwig, der Vorsitzende der Arzneimittelkommission, einem Bericht der Welt zufolge. Intensives Marketing, eine Verlängerung des Patentschutzes sowie „unseriöse Absprachen, um den Marktzutritt von Generika zu verlangsamen“, seien die häufigsten Strategien der Pharmahersteller, um ihre teuren Produkte am Markt zu halten.
Die Bundesregierung hat der Preistreiberei der Pharmaindustrie in Deutschland teilweise schon einen Riegel vorgeschoben. Das Arzneimittelneuordnungsgesetz (AMNOG) soll den Mehrwert eines neuen Medikamentes bewerten, bevor das Medikament zugelassen wird. Das hat nach Angaben des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) bereits zu Einsparungen von 120 Millionen Euro geführt. Im nächsten Jahr solle sich die Wirkung noch deutlicher niederschlagen, berichtet das Ärzteblatt.
Im Jahr 2010 wurden zudem ein Preisstopp und ein Zwangsrabatt für Medikamente beschlossen. Pharmahersteller müssen den Kassen einen Rabatt von 16 Prozent des Marktpreises gewähren. Bis dato waren es nur 6 Prozent.
Im kommenden Jahr wird die gesetzliche Preisbremse wieder gelöst. Patienten müssen sich dann auf einen sich schlagartig verstärkenden Preisanstieg gefasst machen.
Die Pharmaindustrie versucht, gegen eine geplante Verlängerung der Preisbremse Lobbyarbeit zu betreiben. „Es bringt nichts, überhöhte Daumenschätzungen zu Arzneimittelausgaben des Jahres 2014 zu lancieren und darauf fußend den auslaufenden Zwangsrabatt verlängern zu wollen“, sagte Birgit Fischer, Hauptgeschäftsführerin des Verbands der forschenden Arzneimittelhersteller (VfA).
Angesichts der angehäuften Rücklagen im Gesundheitsfonds, aus dem sich die Krankenkassen speisen, ist zu befürchten, dass die Pharmavertreter sich durchsetzen könnten. Preisstopp und Zwangsrabatt waren eingeführt worden, weil im Verlauf der Finanzkrise mit einer Geldnot der Krankenkassen gerechnet worden war.