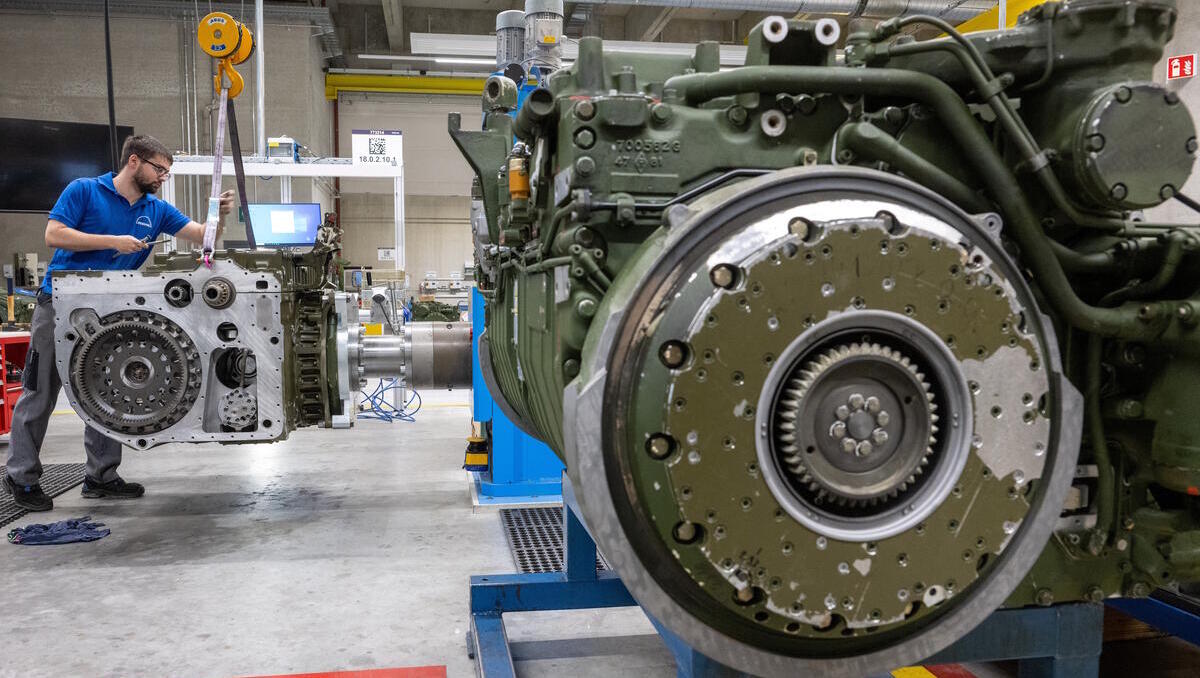Möglicherweise haben die geldpolitischen Exzesse der Europäischen Zentralbank (EZB) gar nicht das Wohl der Gesellschaft zum Ziel. Was, wenn die Dauer-Nullzinspolitik nur die Anzahl der Banken reduzieren soll? Was, wenn durch die immer größer werdenden Geldmengen Finanzkrisen erst erzeugt werden sollen – damit die EZB als vermeintlicher Retter in der Not auftrumpfen und auf diese Weise noch mächtiger werden kann?
Es besteht kein Zweifel daran, dass der europäische Bankensektor schwer in der Krise steckt. Neben dem massiven Auswuchs der Aufsichtsbürokratie, die in Europa jeder Kleinstbank aufgebürdet wird, aber beispielsweise in den USA nur eine handvoll Großbanken ertragen müssen, geben vor allem sinkende Erträge im Zinsgeschäft und seit 2020 auch drohende Kreditausfälle durch die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen Anlass zur Sorge. Darüber hinaus spriesst in Form von Neobanken und Fintechs – nicht selten von Regierungen mit Steuergeldern gefördert – neue Konkurrenz aus dem Boden, die den Kreditinstituten ihr klassisches Geschäft streitig machen.
Die EZB in ihrer Rolle als Bankenaufsicht für die Großbanken des Euroraums hält den Bankensektor für zu kleinteilig. Es gebe einfach zu viele Banken in Europa. Eine Konsolidierung sei nötig, andernfalls geht es den Großbanken nicht gut. Das heißt – wenn es nach der EZB geht – soll es in Zukunft mehr Fusionen und Übernahmen geben, damit sich die Anzahl der Geldhäuser noch weiter verringert.
Kommt es also bald zur großen Fusionswelle bei Europas Banken? Das erscheint durchaus nicht unrealistisch. Erst jüngst hat die EZB-Bankenaufsicht einen „Leitfaden zur Konsolidierung des europäischen Bankensektors“ veröffentlicht. Fusionierende Banken können demnach mit Erleichterungen bei den Kapitalvorgaben und anderen regulatorischen Vorteilen rechnen.
Aber hat die EZB mit ihrem Ratschlag wirklich das Wohl der Bankenlandschaft im Sinn? Der renommierte Ökonom Richard Werner (Professor an der De Montfort University in England) sagt Nein und stellt stattdessen die konsequente Anti-Bank-Politik der EZB ins Rampenlicht. Seine streitbare, aber höchst interessante These kann zum Beispiel in einem Podcast auf dem Ökonomie-Portal „beyond the obvious“ vernommen werden.
Professor Werner ordnet die zunehmend extremeren Maßnahmen der EZB in einen sehr viel größeren Kontext ein, der bis zur Gründung im Jahre 1998 zurückreicht. Er beruft sich dabei auf die sogenannte „Theorie der Bürokratie“, der zufolge bürokratische Institutionen – also auch die EZB – anstreben, sich immer weiter zu vergrößern und immer mehr Macht auf sich zu vereinen. Alle größeren Maßnahmen der EZB ließen sich demnach auf ein großes inhärentes Ziel zurückführen – die Anhäufung von Macht.
Monetärer Unfug mit Methode?
Laut dieser These sind die negativen Folgen der Niedrigzinspolitik sowie der extrem stark steigenden Geldmenge nicht die – bedauerlichen, aber unabwendbaren – Nebenwirkungen von Rettungsmaßnahmen, von denen die EZB-Verantwortlichen (angeblich) glauben, sie seien notwendig. Nein, es sind gezielt geplante destruktive Auswirkungen. Mit anderen Worten: Niedrigzinspolitik und Ausweitung der Geldmenge sollen gar keine positiven Auswirkungen haben. Vielmehr sollen sie das europäische Bankensystem zerstören – damit die EZB ihr großes Ziel erreichen kann: Als einzige Bank im Euroraum übrig zu bleiben.
Welche Rolle spielen finanzielle Krisen in diesem Szenario? Nun, jede Krise bietet bekanntlich auch enorme Chancen. Das Ziel der EZB ist die konstante Machtausweitung. Und diese erreicht sie, indem sie in Zeiten finanzieller Krisen (viel zu) extreme Gegenmaßnahmen ergreift. Das heißt: Die EZB profitiert von der Krise, benötigt sie sogar, wenn sie ihr Ziel – die Machterweiterung – erreichen will. Was tut sie also, wenn gerade keine Krise herrscht: Sie schafft eine solche Krise eigenhändig.
Die Zentralbankiers der extraterritorialen EZB könnten also mit ihrem geldpolitischen Rezept aus Niedrigzinsen und konstanten Geldmengenerhöhungen ganz bewusst Boom- und Bustzyklen erzeugen. Genau davor warnte Werner in seinem 2003 erschienen Buch „Princes of the Yen“, da er befürchtete, die EZB könnte durch Bankkreditschöpfung getragene Finanzblasen mit darauf folgenden Bankenkrisen, Rezessionen und Massenarbeitslosigkeit erzeugen. Bereits 2004 fing die EZB dann an, genau dies umzusetzen, was tatsächlich zu Bankenkrisen, Rezessionen und Rekordarbeitslosigkeit in Irland, Portugal, Spanien und Griechenland führte. Seit mehr als zehn Jahren warnt Werner, dass die EZB in einer Anstrengung, alle Länder gleich behandeln zu wollen, dasselbe Unheil über Deutschland bringen wird – er sieht hierzulande das Jahr 2009 als Beginn der großen Immobilienblase. Die Maßnahmen seit 2020 vergrößern die Finanzblase und nach den infolgedessen zu erwartenden Bankenkrisen, Rezessionen und platzenden Finanzblasen könnte man bald noch stärkere Maßnahmen als zuvor begründen.
Werner zufolge ist die EZB eine sehr schlechte Zentralbank und folge leider nicht dem Erbe der deutschen Bundesbank, welche er als „die wohl beste Zentralbank in der Geschichte der Zentralbanken“ bezeichnet. Stattdessen sei die Geldpolitik der EZB eher in der Tradition der Reichsbank zu verorten – der laut Werner schlechtesten Zentralbank der Geschichte. Die Reichsbank verschuldete unter anderem die Hyperinflation 1923.
Und wenn man Werners Thesen Glauben schenkt, dann sind die zahlreichen Probleme in der noch jungen Geschichte der Zentralbank Europas kein Zeichen von Unfähigkeit, sondern Zeichen eines böswilligen Langzeitplans: Eine Abhängigkeit der Banken von Krediten der EZB wäre ebenso gewünscht wie die dominante Rolle als deren Regulator. Die teilweise fatalen Auswirkungen der extrem lockeren Geldpolitik auf das Kreditgeschäft der Banken wären auch ganz im Sinne der EZB. Die sinkenden Kreditmargen setzen vorwiegend kleinere Institute unter Druck und machen sie zu leichten Übernahmezielen größerer Konkurrenten, während ihnen meist kein anderes Geschäftsmodell mehr übrigbleibt, als die Immobilienblase weiter zu befeuern. Großbanken können auch regulatorische Vorgaben viel besser erfüllen als ihre kleineren Mitbewerber.
Konsequent zu Ende gedacht impliziert Werners Theorie, dass die EZB die Euro-Bankenlandschaft so lange ausräuchern will, bis nur noch einige wenige Großbanken übrig sind und sogar diese dann irgendwann an der Reihe sein könnten. Dazu würde auch die jüngste Empfehlung für Fusionen und Übernahmen passen.
Bei einer oligopolistischen Bankenkandschaft sind auch die Auswirkungen von finanziellen Krisen extremer und diese Krisen können schneller systemgefährdend wirken, weil Großbanken mit ihren äußerst umfangreichen Aktivitäten an den Anleihe-, Aktien- und Derivatemärkten von solchen Krisen meist sehr stark betroffen sind – im Gegensatz dazu können kleinere Banken kaum von einer Finanzkrise betroffen sein, wenn sie sich zum Beispiel vorwiegend in der Kreditvergabe an bonitätsstarke Unternehmen engagieren. Größere Auswirkungen von Krisen auf den Bankensektor wären gemäß Werners Thesen ganz im Sinne der EZB, weil man in einer ausgewachsenen Bankenkrise auch entsprechend weitläufige Zentralbank-Eingriffe rechtfertigen könnte.
Die drohende „Sowjetisierung“ der Bankenlandschaft Europas
Je weniger Banken man kontrollieren muss und je größer diese Banken sind, umso größer ist auch der Einfluss der EZB. Auch die Daueranstrengungen der EU-Kommission zur Installierung einer europäischen Bankenunion und länderübergreifenden Gemeinschaftshaftung der Einlagensicherungssysteme ergeben aus diesem Blickwinkel ein völlig neues Bild.
Am Ende soll es offenbar nur eine Bank geben, das ist letztlich nichts anderes als das marx´sche Bankenmodell. Werner warnt deshalb vor einer drohenden „Sowjetisierung“ der Bankenlandschaft in Europa. Das mag weit hergeholt klingen, aber schon die reine Existenz von Notenbanken hat Berührungspunkte zum Marxismus. Im Kommunistischen Manifest wird explizit die „Zentralisierung des Kredits“ gefordert. Die Idee einer Zentralbank als einzigen Bank für den gesamten Währungsraum hat Marx und Engels offenbar imponiert und in der Sowjetunion gab es dann auch nur noch die staatliche „Gosbank“.
Werner sieht sogar noch weitlaufendere Zusammenhänge und führt den aktuellen (grünen) Zeitgeist des vermeintlich ungesunden Wachstumszwangs an, wobei das Konzept einer Einheitsbank diesem Zeitgeist gerecht werden würde. Kredite bezeichnet er als Schmiermittel der Wirtschaft. Wenn die gesamte Kreditvergabe in einer riesigen Einheitsbank mit unvorstellbarer, das Kreditwesen aushöhlender Bürokratie zentralisiert sei, würde es nämlich kein Wirtschaftswachstum mehr geben oder sogar zum für sozialistische Systeme typischen Substanzverlust kommen.
Wirtschaftliche Prosperität ist für Professor Werner stark von der Struktur des Bankensektors abhängig. Demnach bietet eine sehr kleinteilige Struktur wie etwa in Deutschland gute Voraussetzungen für eine gesunde florierende Volkswirtschaft. Den Aufstieg Chinas zur Weltwirtschaftsmacht sieht er wesentlich in der Anfang der Achtzigerjahre duchgeführten Dezentralisierung der Bankenlandschaft begründet, als die Regierung unter Deng Xiaoping tausende von ländlichen und städtischen Kreditgenossenschaften gründete.
Wege zur Einheitsbank
Wie weit ist denn die vermeintlich geplante Zentralisierung von Europas Bankensektor bereits fortgeschritten? Eine Einheitswährung mit einer Zentralbank und einem Zins für den gesamten Euroraum gibt es ja immerhin schon. Die Anzahl der Banken in der Eurozone ist laut Professor Werner seit Gründung der EZB um mehr als 4.800 gesunken. Die Transformation der EZB zur einzigen Bank Europas sieht er folglich als konsequenten nächsten Schritt in ihrem Streben nach immer mehr Macht.
-
Lesen Sie morgen den zweiten Teil der großen Zentralbank-Analyse:
Wird aus der Europäischen Zentralbank bald die "Europäische Freiheitsbank"?
-
Welchen Einfluss das Klima auf die Geldpolitik hat
-
Wie man jedem Bürger ein Konto bei der EZB aufzwingen wird
-
Wie die EZB mit ihrer Geldpolitik die Menschen freier macht - oder auch nicht