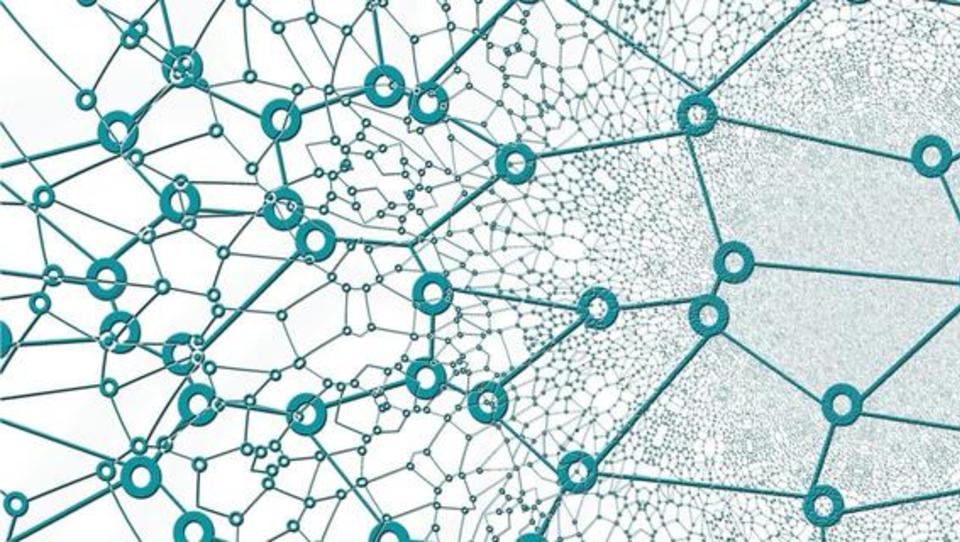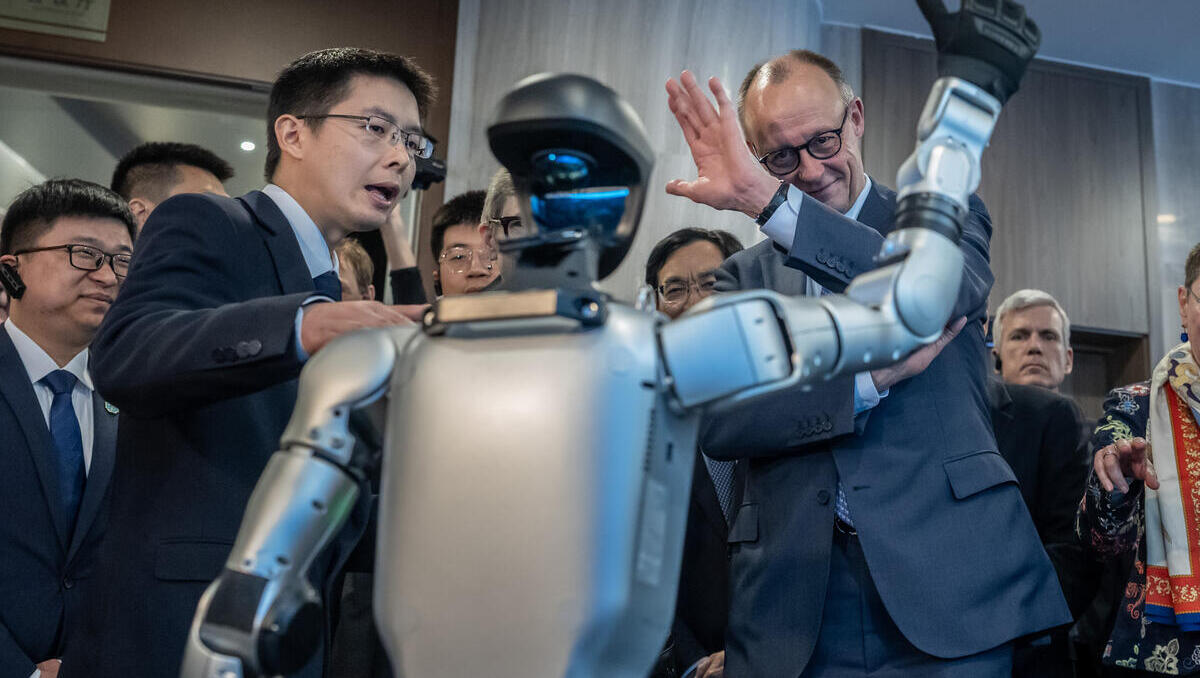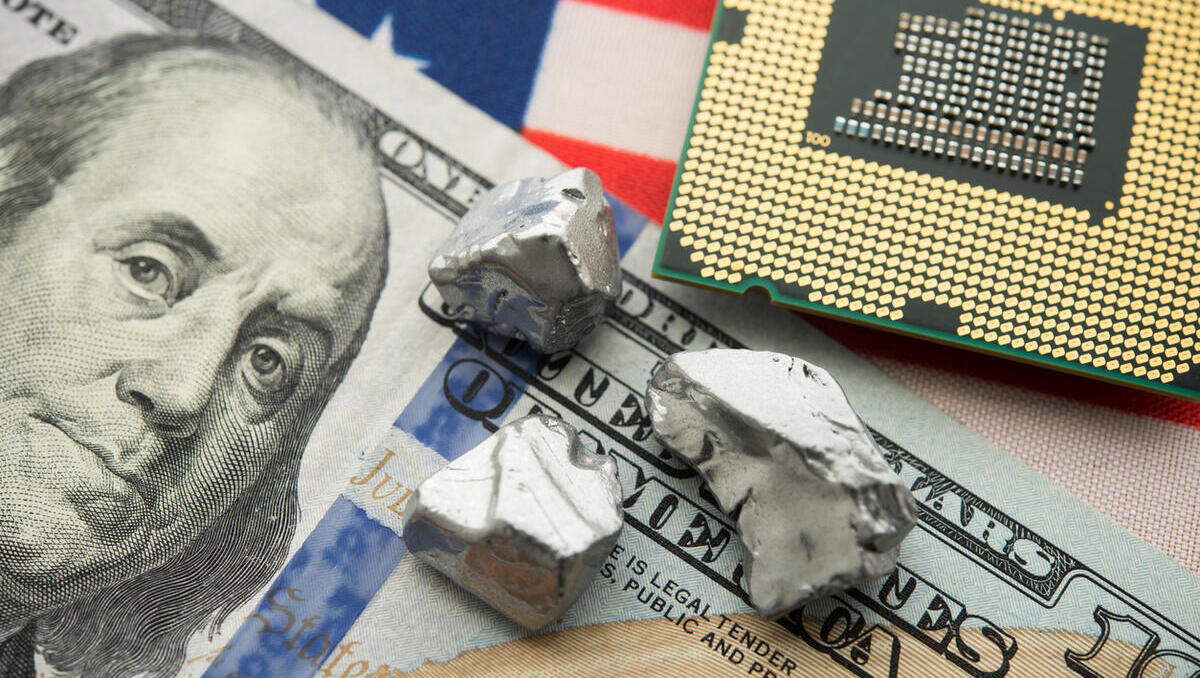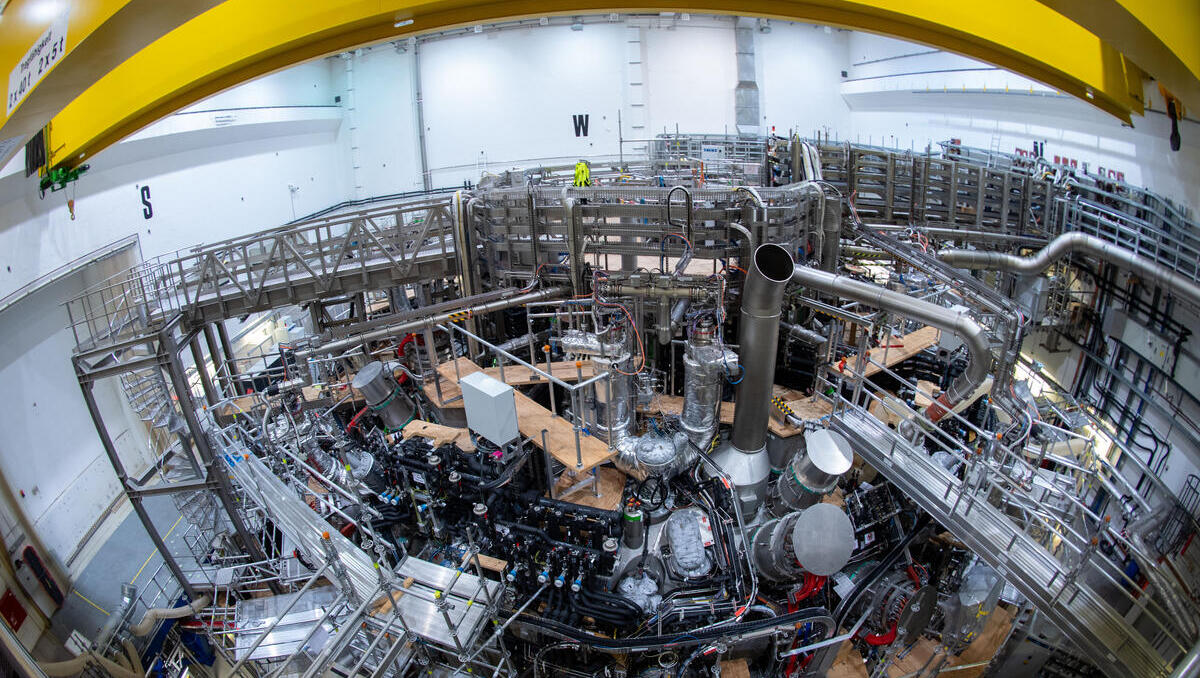Krisenängste hat es in vielen historischen Phasen gegeben. Im Kalten Krieg war etwa die Angst vor einem Atomkrieg weit verbreitet. Und diese Angst wurde in Ost und West vom überwiegenden Teil der Menschen geteilt. Zwar wurde darüber gestritten, wie die Politik mit dieser Gefahr umgehen solle, ob Aufrüstung zur Abschreckung oder Abrüstung zur Deeskalation der richtige Weg sei, doch die Auffassung, dass das Risiko eines verheerenden Atomkriegs eine enorme Gefahr darstellte, war Konsens.
Ganz anders heute: Der Konsens im Hinblick auf die drohenden Krisen ist in den vergangenen Jahren immer mehr verloren gegangen. In der Vergangenheit vertrauten die Menschen vor allem auf eine Reihe von allgemein anerkannten Autoritäten, um die Welt zu verstehen. Doch mit dem Einzug des Internets und der Macht der sozialen Medien haben die herkömmlichen Autoritäten bei der Suche nach einem Verständnis von der Welt massiv an Einfluss verloren.
Sicherlich hatten jene, die in der Hierarchie oben standen, niemals eine vollständige Kontrolle. So haben sich etwa Sprachen nicht einfach dadurch entwickelt, dass die Obrigkeit neue Wörter einführt. Vielmehr waren es jene, welche ein neues Wort für irgendeinen ihrer Zwecke brauchten. Wenn dann immer mehr Menschen das neue Wort als sinnvoll erachteten und es übernahmen, wurde es zum festen Teil der Sprache. Über die Zeit können sich auf diese Weise aus einer Sprache ganz organisch sogar mehrere verschiedene Sprachen entwickeln, ohne dass dies hierarchisch gesteuert werden müsste.
Im Gegensatz dazu sind hierarchische Strukturen äußerst effektiv, wenn es um Dinge wie Jagd oder Krieg geht. Wenn dabei jeder auf seinen Anführer hört, ohne dessen Anweisungen in Frage zu stellen, kann auch eine große Gruppe äußerst schnell agieren und hat folglich eine höhere Chance auf Erfolg. Sicherlich sind solche hierarchischen Strukturen auch weiterhin von Bedeutung, etwa bei der Führung von Unternehmen. Doch organische Strukturen wie die sozialen Netzwerke sind heute viel schneller. Bei aktuellen Ereignissen wie zum Beispiel Terroranschlägen verbreiten sich alternative Darstellungen heute praktisch genauso schnell wie die offizielle Darstellung in den Abendnachrichten – und in der Folge erleben die Menschen diese Ereignisse dann recht unterschiedlich.
Dies gilt insbesondere, wenn es um die Ausbreitung von Zukunftsängsten geht. Angst erzeugende Informationen – egal ob wahr oder falsch – können sich über die sozialen Netzwerke in rasender Geschwindigkeit von Mensch zu Mensch verbreiten. Auf diese Weise kann sich Angst wie ein Virus durch die Gesellschaft fressen. Doch genau wie ein Virus nicht jeden infiziert, so lassen sich auch nicht alle von denselben Ängsten anstecken. In der Folge können Menschen, die einander kennen und nahe zusammenleben, innerhalb kurzer Zeit von ganz verschiedenen grundlegenden Ängsten befallen werden und sich dadurch vollkommen voneinander entfremden. Diese Entwicklung ist deshalb so gefährlich, weil sie notwendig zur Spaltung und zu gewalttätigen Konflikten zwischen Menschen führt, die zuvor durch eine grundlegende Einigkeit miteinander verbunden waren.
Spätestens mit Corona haben wohl viele Deutsche genau diese Erfahrung gemacht, dass Menschen, mit denen sie viele Jahre zusammen zur Schule oder zur Arbeit gegangen sind, innerhalb weniger Monate zu Fremden geworden sind, deren Ängste so verschieden sind von den eigenen, dass man regelrecht anderen Kulturen anzugehören scheint. Sicherlich ist „Teile und herrsche“ ein bewährtes Herrschaftsprinzip, doch damit ist nicht gemeint, dass die Mächtigen es dem chaotischen Prozess der sozialen Netzwerke überlassen wollen, wovor die Bevölkerung Angst hat. Vielmehr sind Meinungen, die in grundlegenden Fragen vom herrschenden Konsens abweichen, eine Bedrohung.
Daher bemühen sich die sozialen Netzwerke unter dem Druck von Werbekunden und Politik, die Verbreitung von dort unerwünschten Ängsten zu verhindern. Dabei müssen sie auf ähnliche Weise vorgehen wie bei der Bekämpfung eines Virus. Denn Meinungen können sich rasend schnell über die sozialen Netzwerke verbreiten, was teils noch dadurch verstärkt wird, dass die Algorithmen den Nutzern Inhalte vorschlagen, die den zuvor von den Nutzern für gut befundenen Inhalten ähneln. Die großen sozialen Netzwerke können in Echtzeit mitverfolgen, wie sich bestimmte Inhalte in Blitzesschnelle von Nutzer zu Nutzer immer weiter ausbreiten. Entsprechende Werkzeuge stehen ihnen längst zur Verfügung, da sie bei der Platzierung von Werbung zum Einsatz kommen.
Die sozialen Netzwerke müssen Rücksicht darauf nehmen, im Zusammenhang mit welchen Themen Unternehmen teure Anzeigen schalten wollen und welche Themen sie möglicherweise abschrecken. Bekanntlich sind die werbenden Unternehmen die Kunden der sozialen Netzwerke – und nicht die Nutzer. Inhalte, welche die Werbekunden abschrecken, schaden dem Geschäft. Daher messen die sozialen Netzwerke, um bei Bedarf einschreiten zu können, was wie stark geteilt wird und was wie viele Nutzer dazu veranlasst, eigenen Content zu erstellen und die Verbreitung auf diese Weise voranzutreiben.
Ein Mittel, mit dem soziale Netzwerke dieses Problem angehen, ist das historisch recht bewährte Mittel der Zensur. Unerwünschte Inhalte werden mit einem Warnhinweis versehen, nur noch eingeschränkt angezeigt oder einfach gelöscht. Die Urheber dieser unerwünschten Posts werden vorübergehend oder endgültig von der Plattform ausgeschlossen, was in etwa der Quarantäne im Kampf gegen einen Virus entspricht. Die Wirkung von Zensur – einem hierarchischem Mittel – ist jedoch begrenzt im Kampf gegen einen organischen Gegner, da Zensur oftmals das Interesse an bestimmten Themen und Personen sogar verstärkt. Weitaus wirksamer ist es, unerwünschte Meinungen in einem Wust von Unsinn zu verstecken. Unsinn ist den Werbetreibenden und der Politik allemal lieber, als ansteckende „virale“ Verschwörungstheorien.
Diese Beschleunigung der Kommunikation hat den Konsens im Hinblick auf die wirklich drohenden Krisen zerstört. Diese grundlegende Veränderung hat Freundschaften und Familien gespalten. Die Konflikte zwischen den verschiedenen Gruppen sind auch ein schlechtes Omen für die kommenden politischen Veränderungen. Denn in der Regel treten kulturelle Phänomene mit Verzögerung auch in der Politik zutage. Soziale Bewegungen bringen den Stein ins Rollen und geben den Anstoß für Veränderungen in Politik und Recht. So war es zum Beispiel bei der Einführung des Frauenwahlrechts, bei der Legalisierung der Abtreibung oder bei der Energiewende.
Menschen werden auf Dauer nicht friedlich miteinander zusammenleben können, wenn sie sich gegenseitig zunehmend als Bedrohung wahrnehmen. Wer zum Beispiel den Eindruck hat, dass der Nachbar die dringende Rettung des Klimas sabotiert, dass er willentlich Träger eines gefährlichen Virus ist oder dass er den Kindern eine giftige Impfung verabreichen will, der wird es wohl für gerechtfertigt halten, wenn Gewalt gegen den Nachbarn zum Einsatz kommt. Die drohende Gewalt könnte vielleicht abgewendet werden, wenn Deutschland geografisch in zwei oder mehr Staaten aufgeteilt wird oder wenn eine neue Methode gefunden wird, mit deren Hilfe ein neuer stabiler Konsens entstehen kann.