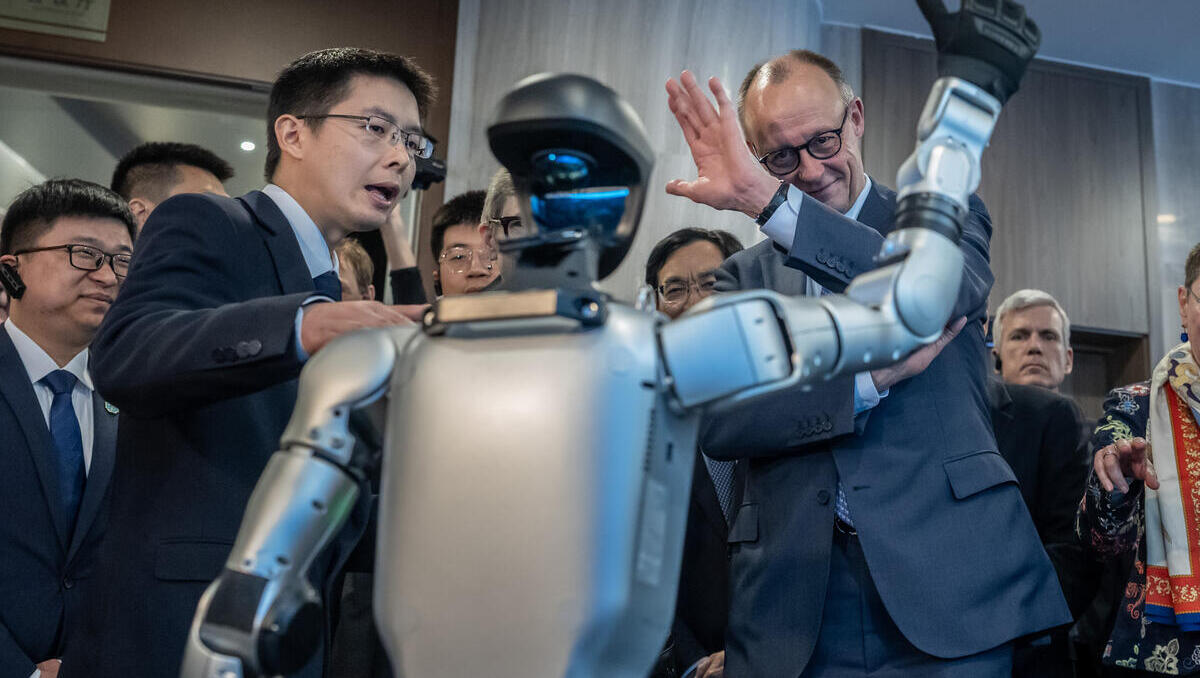Die Wissenschaft ist sich darüber im Klaren, was getan werden muss, um die globale Erwärmung auf 1,5º Celsius über vorindustriellem Niveau zu begrenzen: eine rasche und drastische Senkung der Emissionen und die jährliche Entnahme von 6-10 Gigatonnen Kohlendioxid aus der Atmosphäre. Und doch wird Ersterem weit mehr Aufmerksamkeit geschenkt als Letzterem.
Die Rolle der Kohlenstoffmärkte bei der Klimafinanzierung
Das muss sich ändern – und zwar schnell. Die Entnahme von atmosphärischem CO2 erfordert eine Aufstockung der Investitionen in Technologien zur CO2-Entnahme von heute 5-13 Milliarden Dollar auf 6-16 Billionen Dollar bis 2050. Zum Vergleich: Das ist mindestens doppelt so viel wie die Einnahmen, die die Öl- und Gasindustrie jedes Jahr erzielt.
Abgesehen von der moralischen – man könnte auch sagen existenziellen – Verpflichtung zum Klimaschutz gibt es auch wirtschaftliche Gründe für den Einsatz von Technologien zur CO2-Entnahme in der EU. Bis 2050 könnte eine globale Branche, die imstande ist, Netto- Emissionsneutralität zu erreichen, zwischen 300 Milliarden und 1,2 Billionen Dollar wert sein.
Neben privaten und öffentlichen Investitionen haben sich die Kohlenstoffmärkte – auf denen Unternehmen Emissionsgutschriften kaufen, um ihre Emissionen auszugleichen – zu einer der wichtigsten Finanzierungsquellen für Projekte zur CO2-Entnahme entwickelt. Durch die Bepreisung von Kohlenstoff werden Unternehmen angeregt, ihre Energieeffizienz zu steigern und umweltfreundliche Lösungen für ihre gesamte Betriebstätigkeit zu entwickeln und umzusetzen.
Verpflichtende vs. freiwillige Kohlenstoffmärkte: Ein Überblick
Es gibt heute zwei Hauptansätze für die Bepreisung von Kohlenstoff: den Verpflichtungsmarkt und den freiwilligen Kohlenstoffmarkt. Der Verpflichtungsmarkt wird durch obligatorische Regelungen zur Kohlenstoffreduzierung reguliert und zielt hauptsächlich auf emissionsstarke Branchen wie Stahl, Öl und Verkehr, während der freiwillige Markt unabhängig und ohne direkte regulatorische Aufsicht operiert.
Das Emissionshandelssystem (ETS) der EU, der Verpflichtungsmarkt der Union, funktioniert nach dem Prinzip des Emissionshandels mit festen Obergrenzen, wobei Unternehmen in bestimmten Sektoren Emissionszertifikate erhalten, deren Angebot auf ein Niveau begrenzt ist, das die CO2-Emissionen insgesamt reduziert. Die Unternehmen können ungenutzte Zertifikate auf dem Markt verkaufen, oft an Unternehmen, die zusätzliche Zertifikate benötigen.
Im Gegensatz dazu bieten freiwillige Kohlenstoffmärkte Unternehmen und Einzelpersonen die Möglichkeit, Gutschriften aus geprüften Kompensationsprojekten zu erwerben, um Nachhaltigkeitsziele unabhängig von Emissionszertifikaten zu erreichen. Diese Märkte verwenden unterschiedliche Methoden, um sicherzustellen, dass die Emissionsreduzierungen real, messbar und dauerhaft sind.
Kritik an freiwilligen Märkten: Greenwashing oder echte Lösung?
Leider haben die jüngsten Debatten über freiwillige Kohlenstoffmärkte trotz der Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen Zweifel an ihrer Nützlichkeit aufkommen lassen. Skeptiker argumentieren, dass mangelnde Transparenz und uneinheitliche Standards zu minderwertigen Gutschriften auf Grundlage von Kompensationsmaßnahmen führen, die nicht die versprochenen Emissionsreduzierungen erbringen. Ihrer Ansicht nach ermöglichen diese Märkte großen Unternehmen eine ausgeklügelte Form des Greenwashings.
Die Kontroverse spitzte sich Anfang des Jahres zu, als Pessimisten die Legitimität der Science Based Targets Initiative (SBTi) in Frage stellten, die die globalen Standards und Instrumente entwickelt, die es Unternehmen ermöglichen, Treibhausgasziele festzulegen, um bis 2050 Netto-Emissionsneutralität zu erreichen. Die Entscheidung der SBTi, Unternehmen die Möglichkeit zu geben, freiwillige Kohlenstoffgutschriften in die Berechnung ihrer indirekten Emissionen einzubeziehen, löste eine heftige Gegenreaktion aus, da viele die Glaubwürdigkeit dieser Instrumente in Frage stellten. Einige Monate später revidierte die SBTi ihre Haltung und stellte klar, dass Umweltzertifikate – einschließlich von Kohlenstoffgutschriften – nicht zum Ausgleich der Emissionen in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens verwendet werden können.
Wie die EU ihre Klimaziele durch Regulierung erreichen kann
Diese Entwicklungen haben wichtige Finanzierungen von Klimalösungen – insbesondere der CO2-Entnahme – behindert. Weder das EU-Emissionshandelssystem noch die freiwilligen Kohlenstoffmärkte der EU sind in der Lage, Technologien zur CO2-Entnahme nachhaltig zu finanzieren. Viele haben vorgeschlagen, fortschrittliche Technologien einzusetzen, um die Transparenz und Rechenschaftspflicht der Kohlenstoffmärkte zu verbessern. Doch angesichts der Komplexität der Lage und des Fehlens einheitlicher freiwilliger Standards erfordert die Ausweitung der CO2-Entnahme ein anderes Instrument: Regulierung.
Internationale Vorbilder und innovative Technologien
Ein gutes Beispiel hierfür ist Japan. Der japanische Verpflichtungsmarkt für Kohlenstoff akzeptiert inzwischen Gutschriften für Methoden zur CO2-Entnahme, einschließlich der direkten Entnahme aus der Luft und der bioenergetischen Kohlenstoffabscheidung und -speicherung. Auch der kalifornische Carbon Dioxide Removal Market Development Act könnte die breite Einführung und Nutzung dieser Technologie fördern, indem er festlegt, welche Arten von Emissionen damit ausgeglichen werden können.
Die EU sollte Unternehmen dazu verpflichten, ihre Emissionen bis zu einem bestimmten Schwellenwert zu reduzieren und „negative Emissionsgutschriften“ zu erwerben, um ihre verbleibenden Klimaauswirkungen zu kompensieren. Ebenso wichtig sind klare Regeln für die Zertifizierung von Verfahren zur CO2-Entnahme, um deren Wirksamkeit und die langfristige Speicherung zu gewährleisten und Unternehmen so Anreize für Investitionen in diese Technologien geben.
Die Zukunft der CO₂-Entnahme: Chancen und Herausforderungen
Es wurden bereits gewisse Fortschritte erzielt. Die Verabschiedung des Rahmens zur Zertifizierung von Kohlenstoffentnahmen durch die EU in diesem Jahr war ein wichtiger erster Schritt zur Regulierung dieser Technologie.
Aber es muss noch mehr getan werden. Zunächst einmal ist unklar, wie dieser neue Rahmen mit den bestehenden Vorschriften einschließlich des ETS funktionieren wird. Darüber hinaus müssen normgebende Organisationen wie die SBTi „die Emissionsminderung jenseits der Wertschöpfungskette“ – also die Bemühungen eines Unternehmens zur Verringerung der Treibhausgasemissionen außerhalb der eigenen Geschäftstätigkeit – und die CO2-Entnahme besser in die kurzfristigen Klimaziele von Unternehmen einbinden, um die regulatorische Reaktion zu unterstützen. Die EU muss die Gelegenheit nutzen, im Rahmen ihrer Vorbereitung auf die Überarbeitung des Emissionshandelssystems im Jahr 2026 eine Führungsrolle bei der Förderung dieser zentralen grünen Technologie zu übernehmen.
Copyright: Project Syndicate, 2024.