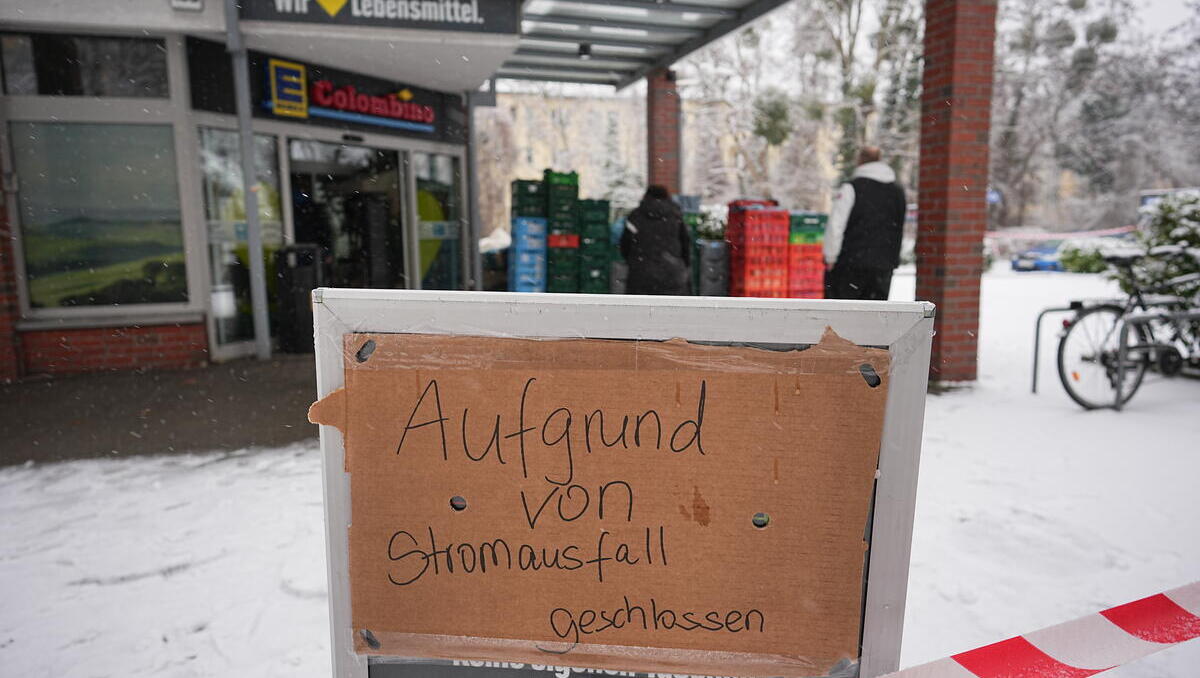Trotz schwächelnder Wirtschaft steigt der DAX – wie kann das sein?
Seit vielen Monaten kennt der deutsche Leitindex DAX, bis auf wenige Ausnahmen, nur eine Richtung: nach oben. Ungeachtet geopolitischer Krisen, hoher Zinsen, Kriegen und struktureller Schwächen in der heimischen Wirtschaft kletterte das Börsenbarometer im ersten Halbjahr 2025 nahezu unaufhaltsam von einem Rekordhoch zum nächsten. In den fünf Jahren zwischen Juni 2020 und Juni 2025 verbuchte der DAX 40 ein Kursplus von deutlich mehr als 85 Prozent – trotz Corona-Pandemie, Ukraine-Krieg, Energieknappheit, Gaza-Krieg, Rezessionssorgen und schwächelnder Wirtschaft in Deutschland, hoher Inflation, Zollkrieg und trotz des Konflikts zwischen Israel und dem Iran. Wer mitten in der Corona-Pandemie 10.000 Euro in einen DAX-ETF investiert hat, darf sich heute über ein Gesamtkapital von fast 19.000 Euro freuen. Auf den ersten Blick ist das objektiv kaum nachvollziehbar.
ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski führt für diese zunächst wenig einleuchtende DAX-Kursentwicklung zwei Gründe an. „Erstens: die meisten Unternehmen machen einen Großteil ihrer Geschäfte nicht in Deutschland, sondern im Ausland. Dort läuft die Wirtschaft besser“, sagte Brzeski Ende 2024 in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Beispielsweise spiegelten sich Zinssenkungen und Konjunkturprogramme in China im DAX wider. Zudem gingen die Märkte von weiteren Zinssenkungen in Europa und in den USA aus.
Hinzu kommt die aktuelle Schwäche der amerikanischen Wirtschaft und damit auch des US-Aktienmarktes: Während der DAX im ersten Halbjahr 2025 fast 20 Prozent an Wert gewann, rutschte der US-Leitindex Dow Jones 30 Industrial sogar um etwa ein Prozent ab. Für große Aufmerksamkeit in der Finanzwelt sorgte dann noch eine Umfrage der Bank of America unter Fondsmanagern im März. Die Umfrage zeigte, dass Investoren sich in Rekordtempo aus US-Aktien zurückziehen und in europäische und chinesische Aktien investieren. Konkret gaben 23 Prozent der Vermögensverwalter in der BoA-Umfrage an, nun in US-Aktien untergewichtet zu sein.
Amerikanische, britische und mittelöstliche Investoren entdecken deutsche Blue Chips – insbesondere in Energie-, Rüstungs- und Technologiewerten – als attraktive Alternative zu überhitzten US-Techs und profitieren vom schwächeren Euro und der Aussicht auf globales Wirtschaftswachstum. Ist die DAX-Aufwärtsbewegung folglich vor allem auf den Zustrom ausländischen Kapitals zurückzuführen? Ist der deutsche Aktienmarkt nun nicht mehr länger ein Abbild der innerdeutschen Konjunktur? Gehören deutsche Unternehmen etwa nicht mehr ... Deutschland?
Die stille Verlagerung: Wer besitzt Deutschland?
Der DAX – offiziell DAX 40 – bildet seit September 2021 die 40 größten und liquidesten börsennotierten Unternehmen Deutschlands ab. Er setzt sich aus Konzernen verschiedenster Branchen zusammen: Industrie, Technologie, Finanzen, Chemie, Konsumgüter und mehr. Unternehmen wie SAP, Siemens, Allianz, BASF oder Mercedes-Benz prägen das Bild des Frankfurter Börsenindex' maßgeblich. Der DAX gilt als Stimmungsbarometer für die deutsche Wirtschaft – auch wenn, wie gezeigt, ein Großteil der Wertschöpfung inzwischen im Ausland erfolgt. Dennoch bleibt der Leitindex ein zentrales Symbol für den wirtschaftlichen Zustand des Standorts Deutschland.
Deutschland ist eine Exportnation, die vom internationalen Kapitalverkehr lebt. Gleichzeitig ist die Bundesrepublik im internationalen Vergleich ein Land mit geringem privaten Aktienbesitz: Laut dem Deutschen Aktieninstitut (DAI), besaßen 2024 im Jahresdurchschnitt 12,1 Millionen Menschen Aktien, Aktienfonds und/oder börsengehandelte Indexfonds (ETFs) im Depot. Gemessen an der Bevölkerung ab 14 Jahren in Deutschland war den Berechnungen zufolge etwa jeder Sechste (17,2 Prozent) am Aktienmarkt engagiert. 2022 war mit fast 12,9 Millionen Aktionärinnen und Aktionären noch ein Rekordhoch erreicht worden.
Zum Vergleich: In den USA haben aktuell mehr als 60 Prozent der Erwachsenen Geld in Aktien investiert. "Von einer Anlagekultur wie etwa in den USA sind wir in Deutschland noch weit entfernt", sagt Thomas Schaufler, Privatkundenvorstand der Commerzbank. Die Folge: Ein wachsender Teil des deutschen Unternehmenskapitals liegt in ausländischer Hand. Laut einer EY-Analyse aus dem Jahr 2024 befinden sich inzwischen mehr als die Hälfte der DAX-Unternehmen mehrheitlich im Besitz internationaler Investoren. In absoluten Zahlen heißt das: 21 von 40 DAX-Konzernen haben eine ausländische Aktionärsmehrheit. Die stärksten Anteile halten Investoren aus Nordamerika (23,5 Prozent), gefolgt von Anlegern aus Europa (22,6 Prozent). Von DAX-Konzernen bis zu traditionsreichen Mittelständlern befinden sich erhebliche Teile der Unternehmensanteile in ausländischer Hand. Dabei handelt es sich nicht nur um passive Beteiligungen institutioneller Investoren, sondern in vielen Fällen um dominierende Einflussnahmen – still und leise. Die Entkopplung von wirtschaftlicher Aktivität und nationaler Kontrolle nimmt folglich zu.
Deutschland steht mit dieser Entwicklung nicht allein da, aber das Ausmaß ist vergleichsweise höher. In Frankreich etwa liegt der Anteil ausländischer Eigentümer an CAC40-Unternehmen bei rund 40 Prozent, in Italien beim FTSE MIB bei etwa 30 Prozent. In den USA wiederum ist der heimische Aktienbesitz weit verbreitet: Mehr als 60 Prozent der Erwachsenen sind direkt oder indirekt am Aktienmarkt beteiligt, vor allem über Pensionsfonds. Dadurch verbleibt ein größerer Teil der Kapitalrendite im eigenen Land. Deutschland hingegen kombiniert eine hohe Exportabhängigkeit mit vergleichsweise geringem Inlandskapital – eine strategisch heikle Kombination. Haben deutsche Unternehmen überhaupt noch Entscheidungsgewalt? Und inwiefern ist das ein Problem?
Wem gehört der DAX? Von der „Deutschland AG“ zum globalen Portfolio
Diese Entwicklung jedenfalls ist nicht neu, aber sie hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten beschleunigt. In den 1990er Jahren war die sogenannte „Deutschland AG“ noch intakt: Banken, Versicherungen, Großkonzerne und Familienunternehmen hielten sich gegenseitig Aktienpakete, stimmten sich ab und agierten im nationalen Netzwerk. Das änderte sich mit der Steuerreform 2000, die Beteiligungsverkäufe von Kapitalertragssteuern befreite. Der Dominoeffekt war gewaltig: Konzerne stießen Beteiligungen ab, Investmentfonds und institutionelle Investoren aus dem Ausland nutzten die Gelegenheit – und sicherten sich bedeutende Anteile an deutschen Leitunternehmen.
Ein Blick in die Eigentümerstrukturen zeigt, wie stark ausländisches Kapital heute vertreten ist. Der Streubesitz beim wertvollsten DAX-Konzern SAP liegt laut Unternehmensangaben bei 83,8 Prozent. Laut einer Recherche von investmentweek.com gehören zu den größten Einzelaktionären der SAP SE die US-amerikanische Investmentgesellschaft BlackRock (6,93 Prozent), die Dietmar Hopp Stiftung GmbH (5,36 Prozent) und der US-amerikanische Finanzdienstleister The Vanguard Group (4,03 Prozent). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass über 90 Prozent der SAP-Aktien im Besitz institutioneller und internationaler Investoren sind. Die größten Einzelaktionäre sind überwiegend ausländische Investmentgesellschaften.
Auch bei Henkel, Linde, Bayer, Adidas oder Mercedes-Benz liegen rund 70 bis annähernd 90 Prozent der Aktien bei Investoren außerhalb Deutschlands. Besonders auffällig: Selbst Unternehmen mit traditionell starker Verankerung in der Bundesrepublik – etwa Siemens oder die Deutsche Börse – weisen ausländische Eigentümeranteile von über 60 Prozent auf. Ein Sonderfall ist MTU Aero Engines, ein Luftfahrtzulieferer mit besonders hoher Kapitaldurchdringung aus dem Ausland – dort sind knapp 90 Prozent der Aktien im Besitz internationaler Investoren. Laut einer Analyse von EY aus dem Jahr 2024 werden nur 33,6 Prozent der DAX-Aktien von deutschen Investoren gehalten.
Wichtig: Nicht jeder Aktienbesitz bedeutet operative Kontrolle – dennoch steigt mit steigenden Anteilen der Einfluss, etwa über Stimmrechte auf Hauptversammlungen oder strategische Entscheidungen. Trotzdem kann die Eigentümerstruktur für die Entscheidungskultur innerhalb der Unternehmen problematisch sein und sie hat definitiv unmittelbare Auswirkungen auf die Kapitalströme.
Dividenden fließen ab – Kapitalrendite statt Standortbindung
Wie die Frankfurter Börse berichtet, flossen laut einer EY-Studie im Jahr 2023 von 53,8 Milliarden Euro an Dividendenausschüttungen der DAX-Konzerne über 26 Milliarden Euro ins Ausland. Demgegenüber stehen etwa 22 Milliarden Euro, die an inländische Investoren gingen. Das bedeutet, dass ein erheblicher Teil der Wertschöpfung durch deutsche Unternehmen nicht mehr bei deutschen Anlegern oder in heimischer Kapitalbindung landet, sondern international reinvestiert wird. Der Steueranteil, den diese Dividenden in Deutschland erzeugen, ist dabei gering – da viele Empfänger steuerbefreit oder in Steueroasen registriert sind. Der finanzielle Nutzen für den deutschen Staat ist damit überschaubar.
Klar, der Zufluss ausländischen Kapitals in deutsche Unternehmen stellt auch ein Vertrauensvotum in den Standort Deutschland dar. Vertreter der Wirtschaft heben hervor, dass das Engagement internationaler Investoren Ausdruck davon sei, dass deutsche Unternehmen solide, wachstumsfähig und gut geführt seien. Hinzu kommt: Viele DAX-Unternehmen erwirtschaften über 80 Prozent ihrer Umsätze im Ausland. Sie sind global aufgestellt – und ihre Investoren folgen dieser Logik. Der hohe Auslandsanteil muss also nicht nur Bedrohung sein, er kann auch als Ergebnis einer erfolgreichen Internationalisierung interpretiert werden.
Kontrollverlust durch stille Einflussnahme?
Eine Studie der weltweit agierenden Personalberatung Russel Reynolds zeigt, dass auch die Internationalisierung innerhalb der Unternehmen zugenommen hat: Der Anteil der deutschen Staatsbürger in den DAX-Vorstandsetagen ist im Jahr 2023 von 67 Prozent auf 63 Prozent gesunken. „Insgesamt ist der Trend bei den Veränderungen auf DAX-Vorstandsebene deutlich“, sagt Dr. Thomas Tomkos, Leiter der Deutschen Board & CEO Praxisgruppe von Russell Reynolds Associates. „Die DAX-Vorstände werden weiblicher, internationaler und Nachhaltigkeit ist immer häufiger Aufgabe des CEOs (...). In Summe erleben wir die größte Transformation der deutschen Vorstände seit Jahrzehnten.“
Kritiker sehen in dieser Entwicklung eine Form des sukzessiven Kontrollverlusts. Denn mit den Aktien kommen auch Stimmrechte und Einfluss auf Unternehmensentscheidungen – sei es über Hauptversammlungen, Aufsichtsräte oder strategische Leitlinien. Zwar halten viele Großanleger wie BlackRock, Vanguard oder Norges Bank ihre Beteiligungen meist passiv – doch im Hintergrund werden Geschäftsstrategien, ESG-Ziele oder Renditevorgaben zunehmend von internationalen Maßstäben geprägt. Die spezifischen Interessen des Wirtschaftsstandorts Deutschland geraten dabei schnell ins Hintertreffen. Das zeigen auch einige prominente Übernahmen mit politischem Beigeschmack:
-
Kuka (2016): Der Augsburger Roboterhersteller wurde vom chinesischen Midea-Konzern übernommen – ein Weckruf für die Bundesregierung. Die Befürchtung: Technologietransfer, Know-how-Verlust, strategische Abhängigkeit.
-
Viessmann (2023): Das hessische Familienunternehmen verkaufte seine Klimatechniksparte an den US-Konzern Carrier Global – ein Paukenschlag im Mittelstand. Trotz Arbeitsplatzgarantien und Standortzusagen bleiben Zweifel, ob zentrale Entscheidungsprozesse künftig noch in Deutschland liegen.
Auch wenn viele Investoren ihre Anteile „passiv“ halten – etwa durch Indexfonds oder ETFs –, bedeutet das nicht, dass sie keinen Einfluss nehmen. Über Stimmrechte auf Hauptversammlungen, Abstimmungsverhalten bei Nachhaltigkeitszielen (ESG) oder direkte Gespräche mit dem Management üben institutionelle Anleger regelmäßig Einfluss aus. Begriffe wie Streubesitz – also der frei handelbare Teil der Aktien eines Unternehmens – oder Family Offices – vermögensverwaltende Einheiten reicher Familien – bezeichnen Akteure, die hinter vielen Beteiligungen stehen. Die Unterscheidung zwischen Kapitalbesitz und tatsächlicher Kontrolle ist oft fließend, aber entscheidend.
Auch Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen beobachten diese Entwicklung mit Sorge. Wenn internationale Investoren kurzfristige Renditeziele über Standort- oder Beschäftigungssicherheit stellen, geraten tarifliche Absprachen, betriebliche Mitbestimmung oder langfristige Investitionen leicht unter Druck. Die Verlagerung von Entscheidungsmacht ins Ausland erschwert die direkte Einflussnahme der Arbeitnehmerseite auf strategische Unternehmensausrichtung. Vor allem im industriellen Mittelstand, wo oft noch ein enger Bezug zwischen Belegschaft und Eigentümer besteht, wird dies als zunehmender Verlust an Identität und Gestaltungsspielraum empfunden.
Politik reagiert – spät und zögerlich?
Die Bundesregierung hat mittlerweile Instrumente zur Investitionskontrolle verschärft. Über das Außenwirtschaftsgesetz kann das Bundeswirtschaftsministerium bei Übernahmen in kritischen Branchen (zum Beispiel Telekommunikation, Energie, Rüstung, Medizintechnik) prüfen und notfalls untersagen. Doch diese Prüfverfahren gelten nur für vollständige Übernahmen – Minderheitsbeteiligungen oder schrittweise Aufstockungen bleiben weitgehend unbeobachtet. Gleichzeitig sind die gesetzlichen Schwellen (zum Beispiel ab 10 Prozent Beteiligung) schwer zu kontrollieren, da Beteiligungen über verschiedene Vehikel gestreut werden können.
Die zentrale Herausforderung lautet: Wie lässt sich Kapitalbindung in Deutschland fördern, ohne ausländisches Engagement grundsätzlich abzulehnen? Einige Vorschläge:
- Stärkung der Aktienkultur: Eine höhere Beteiligung der Bevölkerung an Aktien würde die Kapitalbasis im Inland verbreitern – etwa durch staatlich geförderte Aktienrenten oder steuerliche Vorteile für Langfristanleger.
- Family Offices und Beteiligungsfonds: Nationale Investoren könnten gezielt in Schlüsselindustrien investieren – etwa über Beteiligungsgesellschaften, die mit langfristigem Fokus agieren.
- EU-weite Koordination: Gemeinsame europäische Investitionsplattformen könnten als Gegengewicht zu amerikanischen und chinesischen Investoren wirken – mit Fokus auf Standorttreue und Wertschöpfung.
- Mehr Transparenz bei Stimmrechtsausübung: Eine Offenlegungspflicht für institutionelle Investoren würde die öffentliche Debatte über Einflussnahme und Eigentum erleichtern.
Der hohe Anteil ausländischer Aktionäre an deutschen Unternehmen ist Ausdruck einer global vernetzten Wirtschaft – aber auch ein Spiegelbild der kapitalpolitischen Schwäche im Inland. Während internationale Investoren strategisch agieren und Renditen sichern, fehlt es in Deutschland oft an politischem Willen und finanzieller Kultur, um eigenes Kapital langfristig produktiv anzulegen. Die entscheidende Frage lautet also nicht: „Wie können wir ausländische Investoren fernhalten?“ Die entscheidende Frage muss lauten: „Wie sorgen wir dafür, dass deutsches Kapital in Deutschland bleibt – und gestaltet?“ Die Antwort darauf wird über die wirtschaftliche Selbstbestimmung der nächsten Generation entscheiden.
Für Anleger bleibt wichtig: Wie geht es beim DAX weiter?
Wie bereits zu Beginn dieses Artikels aufgezeigt, befindet sich der DAX seit Jahren in einem Aufwärtstrend, der lediglich durch dem Zollstreit und den Ausbruch des Israel-Iran-Kriegs Dämpfer erhielt. Doch davon konnte sich der deutsche Leitindex schnell wieder erholen. Aber kann das so weitergehen? Ende Juni hat der DAX einen stabilen Boden gebildet, der als Boden für eine mögliche Aufwärtsrally im Sommer dienen könnte. Anleger jedenfalls setzen auf eine Fortsetzung des Bullenmarktes, unterstützt durch Zinssenkungsfantasien in den USA, sinkende Renditen und positive Entwicklungen in der Handelspolitik. Trotz der Herausforderungen, wie dem drohenden Handelskonflikt zwischen den USA und der EU, steht der DAX gut da. Einige Börsenexperten sehen die Marke bei 24.000 Punkten als nächstes Ziel.
Jochen Stanzl von CMC Markets betont, dass die Rally weitergehen könne – technisch bis auf rund 26.800 Punkte, sofern keine handelspolitischen Dämpfer kommen: „Ein Anstieg bis auf 26.800 Punkte bleibt technisch ableitbar – vorausgesetzt, es treten keine handelspolitischen Rückschläge ein.“ Chancen für Anleger dürften vor allem in den exportorientierten Branchen entstehen, zum Beispiel bei Automobil-Aktien, Rüstungsaktien, und Papieren von Industriekonzernen. Der DAX bleibt attraktiv. Gerade Privatanleger sollten aber immer mögliche Risiken wie Zölle und die US-Handelspolitik im Blick behalten. Auch eine mögliche Überhitzung durch starke Kapitalzuflüsse könnten jederzeit Korrekturphasen auslösen – Experten sprechen bereits von einer „mittelfristigen Blase“.
Klar ist, dass die aktuelle Rally mehr als ein schönes Börsenphänomen ist. Sie ist ein Spiegelbild der globalen Kapitalverlagerung.