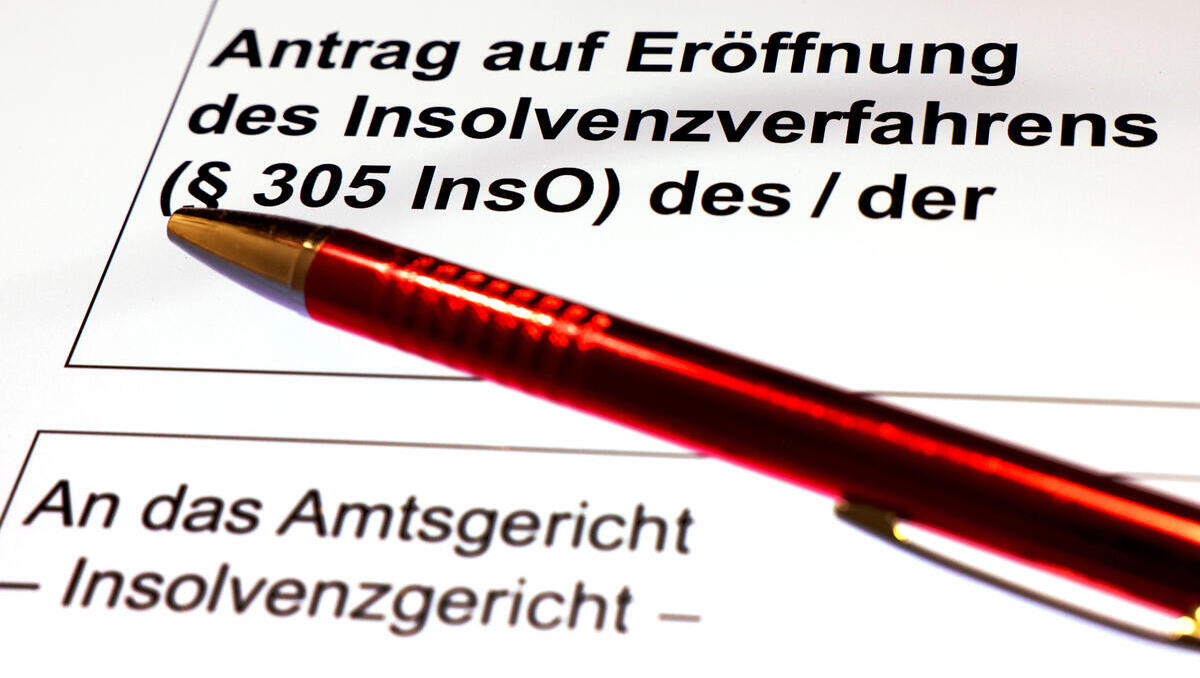Warum echte Führung auch in modernen Unternehmen nötig ist
Die Managementkultur ist im Wandel. Während früher Hierarchie und Titel den Ton angaben, setzen viele Unternehmen heute auf Gleichberechtigung und Selbstorganisation. Begriffe wie „Co-Führung“, „regenerative Leadership“ oder „strukturlose Organisation“ klingen verlockend. Doch die Realität ist oft komplizierter – und birgt Risiken, über die selten offen gesprochen wird.
Der dänische Elektroautohersteller Clever etwa verkündete stolz, sämtliche Titel in seinem 400-köpfigen Team abgeschafft zu haben. Keine Chefs, keine Manager, nur noch Rollenbeschreibungen. Der Gedanke dahinter: Mit weniger Hierarchie mehr Verantwortung und Kreativität ermöglichen. In den sozialen Medien gab es dafür viel Applaus – doch nicht alle Experten sind begeistert. Hermann Haraldsson, CEO des Online-Händlers Boozt, hält diese Entwicklung für gefährlich. Es sei „respektlos“, Titel als leere Hüllen darzustellen. Führung sei kein überholtes Konzept, sondern oft die Voraussetzung für Verlässlichkeit, Klarheit und gutes Management.
Zugegeben: Es gibt autoritäre Führung, die wenig Raum für Mitgestaltung lässt. Doch das Gegenteil – die völlige Führungslosigkeit – ist nicht automatisch fortschrittlich. Eine funktionierende Organisation braucht Orientierung, Prioritäten und klare Verantwortlichkeiten. Nicht, um zu unterdrücken – sondern um Entscheidungen treffen zu können, wenn es darauf ankommt. Wer schon einmal mit Teams gearbeitet hat, in denen alles basisdemokratisch abgestimmt wird, weiß: Lange Diskussionen ersetzen keine klare Linie. Gerade in komplexen Umfeldern – etwa im Gesundheitswesen, bei Behörden oder in Krisensituationen – muss jemand die Richtung vorgeben. Nicht jeder muss Chef sein, aber jeder muss wissen, wer entscheidet.
Titel erfüllen dabei eine wichtige Funktion. Sie sind kein Statussymbol, sondern ein Signal nach innen und außen: Wer trägt Verantwortung, wer trifft Entscheidungen, wer steht für Ergebnisse ein? Ohne diese Klarheit wird Zusammenarbeit schnell ineffizient – oder sogar unfair.
Was deutsche Unternehmen daraus lernen können
Auch in Deutschland beobachten wir den Trend zu „New Work“ und flacheren Strukturen – insbesondere im Start-up- und Kreativbereich. Doch viele Mittelständler und Industrieunternehmen fragen sich: Funktioniert das auch bei uns?
Die Antwort lautet: nur bedingt. In hochregulierten Branchen, bei Kundenprojekten mit klaren Deadlines oder in Produktionsprozessen ist Führung keine Option, sondern Notwendigkeit. Wer Hierarchie vollständig abbaut, riskiert interne Spannungen, Leistungseinbrüche und Unklarheiten bei der Verantwortlichkeit. Zudem zeigt sich in der Praxis: Wenn formelle Führung verschwindet, entstehen informelle Machtstrukturen. Wer mit wem spricht, wer sich durchsetzt, wer Einfluss hat – all das verlagert sich in undurchsichtige soziale Gefüge. Das ist nicht demokratischer, sondern oft ungerechter.
Deutsche Unternehmen sollten deshalb nicht jeden Trend unreflektiert übernehmen. Statt Titel abzuschaffen, lohnt es sich, deren Bedeutung neu zu definieren: als Rollen mit Verantwortung, Kommunikation und Orientierung. Wer so denkt, kann moderne Arbeitskultur und wirtschaftliche Stabilität miteinander verbinden.
So gelingt moderne Führung ohne Machtvakuum
1. Klarheit vor Coolness:
Titel allein sind nicht entscheidend – ihre Bedeutung schon. Unternehmen sollten genau definieren, wofür Rollen stehen: Wer trifft Entscheidungen, wer übernimmt welche Verantwortung, wer kommuniziert nach außen?
2. Führung als Dienstleistung:
Moderne Führung bedeutet nicht, alles vorzugeben – sondern Rahmen zu schaffen, in denen andere arbeiten können. Gute Führungskräfte ermöglichen, statt zu dominieren. Sie coachen, vermitteln, entscheiden im Zweifel – und übernehmen Verantwortung, wenn es schiefgeht.
3. Transparente Strukturen:
Statt alles in Teams zu verlagern, braucht es eine Balance: Selbstorganisation dort, wo sie funktioniert – und Führung dort, wo sie notwendig ist. Klare Prozesse, Feedbackkultur und definierte Eskalationswege helfen, Unsicherheit zu vermeiden.
4. Macht erkennen und benennen:
Wer Macht abbaut, sollte sich bewusst sein, dass sie nicht verschwindet. Sie verlagert sich. Informelle Strukturen entstehen immer – doch sie sind schwerer zu kontrollieren. Offenheit über Einfluss, Verantwortung und Entscheidungswege schafft Vertrauen.
5. Führung weiterentwickeln:
Führung muss sich verändern – aber nicht auflösen. Investieren Sie in Führungskräfteentwicklung, in Coaching-Formate, Mentoring-Programme und strukturelle Unterstützung. Wer gut führt, sorgt für Stabilität in einer dynamischen Welt.
Struktur ist kein Widerspruch zu Innovation
Führung wird sich weiterentwickeln – doch sie wird nicht verschwinden. Wer sie abschafft, riskiert Machtvakuum, Unsicherheit und ineffiziente Prozesse. Stattdessen sollten Unternehmen lernen, mit Hierarchie klüger umzugehen: als Werkzeug für Klarheit, Orientierung und Verantwortung. Denn am Ende gilt: Führung ist nicht der Feind – sie ist die Voraussetzung dafür, dass Menschen gemeinsam mehr erreichen können, als sie es allein je könnten.