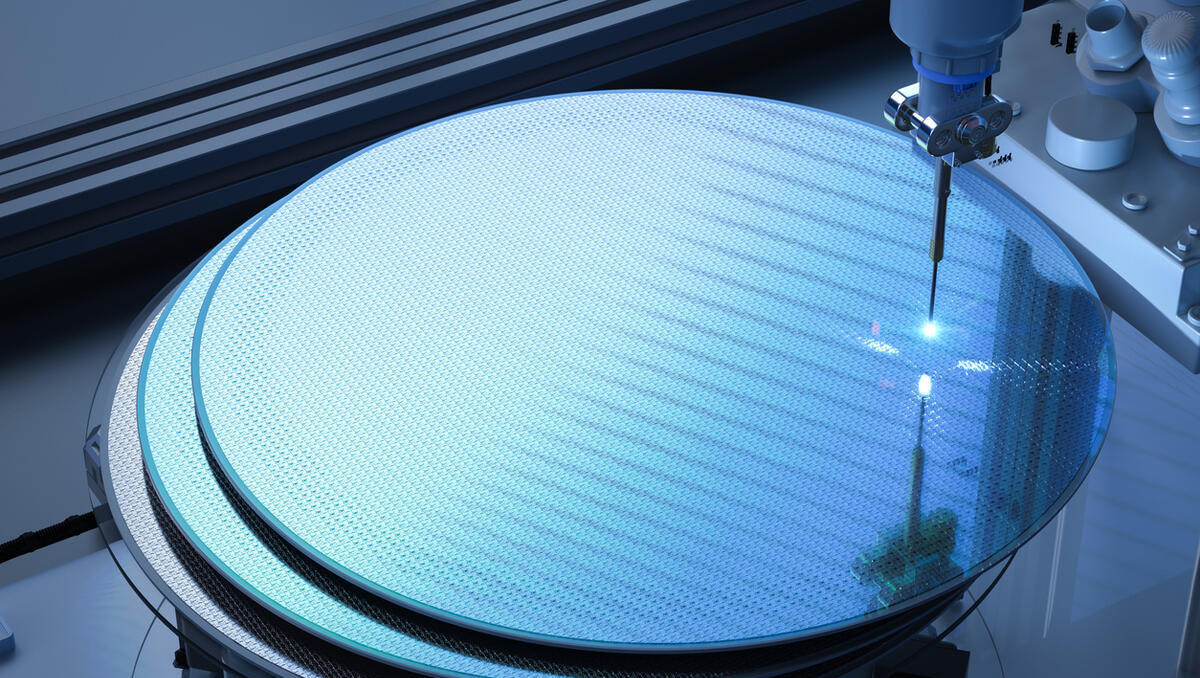Coronakrise – die Folgen
Die Weltwirtschaft befindet sich in einer Schockstarre. In Industrie- und Schwellenländern ist das soziale, aber auch wirtschaftliche Leben zunehmend lahmgelegt. Dies hat die Weltwirtschaft in der ersten Jahreshälfte 2020 unweigerlich in eine tiefe Rezession gestürzt. Auch das deutsche bzw. europäische BIP wird deutlich geringer ausfallen. Weniger klar scheint zu sein, wie tief der Einbruch sein wird, und insbesondere wie es weiter geht. Wird es einen spürbaren wirtschaftlichen Aufwind in der zweiten Jahreshälfte geben, oder verläuft der Wachstumspfad selbst mittelfristig auf einem niedrigen Niveau? Dennoch sind trotz der vielen Unsicherheiten einige entscheidende Entwicklungen mit relativer Sicherheit vorherzusagen.
Coronakrise – nachhaltige Schäden sind nicht primär in der Realwirtschaft zu erwarten
Krisen – selbst, wenn sie durch einen Schock und nicht durch strukturelle Ungleichgewichte verursacht werden – haben eine langfristige Wirkung, da sie wirtschaftliche Rahmenbedingungen, aber auch das Verhalten von Wirtschaftsakteuren beeinflussen. In Folge der großen Depression war dies die keynesianische Ausrichtung der Wirtschaftspolitik, nach der Finanz- und Eurokrise erfolgte eine Umkehr der Deregulierung. Eine sich ändernde Rolle der Notenbank oder sich nachhaltig verändernde Erwartungen von Unternehmen sind weitere Beispiele.
So bedeutet eine relativ schnelle Konjunkturerholung noch lange nicht, dass die Krise abgearbeitet ist. Auch die realwirtschaftlichen Implikationen der Finanzkrise waren relativ schnell aufgearbeitet, denn alle Länder näherten sich ihrem Vorkrisen-BIP relativ schnell an – was nicht zuletzt auf das energische Handeln der Fiskal- und Geldpolitik zurückzuführen war. Anders als bei der großen Depression hatte die Krise deshalb keine nachhaltigen Konsequenzen für die Realwirtschaft. Auch aktuell kann in Folge der fiskalischen sowie geldpolitischen Maßnahmen von einer Normalisierung der Konjunktur ausgegangen werden – auch wenn dies in Abhängigkeit von der Krisendauer vielleicht erst 2021 der Fall sein wird.
Das aktuell entschlossene Handeln der Wirtschaftspolitik verhindert eine anhaltende Depression mit entsprechenden Konsequenzen wie einer hohen Anzahl von Unternehmensinsolvenzen, struktureller Arbeitslosigkeit und Vertrauensverlust. Auch aktuell hilft die keynesianische Ausrichtung der Wirtschaftspolitik, die realwirtschaftlichen Auswirkungen der Krise einzudämmen. Und das Ausmaß der angekündigten Maßnahmen lässt eine Aussage über eine absehbare Normalität in der Realwirtschaft zu.
Andere Konsequenzen aus der Krise werden allerdings eine deutlich längere Halbwertszeit haben. So zeigen sich die Folgen der Finanzkrise bis heute in den Schuldenquoten und der Geldpolitik; Rettungsmechanismen wie der ESM gehören seitdem fest zum Werkzeugkasten der Wirtschaftspolitik. Ein weiteres Erbe der Finanzkrise ist eine kritischere Einschätzung des Marktverhaltens. Seit der Euro-Krise werden sich ausweitende Risikoprämien von Staatsanleihen oftmals als Überreaktion von Spekulanten angesehen. Der Markt als disziplinierende Institution hat seinen Einfluss größtenteils verloren. Diese Entwicklung sollte aufgrund des hohen Interventionsgrades der Notenbank auch nach dieser Krise anhalten – zumindest was die Zinsmärkte angeht.
Schuldenquoten können nur noch im Euro-Kontext gelöst werden
Unabhängig von Dauer und weiterem Verlauf der aktuellen Krise, steht eins angesichts der Heftigkeit des Einbruchs und der notwendigen fiskalischen Reaktion außer Frage: Private und vor allem staatliche Schuldenquoten werden deutlich ansteigen, Bilanzen von Notenbanken werden weiter aufgeblasen, und die Zinsen werden noch länger im negativen bzw. auf niedrigem Niveau verharren. Grundsätzlich ist bei dieser Gemengelage von einer noch bedeutenderen Rolle und einem stärkeren Einfluss der Notenbanken auf die Wirtschaft auszugehen. Hier sei betont, dass Notenbanken gerade für Krisenzeiten geschaffen wurden. Somit dürfte die EZB aktuell ihren primären Aufgaben mehr nachkommen als in stabilen Zeiten.
Mögliche Kritik am zunehmenden Einfluss des Staates – auch in Folge möglicher Verstaatlichungen – ist wenig angebracht. Eine anhaltend hohe Anzahl von Unternehmensinsolvenzen würde die Bedeutung des Staates in der Wirtschaft noch mehr stärken und die Politik nötigen, die Wirtschaft zunehmend und vollständig zu lenken – im extremen Fall könnte dies sogar das gesamte Wirtschaftssystem in Frage stellen.
Hohe Schuldenquoten führen zu anhaltender Krisenpolitik von Notenbanken und Regierungen. Viele Euro-Länder werden durch die Krise ein Niveau ihrer Schuldenquoten erreichen, von dem eine Umkehr kaum noch denkbar ist. Hierzu gehört insbesondere Italien, dessen Schuldenquote auf über 150 % der Wirtschaftsleistung ansteigen dürfte. Doch auch Spanien, Frankreich und Portugal werden kritische Höhen erreichen. Da sich die Schuldenquoten vieler Länder in Folge der Coronakrise auf deutlich über 100% des BIP ausweiten werden, ist die Schuldentragfähigkeit und auch die Handlungsfähigkeit der betroffenen Staaten zunehmend fraglich, die Schulden zu reduzieren.
Ob Euro-Lösungen wie Corona-Anleihen oder ein erweitertes ESM-Mandat die Schuldentragfähigkeit sichern sollen, oder ob das allein der EZB überlassen wird, bleibt abzuwarten. Zweifel an der Rolle der EZB als größter Gläubiger der Euro-Staaten gibt es hingegen keine. Somit wird die Coronakrise die Euro-Staaten unweigerlich zu einer ganzheitlichen Lösung und Verantwortung gegenüber ihren Staatschulden nötigen, eine Entwicklung, die bereits mit der Finanzkrise eingeleitet wurde. Die Coronakrise wird dogmatische Politikansätze wie die „no-bailout“-Klausel weiter ins Abseits drängen. Im Idealfall werden eine höhere Solidarität der Euro-Länder untereinander und damit ein höheres Maß an Integration Folgen der Krise sein.
Investitionsdynamik in der Euro-Zone auch mittelfristig unter Druck
Eine deutlich steigende private Schuldenquote und eine zurückhaltende Kreditnachfrage werden die Investitionsdynamik auf Jahre verändern. So sollte das Wachstum in der Euro-Zone auch weiterhin eher von Konsum und Exporten getrieben werden, als durch Investitionen. Bereits seit der Finanzkrise hat sich die Investitionsquote der Euro-Zone deutlich reduziert und zeigt bei weitem nicht die Dynamik der Vorkrisenjahre. Unternehmer sind eher vorsichtig, fahren auf Sicht und investieren nur, wenn sie müssen, - und nicht, nur weil sich mögliche Opportunitäten ergeben. Risikoaversion ist weiterhin die Devise. Klassische Konjunkturzyklen sind deshalb nach wie vor nicht in Sicht.
Grund für dieses Verhalten sind grundlegende Zweifel an der Nachhaltigkeit des Wirtschaftswachstums. Diese ergeben sich nicht nur durch die Erfahrungen und Erinnerungen an inzwischen drei Krisen in zwölf Jahren. Es liegt auch an den Zweifeln am Erfolg der aktuellen Krisenpolitik – insbesondere jener der EZB. Wer bereits Sorgen hatte, dass die steigenden Schuldenquoten kontra-produktiv sind und das gesamte Finanzsystem zusammenbrechen lassen werden, dessen Sorgen werden durch die Coronakrise zunehmen. Dies stärkt die Rolle des Staates als Investor, was allerdings die Wachstumsdynamik mittelfristig negativ beeinflussen könnte.
Inflationsrisiken sind nur langfristig ein mögliches Thema
Da globale Produktionsketten um einiges fragiler sind als vielfach angenommen wurde, kann die Krise zu einer weniger global ausgerichteten Produktion führen. So könnte die global starke Vernetzung einzelner Produktionsketten nachlassen. Verschiedene Dynamiken sind möglich. Dazu gehören die verstärkte Produktion vor Ort oder eine Abnahme der globalen Spezialisierung. Die Finanzkrise hat zu keiner derartigen Folgeentwicklung geführt. Im Gegenteil, die Globalisierung der Unternehmen und Produktionsstandorte hat in der deutschen Industrie noch einmal zugenommen. Dies dürfte auch so bleiben, weil China in den kommenden Jahren maßgeblicher Treiber der Weltwirtschaft bleiben wird. Dieser Markt ist allerdings nur durch Produktion vor Ort nicht ausreichend zu bedienen. Zudem hat die Erfahrung von 2019 gezeigt, dass global agierende Unternehmen durchaus stabilere Kenn-ziffern aufweisen als kleinere, die vor allem den lokalen deutschen Produktionsstandort bedienen.
Globalisierung bringt also nicht automatisch eine höhere Volatilität der Geschäftsaktivitäten mit sich. Eine Umkehr der Globalisierung und Spezialisierung ist deshalb mittelfristig eher nicht zu erwarten und würde zudem unweigerlich inflationären Druck aufbauen.
Ein Aufkaufproramm der Notenbank und eine sich damit ausweitende Notenbankbilanz werden nicht notwendigerweise zu einem zunehmenden Inflationsdruck führen. Mit dem Aufkaufprogramm erhöht die Notenbank die Liquiditätsbestände der Banken. Nur bei einer deutlichen Ausweitung der Kreditnachfrage in der Realwirtshaft oder einer Umschichtung von Anlagevermögen in eine höhere Güternachfrage würde Preisdruck entstehen.
Inflationssorgen wären nur bei einem breit angelegten Einsatz von Helikoptergeld zu erwarten. Denn nur dann würde die Geldmenge in der Realwirtschaft ansteigen und Preisdruck verursachen – vor allem wenn die Krise, wie es aktuell der Fall ist, aufgrund unterbrochener Lieferketten und eines erzwungenen Shut-Down auf der Angebotsseite der Wirtschaft ausgelöst wurde. Finanziert die EZB zunehmend Konjunkturprogramme der europäischen Staaten, könnte dies ebenfalls inflationär wirken, weil der Staat in die Lage versetzt wird, eine höhere effektive Nachfrage sicherzustellen. Allerdings war in den letzten Jahren die Nachfrage eher nicht ausreichend.
Implikationen für die Märkte – Besitz von realen Werten weiterhin überzeugend
Goldpreis: Die IKB hat in früheren Studien gezeigt, dass der US$-Goldpreis hauptsächlich von US-Inflation, US-Renditen sowie US$-Devisenkurs beeinflusst wird. Vor allem aufgrund der Entwicklung der US-Renditen ist mittelfristig von einem soliden Goldpreis auszugehen. Auch wenn der Goldpreis in Folge der Krisenbewältigung und einer Risikoneubewertung unter Druck kommen sollte, der mittel- bis langfristige Ausblick bleibt positiv, da die Entwicklung der Staatschulden und die Notenbankpolitik Renditen noch auf absehbarer Zeit unter Druck halten werden.
DAX: Der realwirtschaftliche Schaden bleibt aktuell schwer einzuschätzen. Dennoch ist von einer relativ schnellen Erholung aufgrund der angekündigten Stützungsmaßnahmen auszugehen. Notenbanken bleiben hingegen auf absehbare Zeit im Krisenmodus. Konjunkturelle Stabilisierung und anhaltende EZB-Krisenpolitik unterstützen die Entwicklung des DAX.
Immobilien: In Deutschland ist der seit Jahren anhaltende Immobilienboom eine Konsequenz aus der Finanzkrise – damit hat eindeutig eine Vermögensverteilung der Geldpolitik zulasten unterer Einkommensschichten stattgefunden. Aktuell wird viel spekuliert, ob die Coronakrise für eine Gegenbewegung sorgt. Mittelfristig ist das Bild klarer: Der Immobilienmarkt erhält weiterhin Unterstützung durch die EZB-Geldpolitik.
Fazit: Aktuell herrscht viel Unsicherheit über die Auswirkung der Coronakrise auf die deutsche Wirtschaft. Doch es gibt eine Reihe von Konsequenzen, die vorhersehbar sind. Erfahrungen aus der Finanzkrise 2008/09 deuten auf ein mittelfristig verhaltenes Investitionsverhalten hin, während eine Umkehr der Globalisierung und eine steigende Inflation eher unwahrscheinlich sind.
Schaut man über den aktuellen Schock hinweg, bekommt Europa weniger ein realwirtschaftliches als ein Schuldenproblem. Anders als nach der Finanzkrise werden die staatlichen Schuldenquoten vieler Euro-Ländern derart hoch ausfallen, dass ein “Weiter so“ und das Festhalten an Prinzipien keine Option mehr ist. Diese Folgekrise und einen möglichen Euro-Zerfall zu verhindern, wird Aufgabe der EZB sein, aber auch Europas. Dies wird eine langfristige Veränderung der Beziehungen der Euro-Länder zueinander mit sich bringen und die Rolle der EZB ist neu zu definieren. Hierdurch kann sich allerdings auch eine Chance für die Euro-Zone ergeben, entscheidende gemeinsame Schritte zu gehen.