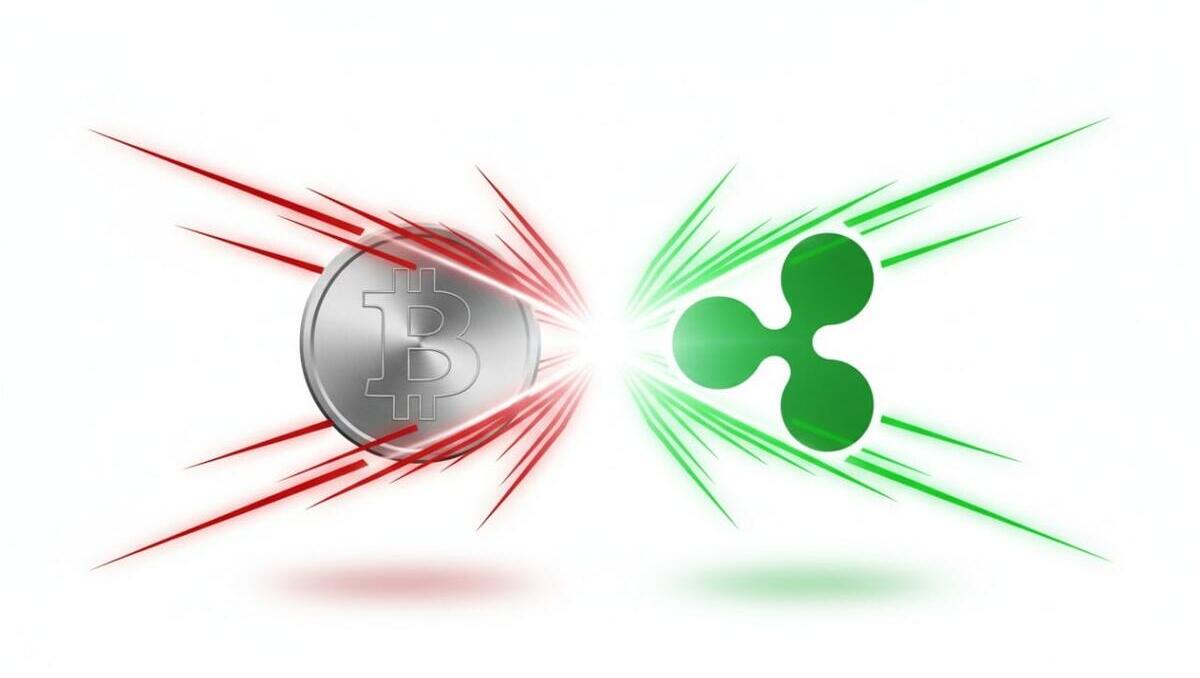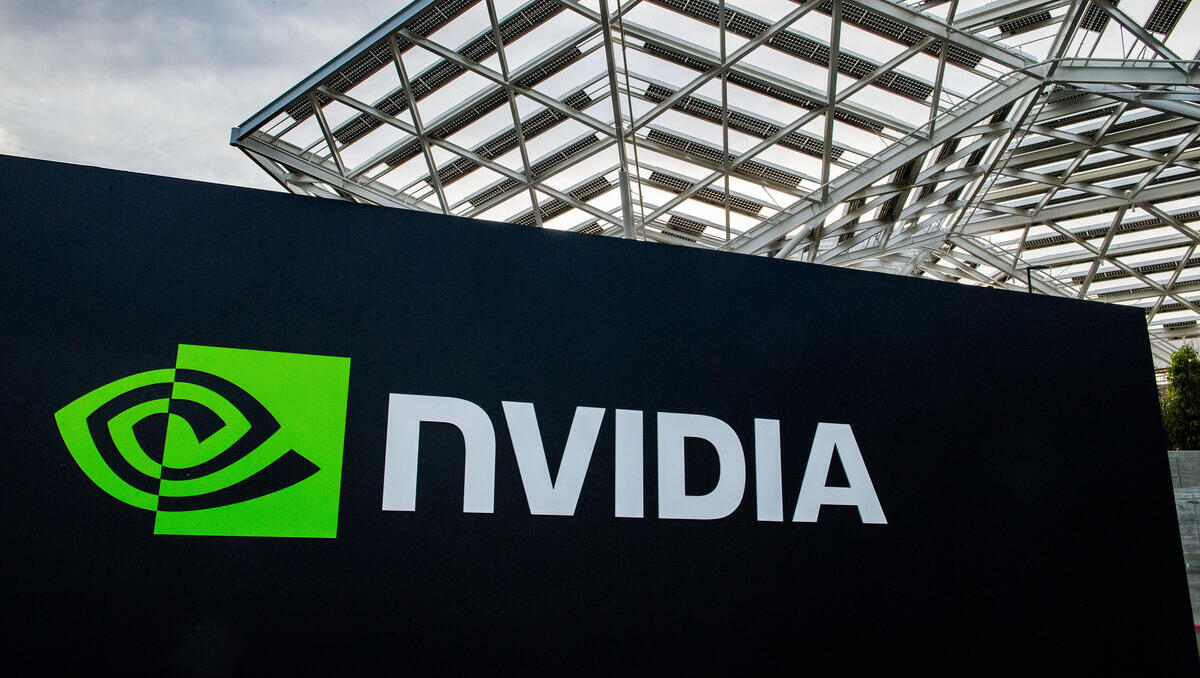In Deutschland nähert sich die Zahl der Corona-Toten der 100.000-Marke. Weltweit sind schon über fünf Millionen Menschen an oder mit Covid-19 verstorben. Diese Zahlen sind gewiss nur ein Bruchteil der einst sechsstelligen Opferzahlen schwerer Pandemien wie der Schwarzen Pest im Mittelalter oder der Spanischen Grippe. Aber gemessen am heutigen medizinischen und kulturellen Standard sind sie doch schockierend hoch, und man weiß ja noch nicht, wie es weitergehen wird. Insofern kann man sich an das mittelalterliche Motiv des Totentanzes erinnert sehen: Der Tod tanzt quer durchs moderne und postmoderne Leben.
Dieser brutale Tanz kommt der gesellschaftlichen Todestabuisierung in die Quere. Die industrialisierte und technisierte Kultur lebt weithin in einem strukturellen Verblendungszusammenhang, nämlich im Glauben an steten Fortschritt, ja an notwendiges, dem homo sapiens gemäßes Wachstum. Zu solchem Erfolgs- und Optimierungsdenken passt die Erfahrung des Todes schwerlich; sie ist jedes Mal aufs Neue demütigend - und dies besonders im Falle einer vielfach tödlichen Pandemie. Diese hat hinter die ideologisch anmutende Wachstums- und Kontrollierbarkeitsperspektive ein großes Fragezeichen gesetzt. Damit trägt sie bei zu einem zunehmenden globalen Krisenbewusstsein. Apokalyptische Befürchtungen sprießen auch unabhängig von religiösen Kontexten empor.
Das Motiv des Totentanzes war um die Mitte des 14. Jahrhunderts aufgekommen, als eine Pestwelle durch Europa zog. Anschaulich begann man den Tod als Knochengerippe abzubilden. Und so entstand der „Totentanz“ als eigene Kunst- und Literaturgattung. Dargestellt wurden Leute jeden Standes und Alters, wie sie einen Reigen mit dem Tod oder mit einem Skelett tanzen. Das Makabre, ja Obszöne entsprechender Bilder bestand in der Verbindung von tragischen und fröhlichen Motiven. In gewisser Weise passt das auch zu unserer pandemisch verstörten und doch digital in heiterer Stimmung verharrenden Gesellschaft. Der religiös tröstende Horizont von einst ist heute gutenteils ausgetauscht durch eine neuartige digitale Religion, was die Bücher „Google Unser“ von Christian Hoffmeister oder „Die Anbetung“ von Marie-Luise Wolff nachweisen. Doch wie weit reicht der durch Cyber-Attacken zeitnah und durch Vergänglichkeit auf Dauer allzu poröse Trost technologischer Welten?
Und was war umgekehrt das tröstende Element in den mittelalterlichen Totentanz-Motiven? Dass der Tod hier als handelnde Person auftritt, lässt ihn letztlich als gehorsamen Diener Gottes erscheinen, vor dessen Richterstuhl er den Sterbenden zu befördern hat. Jedermann muss „nach seiner Pfeife tanzen“, aber er selbst hat seinerseits einen Herrn über sich, auf den man folglich hoffen darf. So heißt es in einem „Schnitterlied, gesungen zu Regensburg, da eine hochadelige Blume unversehens abgebrochen wurde im Jenner 1637“: „Es ist ein Schnitter, heißt der Tod, hat Gwalt vom großen Gott.“ Der sinnlos wütende Tod – doch nicht einfach ohne letzten Sinn, ohne eine abgrundtiefe Hoffnung?
Totenskelette hatten keinen letzten Schrecken, weil der Tod nicht als radikales Ende, sondern religiös als vorläufige Macht verstanden wurde. Eine Tabuisierung des Todes war daher im Spätmittelalter nicht notwendig. Man konnte sozusagen mit dem Tod leben, ohne dass er beschönigt werden musste. Bei aller Grausamkeit sah man etwas Spielerisches an ihm, das sich im Motiv des Tanzes ausdrücken ließ. Eben nicht nur als Schnitter, sondern auch als Spielmann mit Laute, Dudelsack oder Bassgeige figurierte man ihn. Denn über sein Walten hinaus konnte man auf das Walten dessen blicken, der Auferstehung vom Tod und ewiges Leben verheißt, ja schon im Glauben anheben lässt. Der Ernst des Todes und das Element des Humors bildeten insofern keinen krassen Widerspruch. Die mahnenden Totentanz-Bilder wurden in der Regel durch dichterische Verse erläutert, die von innerer Heiterkeit zeugten. So hieß es beim Tod einer Tänzerin: „Nun haben wir so lang getanzt, Bis mich der Tod hat eingeschanzt.“ Oder beim Hingang eines Soldaten: „Bis hierher und nicht weiter, Du guter alter Streiter!“ Der makabre Tanz in den Tod war und blieb ein eindrückliches Bild.
Dabei ging es in den Totentanz-Motiven des Spätmittelalters bis hinein in die Anfänge der Neuzeit keineswegs nur um eine ars moriendi, eine „Kunst des Sterbens“, die erst auf dem Sterbebett zum Zuge kam, sondern um eine mitten im Leben greifende, weisheitliche Vergegenwärtigung der Sterblichkeit. Religiös fundiert, plädierten sie für Lebenskunst statt für Sterbekunst. Unübersehbar stellten sie die Hinfälligkeit und Vergänglichkeit des eitlen Strebens nach menschlicher Pracht und deren Sicherung heraus. Möglich war das nur dank der christlichen Hoffnung auf das ohne Ansehen der Person in Aussicht stehende Geschenk künftiger Auferstehungsherrlichkeit und das Jüngste Gericht, vor dem der Gleichheitsgrundsatz in gewisser Hinsicht wiederhergestellt sein würde.
Mit dem Anbruch der Neuzeit und dem Durchbruch der Aufklärung begann diese Hoffnung zu schwinden. Zunehmend wurde sie transformiert in eine innerweltliche Hoffnung. Aus dem neuen Äon des verheißenen Gottesreiches wurde die Neu-Zeit des „mündig“ gewordenen, autonom seine Zukunft gestaltenden Menschen. Der biblische Glaube an die Heilsgeschichte wurde säkularisiert zum immanenten Fortschrittsglauben. Menschliches Glücks- und Herrlichkeitsstreben gerieten damit freilich mehr und mehr unter den Bann radikaler Vergänglichkeit – und damit unter den Zwang zur „Zerstreuung“! Der Mathematiker Blaise Pascal erkannte schon um den Beginn der Neuzeit: „Da die Menschen kein Heilmittel gegen den Tod, das Elend, die Unwissenheit finden konnten, sind sie, um sich glücklich zu machen, darauf verfallen, nicht daran zu denken.“ Der zunehmende Bedeutungsverlust christlicher Heilshoffnung führte dazu, dass man den Tod immer weniger aushalten konnte. Die Erinnerung ans Sterbenmüssen passte nicht mehr ins Schema innerweltlicher Selbstoptimierung. Man musste den Tod deshalb aus dem Wirklichkeitskonzept der Moderne herausdrängen: Ihr sollte er möglichst nicht mehr oder allenfalls unauffällig dazwischen tanzen.
Das gesellschaftliche Todestabu nahm seinen entscheidenden Aufschwung zu einer Zeit, als die Rede vom „Tod Gottes“ aufkam. Und als im 20. Jahrhundert der Tod in zwei Weltkriegen wie in schlimmsten Epidemien zuschlug, da war das Motiv vom Totentanz kein passendes mehr – mochte auch in dem Roman „Hunde, wollt ihr ewig leben?“ von Fritz Wösse von „einer Orgie millionenfachen Totentanzes“ die Rede sein. Es war vor allem die bildende Kunst, die den Totentanz für die späte Moderne wiederentdeckte.
Das Interesse an diesem makabren Motiv hat dann um den Jahrtausendwechsel herum noch einmal zugenommen – zusammen mit einer Tendenz zu wiedererwachender Spiritualität und Religiosität. Aber diese Welle ist wieder abgeebbt, seit die digitale Revolution sich anmaßte, selbst den Sieg über den Tod technisch bewältigen zu können. Bis 2045 soll es einigen Realutopisten zufolge bereits soweit sein, dass menschliches Bewusstsein auf Maschinen übertragen werden und so den Tod überdauern kann – zumindest für Reiche, die sich so etwas leisten können. Vielleicht werden es dann die Ärmeren sein, die sich mit der Erkenntnis jener Wahrheit trösten, die schon in der Bibel zu lesen und von der Naturwissenschaft längst bestätigt ist: Himmel und Erde werden vergehen – mithin auch alle menschengemachte Technik. Echte Unsterblichkeit und Auferstehung sind logischerweise allein vom Schöpfer und Vollender des Universums zu erwarten. Nur dort, wo man nach wie vor auf ihn vertraut, kann man dem Tod mit einer gewissen Heiterkeit begegnen – und es auch aushalten, ihn inmitten der Pandemie im Tanzschritt aufwarten zu sehen. Der Tod hat nicht das letzte Wort: Ein neues Lied zu singen verheißt das letzte Buch der Heiligen Schrift den Hoffenden. Den Rhythmus des Totentanzes trägt die Melodie eines Gegentanzes, der die Zyklik natürlicher Vergänglichkeit durchbricht. Christenmenschen kommen von der Auferstehung Jesu her und können im Blick auf die verheißene Erlösung mit Psalm 126 formulieren: Dann „werden wir sein wie die Träumenden, dann wird unser Mund voll Lachens und unsre Zunge voll Rühmens sein“. Gewiss, noch hat der Tod Gewalt, vielleicht bald noch viel mehr als in der bisherigen Menschheitsgeschichte! Doch es gibt inmitten dieser vergänglichen Welt seit bald zweitausend Jahren eine Perspektive des Sieges über den Tod. Sie fordert auch die Zweifler von heute auf, der Musik des Totentanzes zu lauschen und darin einen nicht nur todeswütigen, sondern zugleich hoffnungsmutigen Rhythmus zu entdecken, der auf positive Weise ansteckend sein könnte.
Das 20. Buch von Werner Thiede ist hochaktuell, denn die Pandemie hat die uralte Frage nach Tod und Unsterblichkeit verstärkt virulent werden lassen. Mit Macht drängt die Wahrheit sich wieder ins Bewusstsein: Wäre mit dem Tod alles aus, stünde es erbärmlich um den Sinn des Lebens und der Welt. So sicher aber der Tod als Lebensende ist, so unsicher bleibt es, ob es nicht doch jenseits dieser Grenzlinie weitergeht. Vom Ob und Wie hängt unendlich viel ab. Werner Thiede hat sich viele Jahre mit der Frage nach einem Leben über den Tod hinaus wissenschaftlich und publizistisch befasst. Als apl. Professor für Systematische Theologie (Universität Erlangen-Nürnberg) und einstiger Mitarbeiter der Evangelischen Zen-tralstelle für Weltanschauungsfragen bezieht er in seinem neuesten Werk auf 270 Seiten auch Parapsychologie, Esoterik und Nahtod-Forschung intensiv mit ein. Spannende Forschungsresultate werden präsentiert, evangelische wie katholische Denkmodelle vorgestellt und gedanklich geprüft. Thiede plädiert mit überzeugenden Argumenten für eine ganzheitlich ausgerichtete, die Seelenunsterblichkeit bejahende Auferstehungshoffnung.
„Das neue Buch von Werner Thiede leistet eine seltene, überaus geglückte Verbindung von Aktualität und Tiefe.“ Prof. Dr. Harald Seubert (ideaSpezial)
Für 24.90 € bestellbar beim Verlag vertrieb@lit-verlag.de oder im Buchhandel mit der ISBN 978-3-643-14878-0 (E-book: 978-3-643-34878-4).
www.werner-thiede.de