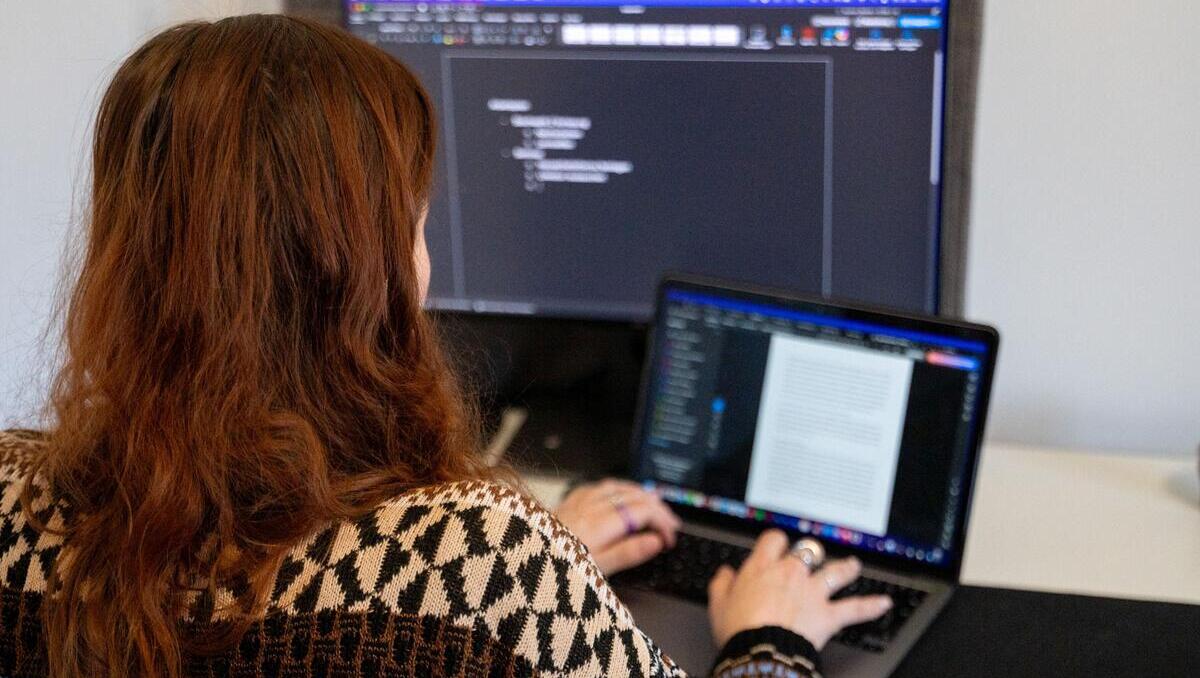Die globale Konjunktur ist seit anderthalb Jahren von einer deutlichen Erholung gekennzeichnet, die mit dem Abflauen der Pandemie sowie der gegen sie gerichteten Maßnahmen immer rascher voranschreiten sollte. Das ist die gute Nachricht.
Die schlechte lautet: Es lassen sich immer mehr klassische Anzeichen für eine spätzyklische Entwicklung erkennen, das heißt, für eine massive Inflationsbeschleunigung, für einen steilen Anstieg der Rohstoff- und Energiepreise, für von Personalmangel gebeutelte Arbeitsmärkte sowie für erhebliche, die Teuerung anheizende Lohnzuwächse. Dies alles angesichts einer völligen Inaktivität oder doch nur sehr langsamen Reaktion der wichtigen Notenbanken, gekoppelt mit anhaltender Fiskalexpansion, das heißt massiven staatlichen Ausgaben.
Bevor wir mit der Analyse beginnen, nochmal ein Rückblick auf den Wirtschaftseinbruch von 2020: Er konzentrierte sich auf zwei Quartale, das erste und vor allem das zweite, als praktisch weltweit ein Lockdown herrschte. Verstärkt wurde der Abschwung durch den Umstand, dass eine Finanzblase bei amerikanischen Großbanken im Herbst 2019 die geldpolitischen Bedingungen in den Vereinigten Staaten verschärft und eine Rettungsaktion des Fed notwendig gemacht hatte. Doch im Wesentlichen waren es der Coronavirus-Ausbruch und der daraufhin verhängte Lockdown, die die Rezession in Gang setzten.
Diese machte vor allem denjenigen Branchen zu schaffen, die von zyklischen Abschwüngen für gewöhnlich nicht so stark betroffen sind, es von der Coronakrise aber umso mehr waren: Der Luftfahrt und den anderen Transportbranchen, dem Tourismus, der Gastronomie, dem Einzelhandel sowie Freizeit-Dienstleistungen wie Kultur und Sport. Sie dürften von der Aufhebung der Corona-Maßnahmen, die jetzt weltweit erstaunlich rasch in die Wege geleitet werden, in hohem Maße profitieren. Auch die Autoverkäufe, die nach dem Corona-bedingten Einbruch durch den weltweiten Chipmangel ein zweites Mal stark zurückgeworfen wurden, dürften wieder anziehen.
Damit dürfte, wie schon gesagt, eine neue Phase der Konjunkturbeschleunigung vor der Tür stehen, wobei sich folgende Frage stellt: Für wie lange und mit welchem Ausgang? Ich meine: Viele Vorhersagen sind falsch, denn was die meisten Konjunkturbeobachter nicht in ihre Prognosen miteinbeziehen, ist die massive Beschleunigung der Inflation. In mehreren Artikeln habe ich bereits darauf hingewiesen, dass die Art und Weise, wie die Corona(wirtschafts)politik betrieben wird, zu einer massiven und lang anhaltenden Inflationsbeschleunigung führen wird. Wiederholte Lockdowns, Quarantäne, soziale Distanzierung, Home Office, Maskenpflicht, und das alles gekoppelt mit einer extrem expansiven Finanz- und Geldpolitik: Sie führen zu einer Übernachfrage nach Wohnraum und Elektronik (Chips), zu Lieferschwierigkeiten und zu einem geänderten Preissetzungs-Verhalten der Unternehmen.
Inflation: Das statistische Bild
Um die Größenordnung etwas klarer zu machen, seien hier die Inflationsraten für Deutschland, für die Eurozone (EZ-19) und für die USA dargestellt. Dies geschieht anhand der Verbraucherpreise seit 1960 (DE, USA) respektive seit 1997 (EZ-19). Die Graphik verdeutlicht, dass 2021 im Jahresverlauf die Inflationsrate explosionsartig angestiegen ist, und zwar auf die höchsten Niveaus seit den frühen 1980er Jahren in den USA (7,1 Prozent / im Januar 2022 waren es gar 7,5 Prozent), den 1990er Jahren in Deutschland (5,3 Prozent) sowie seit Einführung des Euro im Jahr 2002 (5,0 Prozent). Nur wenige Male in der Nachkriegszeit hat die Inflationsrate höher gelegen als heute.
Bei solchen Langfrist-Vergleichen muss hinzugefügt werden, dass die Berechnungsweise der Verbraucherpreis-Indizes durch methodische Korrekturen verändert worden ist. Das heißt, seit Ende der 1990er Jahre dürfte die tatsächliche Inflation um rund einen Prozentpunkt pro Jahr höher liegen als angegeben. Das ist in dieser Graphik für die USA und für Deutschland im Langfrist-Vergleich bedeutungsvoll. In Sachen USA ist ferner zu berücksichtigen, dass die Fed um die Jahrtausendwende zusätzlich vom Verbraucherpreisindex zum Deflator des privaten Konsums als Indikator gewechselt hat. Dieser liegt gewöhnlich tiefer als der Verbraucherpreis-Index. Dessen Dezember-Wert, der noch nicht publiziert ist, dürfte 5,9 oder 6,0 Prozent erreichen. In der Eurozone wird darüber hinaus auch über 20 Jahre nach der Einführung des Euro die wichtigste Ausgabenposition der Haushalte, nämlich die Kosten selbst bewohnten Wohneigentums, im offiziellen Preisindex HVIP weggelassen. Nicht, dass dieser Mangel einfach zu beheben wäre, im Gegenteil. Für außenstehende Beobachter sind aber keinerlei ernsthafte Anstrengungen zu erkennen, den Mangel zu beseitigen. Zusammenfassend lässt sich sagen: Die hier angegebenen Inflationsraten sind tendenziell eher zu niedrig, die wahren viel höher. Die Inflation lässt sich also nicht aus der Welt reden.
Genau das tun aber die Notenbanken unablässig. Es beginnt mit der Zielformulierung: Rituell, als ob es eine Selbstverständlichkeit wäre, heißt es stets, die Preisstabilität sei erreicht, wenn die Teuerung gemessen am Verbraucherpreisindex leicht unter zwei Prozent betrage. Die ersten knapp zwei Prozent Inflation sind also gleich mal hergeschenkt. Das wurde von den führenden Notenbanken um die Jahrtausendwende eingeführt, zeitlich kurz nach der Revision der Preisstatistiken, welche die Inflation um rund ein Prozent niedriger erscheinen lässt, als es tatsächlich der Fall ist, sowie im Fall der Fed mit dem Wechsel vom Verbraucherpreis-Index zum Konsum-Deflator. So betrachtet läge die derzeitige Teuerung in den USA „nur“ bei 5,1 Prozent, in Deutschland nur bei 3,3 Prozent und in Europa „nur“ bei 3,0 Prozent (also jeweils zwei Prozent niedriger als der tatsächliche Wert). Die Begründung für diese willkürliche Festlegung des Inflationsziels: Ein Inflationsziel zu nahe an der Null-Prozent Barriere würde die Wirksamkeit der Geldpolitik bei sehr niedrigen Inflationsraten einschränken. Im Endeffekt hat das erhöhte zwei-Prozent Inflationsziel die EZB und die anderen Notenbanken jedoch nicht nur nicht daran gehindert, über Jahre stark negative Zinsen am Geldmarkt zu implementieren und darüber hinaus mit den umfangreichen Anleihens-Kaufprogrammen auf die ganze Zinskurve auszudehnen, sondern sie geradezu dazu ermutigt. Und die Fed hat die längste Periode der Geschichte mit Nullzinsen operiert.
Der Tonfall der Notenbankiers bis vor kurzem (Fed) respektive bis heute (EZB): Der Anstieg der Inflation sei nur vorübergehend und speziellen Faktoren wie der aufgestauten Nachfrage nach den Lockdowns oder Lieferengpässen zuzuschreiben.
Aber: Fakt ist, wie aus der Graphik hervorgeht, dass das Jahr 2021 den schnellsten und steilsten Inflations-Anstieg der Nachkriegszeit darstellt. So etwas sollte man keineswegs auf die leichte Schulter nehmen. Aus der Graphik geht ferner hervor, dass der Anstieg weltweit geschieht, und zwar ziemlich gleichmäßig. Im Vergleich zu den 1970er Jahren ist der Unterschied augenfällig: Dort gab es gewichtige Differenzen zwischen dem Verlauf in Deutschland und den Vereinigten Staaten.
Analysiert man die Inflationsstatistiken im Detail, so fällt einerseits auf, wie breit die Inflation abgestützt ist. Die monatlichen Veränderungen sind anhaltend hoch. Die großen Komponenten wie Wohnraum, Mieten und Nahrungsmittel zeigen eine hohe Teuerung. Darüber hinaus ragt eine Komponente noch zusätzlich heraus, nämlich die Verteuerung der Energie, sowohl von Benzin und Heizöl wie von Strom.
Um das Ganze noch etwas deutlicher zu machen, seien hier die Produzentenpreise für die USA und für Deutschland kurz aufgeführt. Die Produzentenpreise für Industriegüter in den USA haben lediglich drei Mal in den Jahrzehnten seit 1960 die gleiche oder eine leicht höhere Wachstumsrate gegenüber dem Vorjahr erreicht als in der zweiten Jahreshälfte 2021. In jedem Monat von Juli bis Dezember 2021 lag die Teuerung gegenüber dem Vorjahr (blaue Kurve) über 20 Prozent, bei den verarbeiteten Gütern (rote Kurve) bei 15 Prozent oder höher.
Es handelt sich aber keineswegs nur um ein Phänomen von Produzentenpreisen für Güter. Indikatoren für die Produzentenpreise für Dienstleistungen - die es übrigens erst seit 2006 gibt - zeigen, dass insbesondere in den Bereichen Transport und Logistik (grüne Kurve) sowie Groß- und Einzelhandel (rote Kurve) solide zweistellige Inflationsraten erreicht werden. Alle anderen Dienstleistungen (blaue Kurve) haben leicht erhöhte Inflationsraten, sind aber noch weit von zehn Prozent entfernt. Sie dürften aber, sobald die Restriktionen, Kontaktsperren und Lockdowns aufgehoben werden und die Kunden deshalb wieder zurückkommen können, ebenfalls anziehen, weil die Unternehmen ihre gestiegenen Kosten auf die Kunden abwälzen.
Für Deutschland ergibt sich plus minus das gleiche Bild wie für die Vereinigten Staaten, nur bei etwas höheren Zahlen. So liegen die Produzentenpreise für gewerbliche Güter im Dezember 2021 24,2 Prozent über dem Vorjahresstand, so hoch wie noch nie seit Mitte der 1970er Jahre. Schlüsselt man die Statistik auf, so überragt der Energiepreisanstieg alle anderen Komponenten. Ohne den Faktor Energie hätte der Anstieg immer noch respektable 10,4 Prozent betragen.
LESEN SIE MORGEN DEN ZWEITEN TEIL DER ANALYSE VON MICHAEL BERNEGGER:
- Wie unsere Politik dafür gesorgt hat, dass die Preise durch die Decke gehen
- Wie die USA durch ihre Sanktionen sich selbst und Europa in die Falle gelockt haben
- Wie Russland und China frohlocken