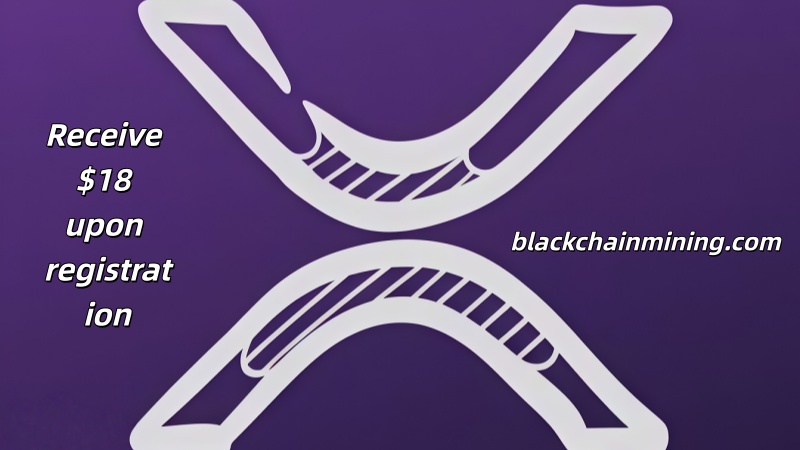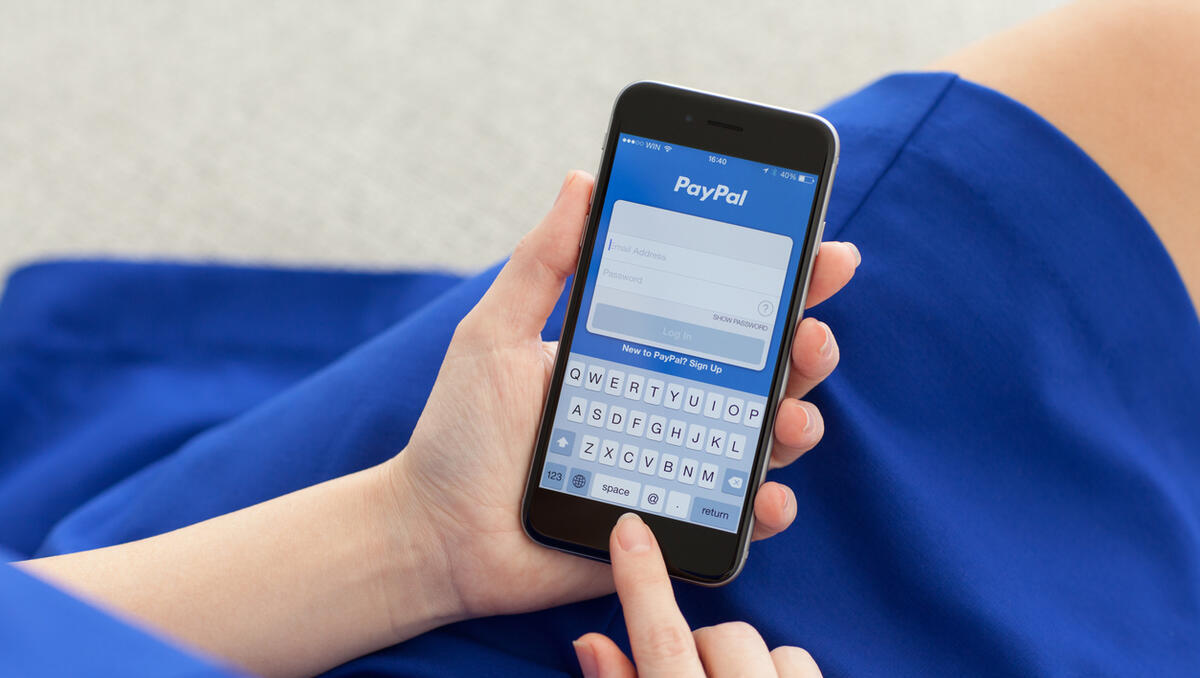In Money and Empire erinnert Perry Mehrling von der Boston University an den bemerkenswerten Moment im Jahr 1965, als der US-Kongress den internationalen Geldökonomen und Historiker Charles P. Kindleberger vom MIT (Massachusetts Institute of Technology) vorlud, um zum beängstigend hohen Zahlungsbilanzdefizit des Landes auszusagen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten die Vereinigten Staaten durchweg mehr exportiert als importiert. 1965 war es aber umgekehrt: Die US-Inlandsmärkte wurden von westdeutschen Waren überschwemmt, und bald sollten die Importe aus Japan folgen.
Während die Dollars nach Übersee strömten, um für diese Importe zu bezahlen, fragten sich viele, ob es vielleicht an der Zeit sei, das internationale Bretton-Woods-Währungssystem der Nachkriegszeit zu reformieren, das den US-Dollar fest an den Goldpreis koppelte – und andere Währungen auf flexiblere Weise an den Dollar.
Kindleberger war dagegen: Seiner Meinung nach konnte die Finanzierung des US-Handels und die Sicherung des dominanten internationalen Dollarstatus durch ein Bündnis von Zentralbanken unter der Leitung der US-Federal-Reserve gewährleistet werden. „Viele meiner Kollegen fürchten sich vor dem Gedanken, eine Zusammenarbeit der Zentralbanker könnte die [nationale] wirtschaftliche Souveränität usw. verdrängen“, meinte er damals. Aber Zentralbanker seien „Techniker“, „und dies ist die Art von Problem, mit der sie leicht fertig werden“.
Rückblickend ist Kindlebergers Kommentar erstaunlich – angesichts der Tatsache, dass die Zentralbanken seitdem die Wirtschaftspolitik entscheidend bestimmen. Auf den Zinsschock Paul Volckers, des Fed-Vorsitzenden von 1979-82, der der hohen Inflation der 1970er ein Ende bereitete, folgte ein Jahrzehnt später der ideologische und politische Triumph der „Unabhängigkeit der Zentralbank“ – während der neue Fed-Vorsitzende Alan Greenspan so etwas wie ein Volksheld der Finanzindustrie wurde.
Im Zuge der globalen Finanzkrise von 2008 übernahmen die Zentralbanken erneut das Steuer: Unter Ben Bernanke weitete die Fed die „Swaplinien“ der Dollarkredite weltweit auf andere Zentralbanken aus, und diesen folgten bald „unkonventionelle“ geldpolitische Maßnahmen wie die sogenannte Quantitative Lockerung – Wertpapierkäufe im Wert von Billionen Dollar über mehr als ein Jahrzehnt hinweg. Und 2012 wurde Mario Draghi, der Präsident der Europäischen Zentralbank, mit seinem Versprechen berühmt, zu tun, „was immer nötig ist“, um das Überleben des Euro zu sichern.
All diese unkonventionellen und außerordentlichen Maßnahmen erwiesen sich aber lediglich als Generalprobe: Als COVID-19 zuschlug, stellten die Zentralbanken noch mehr Liquidität zur Verfügung, und die meisten Regierungen öffneten ihre fiskalen Füllhörner bis zum Anschlag. Aber dann kam der Inflationsschub von 2021, und plötzlich mussten die geldpolitischen Behörden wieder zu einer Preisstabilisierung à la Volcker übergehen.
Die MIT-Verbindungen
Weder Kindleberger noch jemand anderes konnte all dies kommen sehen. 1965 war die Fiskalpolitik entscheidend: Nach Präsident Lyndon Johnsons viel gerühmter Senkung der Einkommensteuer (die bereits von seinem Vorgänger John F. Kennedy vorgeschlagen worden war) schoss die US-Wirtschaft durch die Decke.
Dies ist auch der Moment, mit dessen Beschreibung der Ökonom Alan S. Blinder sein Buch A Monetary and Fiscal History of the United States, 1961-2021 beginnt. Ende der 1960er war Blinder Doktorand für Ökonomie am MIT, wo er vermutlich bei Kindleberger Wirtschaftsgeschichte studiert hat. Heute warnt er, die Ökonomie sei blind für ihre eigene Vergangenheit geworden. Seit seiner Studienzeit ist das Fach mathematischer und weniger historisch geworden, und Kindleberger wurde immer weniger gelesen.
Nach seiner Pensionierung 1976 und bis zu seinem Tod 2003 widmete sich Kindleberger der Geschichtsschreibung. Laut Mehrling wusste „Charlie“ (wie er ihn nennt) grundlegende Dinge über die Funktionsweise der Weltwirtschaft, die viele Mainstream-Makroökonomen nie verstanden haben – teilweise weil sie darauf bestehen, die Makroökonomie in rein nationalen Zusammenhängen zu betrachten.
Hier bezieht er sich auf die Generationen von Ökonomen, die ihre MIT-Doktortitel in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg unter Koryphäen wie Paul Samuelson, Franco Modigliani (Draghis Doktorvater) oder Robert Solow (Blinders Doktorvater und Mitglied von Bernankes Dissertationskomitee) erlangt haben.
Damals war das MIT der Mittelpunkt des amerikanischen Keynesianismus, und seine promovierten Ökonomen waren dazu bestimmt, in mächtige Regierungspositionen aufzusteigen – wie man an den Karrieren von Draghi, Bernanke und Blinder sieht. Aber wie Mehrling in seiner eigenen subtilen Kritik an dieser Schule zeigt, ist Kindlebergers Ökonomie zwar vielleicht nicht diejenige, zu der sich Männer wie Draghi oder Bernanke bekennen, aber es ist die, die sie als Zentralbanker umgesetzt haben – und damit die Welt geschaffen haben, in der wir heute leben.
Mehrling selbst hatte nie einen Regierungsposten inne. Stattdessen hat er unermüdlich seine eigene ausgeprägte „Geldsichtweise“ entwickelt und Kindleberger dabei als seinen direkten Vorgänger bezeichnet. Obwohl seine Positionen nicht unbekannt sind (in Finanz- und Online-Kreisen hat er eine erhebliche Gefolgschaft), werden sie in den traditionellen ökonomischen Fachbereichen – wie in Princeton, wo Blinder lang tätig war – eher weniger berücksichtigt.
Daher zitiert Blinder in seinem neuesten Buch 19-mal die Werke des konservativen Ökonomen Milton Friedman von der Universität Chicago – des Gegenstücks zu seinem eigenen liberalen Keynesianismus –, verweist aber kein einziges Mal auf Mehrlings Schule, und erwähnt Kindlebergers Klassiker Manias, Panics, and Crashes: A History of Financial Crises von 1978 nur einmal in einer Fußnote.
Obwohl es also in beiden Büchern um dasselbe Thema – nämlich die Politik und Geschichte des Geldes – geht, begegnen sie einander thematisch kaum. Die Frage ist also, was wir lernen können, wenn wir beide gemeinsam lesen. Wenn Mehrlings Buch eine Hommage an Kindleberger ist, könnte Blinders Werk eine Hommage an Kindlebergers MIT-Kollegen genannt werden – also an Blinders Lehrer und die Architekten des amerikanischen Nachkriegs-Keynesianismus. Diese Männer, so behauptet Blinder, haben letztlich den Durchblick.
Fiskalpolitik ist ein mächtiges Instrument, und häufig ist sie eine passende Methode für Regierungen, in den Konjunkturzyklus einzugreifen, um die makroökonomischen Bedingungen zu beeinflussen. Befindet sich eine nationale Volkswirtschaft in einer Rezession (oder Depression), werden antizyklische Staatsausgaben zur Steigerung der aggregierten Nachfrage, Produktion und Beschäftigung anhand eines „Fiskalmultiplikators“ bewertet.
Laut der Keynesianischen Theorie löst jeder Dollar zusätzlicher geldpolitischer Stimuli (Ausgaben oder Steuererleichterungen) mehr als einen Dollar an wirtschaftlicher Produktion aus, da das zusätzliche Geld, das die Menschen in den Taschen haben, eine Nachfrage nach noch mehr Waren und Dienstleistungen erzeugt.
Aber natürlich ist geldpolitische Expansion riskant, da sie Inflation auslösen kann. Daher besteht der Auftrag der Geldpolitik darin, den – in der klassischen „Phillips-Kurve“ dargestellten – bestmöglichen Kompromiss zwischen Preisstabilität und Beschäftigung zu finden, indem sie die Volkswirtschaft an einen Punkt auf der Kurve bringt, an dem weder zu viel Inflation noch zu viel Arbeitslosigkeit herrscht.
Aus seiner Analyse schließt er, dass die Grundlagen dieser Fachrichtung überdauert haben: „Konkurrenzlehren zum Keynesianismus sind in den Jahrzehnten, die dieses Buch behandelt, gekommen und wieder gegangen: der Monetarismus, die neue klassische Ökonomie der ‚rationalen Erwartungen’, die Ökonomie der Angebotsseite und viele andere. Aber nur eine hat überlebt.“
Die Alternativen zu Blinders Keynesianismus haben sich entweder. wie Friedmans Monetarismus, selbst ein Bein gestellt, oder sie wurden in den „Neuen Keynesianismus“ übernommen, der auch rationale Erwartungen berücksichtigt. Und die Ökonomie der Angebotsseite hat sich als peinliche politische Fehleinschätzung erwiesen.
Der Keynesianismus des MIT lebt weiter, aber mit einer wichtigen Wendung: Sein Schwerpunkt hat sich von der Fiskal- auf die Geldpolitik verlagert. Die drei Meilensteine dafür waren die Inflation der 1970er, Präsident Ronald Reagans Haushaltsdefizite in den 1980ern, und der Triumph der „Unabhängigkeit der Zentralbanken“ in den 1990ern. Diese Ereignisse haben die Bühne für die „unkonventionellen“ geldpolitischen Maßnahmen der Zeit nach 2008 bereitet.
Makroökonomisch betrachtet war die zweistellige Inflation der 1970er ein Segen für den Monetarismus, laut dem „Inflation immer und überall ein monetäres Phänomen ist – in dem Sinn, dass sie nur darin besteht und dadurch entstehen kann, dass die Geldbestände schneller zunehmen als die Produktion“.
Blinder kontert diese berühmte Aussage Friedmans mit der Bemerkung, die Inflation der 1970er sei weitgehend auf „Angebotsschocks“ bei Energie und Nahrungsmitteln zurückgegangen. Aber andere Kritiker des Keynesianismus wie Robert Lucas von der Universität Chicago haben dessen Standardmodelle zu Recht dafür kritisiert, dass sie die Erwartungen der Wirtschaftsakteure nicht ausreichend berücksichtigen.
Als Volcker 1979 zum Fed-Vorsitzenden ernannt wurde, war die Inflation bereits fast ein Jahrzehnt lang hoch gewesen. Entschlossen richtete er die US-Geldpolitik an Friedmans bevorzugtem Ansatz aus: der Beeinflussung der Geldmenge oder Geldbestände. Um die Geldmenge zu verringern, gab Volcker die Kontrolle der Fed über die kurzfristigen Zinsen auf, die entsprechend in die Höhe schossen.
Aber bald hörte er damit auf: einerseits, weil die US-Wirtschaft bis 1982 in eine tiefe Rezession gefallen war, und andererseits, weil es sich als praktisch unmöglich erwiesen hatte, die Geldmenge zu messen – ganz zu schweigen davon, sie anzupassen.
Immerhin wird sie nicht nur vom Angebot des Geldes bestimmt, sondern ebenso stark von der schwer fassbaren Geldnachfrage. Obwohl die Preisinflation nun unter Kontrolle war, war der Monetarismus in Verruf geraten, und der liberale Keynesianismus hatte gelernt, die Bedeutung der „Inflationserwartungen“ zu akzeptieren.
Der Defizit-Faktor
Volcker beendete seine Amtszeit als Fed-Vorsitzender unter Präsident Reagan, der Greenspan einsetzte. Reagans Schwerpunkt lag nicht auf der Geldpolitik, sondern auf den Steuern. Im Einklang mit der Theorie der Angebotsseite versprach er, zur Steigerung der Unternehmensinvestitionen die Steuern zu senken und damit für höhere Produktivität, mehr Wirtschaftswachstum, mehr Staatseinnahmen und letztlich geringere Haushaltsdefizite zu sorgen.
Aber nachdem er 1991 tatsächlich die Steuern gekürzt hatte, geschah nichts von alledem. Stattdessen explodierte das Haushaltsdefizit.
Als dann Anfang 1993 Bill Clinton an die Macht kam, wurde Blinder Mitglied des wirtschaftlichen Beraterstabs des Weißen Hauses, und fortan rückte das Haushaltsdefizit in den Mittelpunkt. Robert Rubin, ehemaliger Mitvorsitzender von Goldman Sachs, übernahm die Leitung von Clintons Wirtschaftsteam und überredete den Präsidenten, den Haushalt auszugleichen, um den Anleihenmarkt zu besänftigen.
Eine Anleihenrallye, so argumentierte er, würde zu sinkenden Langfristzinsen führen und mehr private Investitionen in die „New Economy“ der Hochtechnologie leiten. Clinton glich also den Haushalt aus, und tatsächlich stiegen die Investitionen – was teilweise an der lockeren Geldpolitik der Fed unter Greenspan lag, die klugerweise auf die Macht der „New Economy“ setzte, um das Produktivitätswachstum zu steigern.
In diesem Umfeld der Förderung der Finanzmärkte riefen die Clintonianer nun die „Unabhängigkeit der Zentralbank“ aus. Blinder verteidigt seine Auffassung des Keynesianismus und besteht darauf, der Boom der 1990er sei ein außerordentliches Ereignis gewesen – während viele Liberale wie Rubin diesen Boom irrtümlicherweise als Hinweis darauf betrachteten, der Fiskalmultiplikator sei „negativ“ gewesen, weswegen es sei immer am besten sei, den Haushalt auszugleichen, um das Vertrauen der Privatinvestoren zu gewinnen.
Während Blinder dann die Dot-Com-Blase von 2000 Revue passieren lässt, bezieht er sich kurz auf Kindlebergers Manias, Panics, and Crashes, um dann umgehend zu den Steuersenkungen von Präsident George W. Bush überzugehen.
Wie bereits bei Reagan verursachten diese im Vorfeld der Finanzkrise von 2008 erwartungsgemäß ein großes Haushaltsdefizit. Und dann rehabilitierte die Obama-Regierung die keynesianischen Argumente zum Fiskalmultiplikator dadurch, dass sie 2009 den stärksten Stimulus gab, der politisch möglich war (auch wenn er immer noch nicht ausreichte) – und die Fed unter Bernanke kam ihm zu Hilfe, indem sie ihre Geldpolitik umgehend änderte. Am Ende gelang es der Regierung, eine schwere Rezession zu verhindern.
Auch im letzten Jahrzehnt wiederholte sich dieses Muster: Wie Reagan und Bush setzte auch Donald Trump massive Steuersenkungen durch, die auf derselben angebotsseitigen Argumentation beruhten. Der versprochene Nutzen trat jedoch kaum ein, und die Defizite gingen erneut durch die Decke.
Als COVID-19 zuschlug, öffnete der von Trump eingesetzte Fed-Vorsitzende Jerome Powell sämtliche geldpolitische Schleusen: Er vergrößerte die Bilanz der Fed um etwa vier Billionen Dollar, und die fiskalpolitischen Stimuli der Trump- und Biden-Regierungen verdeutlichten erneut den positiven keynesianischen Fiskalmultiplikator
Blinde Flecken
Dies sind die Grundzüge von Blinders außerordentlich klarem, fundiertem und zuverlässigem geschichtlichen Überblick. Aber kein Buch kann alles berücksichtigen: Obwohl Blinder eine beeindruckende Insidergeschichte der keynesianischen Makroökonomie Amerikas geschrieben hat, lässt sein Bericht einige wichtige Dinge aus.
Beispielsweise ist in seinem Buch, obwohl es 1961 beginnt, keine Rede von der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung, dem schnellen wirtschaftlichen Aufstieg der Sun-Belt-Region und dem Klimawandel.
Auch die historische Beteiligung von Frauen am US-Lohnarbeitsmarkt, die Deindustrialisierung des US-Produktionsgürtels, die zunehmende Beschäftigung im Dienstleistungssektor und den Anteil der Verteidigungskosten an den Staatsausgaben erwähnt er nur beiläufig.
Blinder räumt ein, dass sich die US-Produktivität seit den 1970ern (mit Ausnahme des 1990er-Booms) abgeschwächt hat, aber er bietet dafür keine wirkliche Erklärung – ebenso wenig wie für den Trend der wirtschaftlichen Erholung ohne die Neuschaffung von Arbeitsplätzen.
Dementsprechend erwähnt er auch nicht die Schwächung der US-Arbeiterbewegung, das zunehmende Nachfragemonopol auf den Arbeitsmärkten, den Rückgangs des Marktwettbewerbs und die immer stärkeren Konzernmonopole in diesem Zeitraum.
Ebenso schreibt er nicht über die Explosion der Einkommens- und Wohlstandsungleichheit seit 1980, oder Bezüge zum Kalten Krieg, zu Schwellenländern, zur Globalisierung und zum Aufstieg Chinas. Zu diesen Themen haben Ökonomen und Historiker viel zu sagen. Geht man aber nach Blinder, spielen sie in der keynesianischen Mainstream-Makroökonomie keine Rolle.
Dies soll nicht suggerieren, Blinders makroökonomische Schule habe nichts Wichtiges zu bieten. Im Gegenteil, er und andere MIT-Keynesianer haben richtig erkannt, dass der Staat, wenn er vor einer Rezession steht, (ceteris paribus) mehr ausgeben sollte. Aber diese Einsicht hilft uns nur bedingt weiter, und geht man nach Blinders Buch, hat seine Version des Keynesianismus über viele der ökonomisch wichtigsten Dinge erstaunlich wenig zu sagen.
Angesichts dessen, wie viel Macht und Einfluss makroökonomische Experten wie er seit den 1960ern genießen, ist dies beunruhigend. Seit einem halben Jahrhundert prägen sie durch ihren privilegierten Zugang zu den höchsten politischen Kreisen unser wirtschaftliches Leben.
Natürlich behauptet Blinder, er habe die Politik ausreichend berücksichtigt, und er schließt sein Buch mit einer „furchtlosen Prognose“ ab, dass „fiskalpolitische Entscheidungen weiterhin größtenteils aus politischen Motiven heraus getroffen werden, während geldpolitischen Entscheidungen auch zukünftig technokratische und ökonomische Erwägungen zugrunde liegen“.
Im Laufe seines Buchs landet er viele Treffer gegen grobe Monetaristen und inkompetente Republikaner. Letztlich jedoch reicht seine politische Analyse nicht viel tiefer als die Schlagzeilen der Zeitungen. Und sogar dabei geht er an den wichtigsten Punkten vorbei.
Indem er das Verhalten der Zentralbanken als rein technisch motiviert betrachtet, spielt Blinder die dramatische Entwicklung des Übergangs von der Fiskal- hin zur Geldpolitik in den letzten Jahrzehnten herunter. Er bemerkt kaum, wie radikal die unkonventionelle Geldpolitik der Fed verglichen mit 1961 geworden ist.
Dabei erkennt er zwar, dass neue Maßnahmen zur „Finanzstabilität“ in den Vordergrund getreten sind, drückt dies aber viel zu mild aus. Die Geldpolitik wurde in den letzten Jahrzehnten so stark umgeformt, dass dies den Charakter des Geldes selbst verändert hat. In diesem Zusammenhang betrachtet kann der MIT-Keynesianismus der 1960er nicht anders als altmodisch wirken – unabhängig davon, wie oft er bereits modernisiert wurde.
Was Charlie sah
Mehrling hingegen behauptet, Kindlebergers geldpolitische Lehre sei zur Erklärung der heutigen wirtschaftlichen Veränderungen weiterhin vollständig geeignet – obwohl sie von seinen MIT-Nachkriegskollegen Samuelson und Solow als veraltet und nicht mathematisch genug abgetan wurde.
Als er zum MIT kam, hatte sich Kindleberger bereits das angeeignet, was Mehrling eine „Zentralbanksicht“ auf die Wirtschaft nennt. Zwei Aspekte dieser Sichtweise stechen heraus: Erstens betrachtete er die Wirtschaft letztlich als globales, grenzüberschreitendes Netzwerk öffentlicher und privater Bilanzen. Man kann sich diesen Bereich als eine Art Zwischenschicht vorstellen, die Blinders Standardmakroökonomie nationaler Gesamtgrößen mit der Mikroökonomie der Einzelpersonen und Unternehmen verbindet, die ihren Nutzen und ihre Wahlfreiheit maximieren.
Alle öffentlichen und privaten Entitäten – von Regierungsbehörden wie Zentralbanken bis hin zu Konzernen, Banken, Haushalten und Einzelpersonen – halten demnach in ihren Bilanzen Aktiva und Passiva, die wiederum mit Kapital-, Einkommens- und Zahlungsflüssen verbunden sind.
Nach dem Zweiten Weltkrieg machte sich Kindleberger große Sorgen über die langfristige Kapitalbildung in den Entwicklungs- und Schwellenländern. 1945 gehörte auch das kriegsgeschüttelte Westeuropa zu dieser Gruppe. Als kosmopolitischer New-Deal-Liberaler glaubte er an die Verantwortung der US-Regierung, auch den Rest der Welt mit langfristigen Kapitalflüssen zu versorgen. Mit diesen Mitteln könnten die Volkswirtschaften ihre Fertigungskapazitäten (wieder)aufbauen und vom Handel profitieren.
Kindleberger sah, dass der Schlüssel zu dieser Mission das Geld war. Geld war das Mittel, dass die Bilanzen der Welt miteinander verbindet, und es fand sich in diesen Bilanzen als Vermögenswert. Wie Mehrling es ausdrückt, gibt es immer eine „Hierarchie der Gelder“, und damit auch eine der damit verbundenen Kredite.
Das Geld an der Spitze – das ultimative Zahlungsmittel, oder was Kindleberger die „hegemonische“ Währung nannte – bestimmt dabei die Liquidität des gesamten globalen Systems (daher auch der Titel von Mehrlings Buch).
Eins der einflussreichsten akademischen Argumente Kindlebergers war, dass es immer eine – und nur eine – hegemonische Währung an der Spitze der globalen Hierarchie geben muss. Auch nicht-hegemonische Marktteilnehmer benötigen insofern erfolgreiche Hegemonen, die das Gesamtsystem absichern.
Dies geschieht durch die gelegentliche Vergabe von Liquidität an wichtige Finanzinstitutionen, um zu gewährleisten, dass Geld und Kredite durch die Zahlungshierarchie fließen. Diese Transaktionen halten die Wirtschaft zusammen und ermöglichen Beschäftigung, Produktion, Handel und Konsum, aber sie müssen ständig finanziert und verbucht werden. Darin liegt das praktische Geschäft des Bankwesens, das Zentralbanker quasi mit der Muttermilch aufgenommen haben. Die mathematische Modellierung dieses Mechanismus ist allerdings nicht unbedingt das, wofür die Makroökonomen in Blinders Tradition Nobelpreise gewonnen haben.
Das Dollar-System
Als Kindleberger jung war, befand sich die Welt im Übergang zwischen zwei Währungen: dem britischen Pfund Sterling und dem US-Dollar. Als Universitätsstudent sah er, wie das von den Briten unterstützte internationale Goldsystem während der Großen Depression zusammenbrach, als kurzfristiges („heißes“) Kapital durch die Welt marodierte und das internationale Finanzsystem zerstörte.
Was Kindleberger davon mitnahm, war, dass die USA ihrer Verantwortung als weltgrößte Wirtschaftsmacht nach dem Ersten Weltkrieg nicht nachgekommen waren. Sie hätten sich den Schuh des Hegemonen anziehen und den Dollar zur weltweiten Leitwährung machen sollen, was sie nicht getan haben.
Aufgrund dieser Überzeugung setzte Kindleberger nach dem Zweiten Weltkrieg seinen gesamten Einfluss im Außenministerium für die Schaffung eines neuen „Dollar-Systems“ ein. Um innerhalb eines solchen Systems verantwortungsvoll zu agieren, musste die US-Regierung die Welt mit genug Liquidität (in Form kurzfristiger Finanzierungen und – genauso wichtig – langfristig produktiver Investitionen) ausstatten, um die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern.
Da genau dies durch den Marshall-Plan umgesetzt wurde, betrachtete Kindleberger ihn als großen Erfolg. Mithilfe des Dollar wurde die wirtschaftliche Erholung Europas vorangetrieben. Kindlebergers hoffte damals, die Weltwirtschaft würde ein neues Gleichgewicht erreichen, in dem die Aufgabe der kurz- und langfristigen Finanzierung von privaten, internationalen und an den Dollar gebundenen Kapitalmärkten übernommen würde. Aber dies sollte erst später kommen – und erst, als die Regierungen die dafür nötigen Schritte unternahmen.
Als Kindleberger dann 1965 vor den Kongress berufen wurde, hatte sich vieles verändert. Ein großer Teil der Welt hatte sich nach dem Krieg erholt oder weiter entwickelt, und die USA waren nicht mehr der Warennettoexporteur von einst.
Viele von Kindlebergers akademischen Kollegen – darunter Modigliani beim MIT und insbesondere Robert Triffin in Yale – waren über die Lage erschrocken, in der sich der Dollar befand: War angesichts der vielen Dollars in Händen der US-Handelspartner ein Ansturm auf die Goldvorräte von Fort Knox zu befürchten? In diesem Fall würde sich das gesamte Bretton-Woods-System auflösen.
Kindleberger wandte ein, diese Ökonomen hätten ein falsches Bild der Weltwirtschaft. Sie sähen die nationalen Volkswirtschaften als isolierte, getrennte Einheiten, die miteinander handeln und durch Kapitalflüsse verbunden sind.
Aber er wies darauf hin, dass Länder normalerweise nicht miteinander Handel treiben. Dies geschieht zwischen Unternehmen, die von Banken finanziert werden. Die relevante Frage war also, ob diese ganzen Handelsvolumina auch finanziert werden können. Ja, dies war möglich und fand auch tatsächlich statt. Das Dollar-System funktionierte.
Dies bedeutete auch, dass am US-Handelsdefizit per se nichts falsch war. Im Gegenteil, das Defizit war eine Folge der schnellen weltweiten Entwicklung der Nachkriegswirtschaft – und damit ein Grund zum Feiern und ein Beweis für den Erfolg des Dollar-Systems.
Selbst wenn sich herausstellen sollte, so erklärte Kindleberger, dass der Welthandel nicht komplett durch private Akteure abgewickelt werden konnte, würden die Zentralbanker bereitstehen und das System mit Liquidität unterstützen. Allerdings hörte ihm in Washington niemand zu, und bis in die 1970er hatte Kindleberger den öffentlichen ökonomischen Diskurs weitgehend verlassen, um sich darauf zu konzentrieren, einige massive wirtschaftshistorische Werke zu schreiben.
Eine klärende Linse
Die Schlussfolgerung, zu der Mehrling letztlich kommt, ist sicherlich richtig: Die Ereignisse des einundzwanzigsten Jahrhunderts erfordern eine Rückkehr zu Kindlebergers historisch fundierter und global orientierter Perspektive.
Betrachten wir seine Theorie einer „hegemonischen Währung“: Seit den 1960ern wurde ständig gewarnt, die Vorherrschaft des Dollar könne nicht mehr lange andauern, da der relative Anteil der USA an der globalen Wirtschaft immer weiter zurückging. Aber trotzdem lebt die Dollar-Hegemonie weiter, genau es wie Kindleberger erwartet hätte.
Darüber hinaus hat er immer verstanden, dass das Geld- und Währungssystem grundlegend globaler Natur ist und daher innerhalb eines streng nationalen Bezugsrahmens nicht verstanden werden kann.
Blinders Wirtschaftsgeschichte aus dieser Perspektive zurück zu verfolgen ist sehr aufschlussreich. Sie zeigt, dass der Volckersche Zinsschock mit seinen erheblichen Folgen auch dafür gesorgt hat, dass der Status des Dollar als Weltreservewährung gesichert wurde. Wohin man auch schaut: Insbesondere in Krisenzeiten wollen die (öffentlichen und privaten) Vermögenden in Dollar investieren.
Ein Großteil des in Japan angehäuften Kapitals war durch die Haushaltsdefizite Reagans finanziert worden – ebenso wie viele der chinesischen Ersparnisse durch US-Defizite aus der Bush-Ära ermöglicht wurden.
Diese Länder haben Waren in die USA exportiert und bekamen dafür Dollars, mit denen sie dann US-Staatsanleihen kauften. So hielten sie den Wert des Dollar (durch ihre zunehmende Nachfrage) hoch und trugen damit zum Niedergang der US-Produktionsbasis bei, die immer stärker der Konkurrenz aus den exportorientierten asiatischen Ländern ausgesetzt war.
Dann kam die US-Immobilienblase der 2000er. Sie wurde teilweise von europäischen – insbesondere deutschen – Banken finanziert, die in ihren Bilanzen unbedingt Dollar-Vermögenswerte besitzen wollten.
Wie wir gesehen haben, führt an der Bilanz der Fed seitdem kein Weg mehr vorbei. In seinen grundlegenden Studien zu diesem Thema führt Mehrling detailliert auf, wie die US-Zentralbank nach 2008 nicht nur zum „Kreditgeber“, sondern auch zum „Händler“ der letzten Instanz wurde, indem sie für Liquidität sorgte und – von der Wall Street bis hin zur Main Street – über verschiedene Zahlungsebenen hinweg Märkte schuf.
Die Reaktion der Fed auf COVID-19 (sowie auf die Pleite der Silicon Valley Bank und der Signature Bank) hat diesen Trend noch verstärkt.
Dies soll nicht heißen, dass der globale Charakter des Dollar-Systems immer die absolut beste Erklärung für nationale Ereignisse darstellt. Der Punkt ist vielmehr, dass die Wirtschaftsgeschichte der USA über das letzte halbe Jahrhundert nicht vollständig ist, wenn man die Logik des globalen Dollar-Systems nicht berücksichtigt – das Kindleberger, wenn auch nur schemenhaft, in seinem Werk prophezeit hat.
So wie Blinders Untersuchungen manchmal etwas kurzsichtig sind, sind dies aber auch jene von Mehrling. Bei seiner Beschreibung der Einzelheiten des Bank- und Finanzwesens verliert er sich manchmal allzu sehr in Details, und fast alle der erwähnten Themen, die Blinder vernachlässigt hat, fehlen auch in Mehrlings Buch.
Und obwohl sein Buch den provokanten Titel Money and Empire trägt, bietet es keine fortlaufende Darstellung des „Imperiums“ oder der Eigenschaften der globalen US-Hegemonie. Daher lässt es einen im Zweifel, ob das Dollar-System tatsächlich zukunftsfähig ist.
Wie stark kann die Fed den Finanzsektor und die restliche Wirtschaft mit ihren unkonventionellen Maßnahmen tatsächlich absichern und finanzieren? Sind keine wachsenden politischen Proteste über die Nebenwirkungen dieser Eingriffe zu erwarten?
Mehrling erklärt die Logik des globalen Systems sehr gut. Aber ist dieses System tatsächlich das beste, das wir haben? Hat es tatsächlich keine Grenzen? Wird die nationale „wirtschaftliche Souveränität“, die Kindleberger in seiner Aussage vor dem Kongress erwähnt hatte, wieder in den Vordergrund treten? Die nächsten Kapitel der geld- und fiskalpolitischen Geschichte der USA werden von den Antworten auf diese Fragen abhängen.
Aus dem Englischen von Harald Eckhoff
Copyright: Project Syndicate, 2023.
www.project-syndicate.org