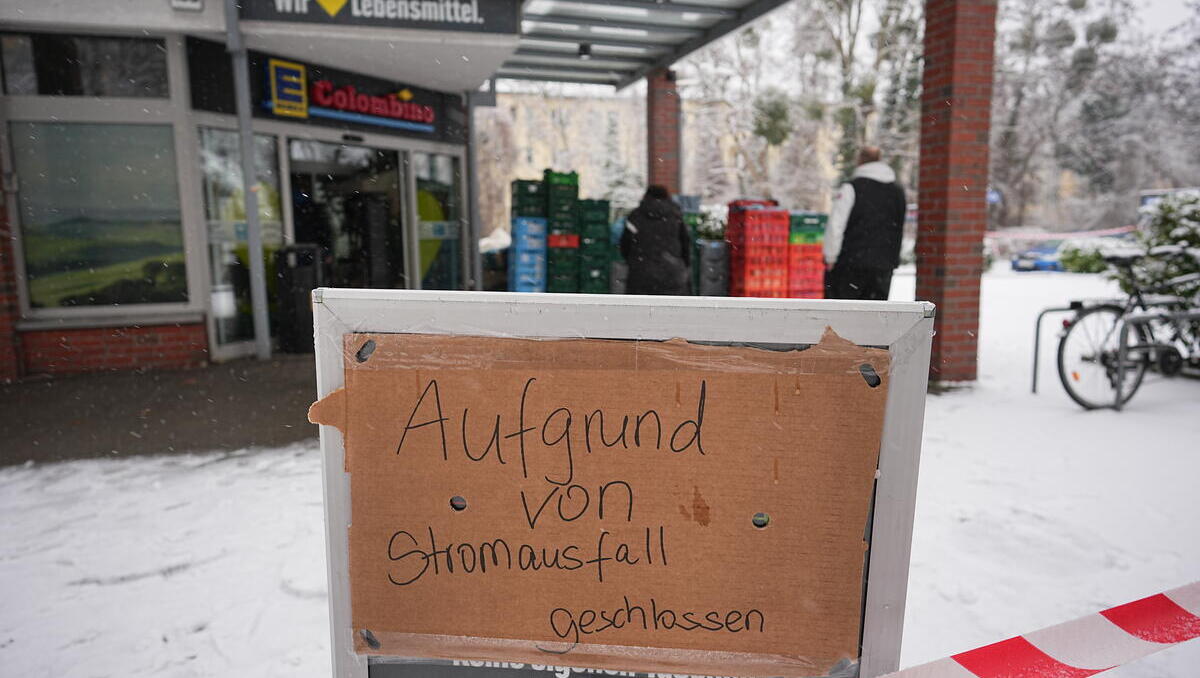Abstieg vom Thron: Einst Triumphzug, jetzt Überlebenskampf
China war jahrzehntelang Goldgrube und Prestigeplattform der deutschen Autoindustrie. Kein anderer Markt versprach mehr Wachstum, Umsatz und strategische Bedeutung. Doch dieser Erfolg gerät ins Wanken: Volkswagen und Audi stehen im "Reich der Mitte“ massiv unter Druck. Sinkende Verkaufszahlen, schrumpfende Gewinne – aus der einst verlässlichen Milliardenquelle ist ein Risikofaktor geworden.
Der Einbruch ist nicht nur Ergebnis geopolitischer Spannungen – er ist vor allem hausgemacht. Während chinesische Hersteller ihre Elektroflotten mit Hochdruck modernisieren, wirken die deutschen Konzerne schwerfällig, bürokratisch – und digital abgehängt. „Die deutschen Hersteller müssen mindestens so viel innovativer sein, wie sie teurer sind“, warnt Autoanalyst Prof. Dr. Stefan Bratzel. Was sich in China abspielt, ist mehr als eine Absatzkrise. Es ist ein Überlebenskampf – mit Signalwirkung für die gesamte deutsche Industrie.
Wie VW und Audi in China ins Hintertreffen geraten
Volkswagen dominierte jahrzehntelang den chinesischen Automarkt. Mit Joint Ventures wie FAW-VW und SAIC-VW war der Konzern tief in der Volksrepublik verankert. Noch 2019 verkaufte VW dort 4,2 Millionen Fahrzeuge – ein historischer Höchststand. Doch die Vormachtstellung bröckelt: Der Marktanteil ist seit den 1990er Jahren von 50-Prozent auf 12-Prozent gefallen – ein drastischer Einbruch. Und der Abwärtstrend hält an.
Auch Audi bekommt den Wandel deutlich zu spüren. Einst Statussymbol der chinesischen Oberschicht, liegt die Marke heute hinter Herstellern wie BYD, Nio und Li Auto. 2024 lieferte Audi rund 649.000 Fahrzeuge in China aus – etwa 11-Prozent weniger als im Vorjahr.
Gleichzeitig bauen chinesische Anbieter ihre Position rasant aus: BYD überholte Volkswagen bereits 2022 als meistverkaufte Marke im Land. Im Jahr 2024 kam BYD auf 34,1-Prozent Marktanteil im NEV-Segment (New Energy Vehicles) – Tendenz steigend.
Hightech kontra Hierarchie – und der Preis verschleppter Innovation
Die deutschen Autobauer haben die Geschwindigkeit unterschätzt, mit der sich Chinas Automarkt verändert – und das hat Folgen. Chinesische Hersteller werden technologisch immer stärker, während die traditionellen Stärken der Deutschen – etwa bei Fahrwerk und Verbrennungsmotor – im Elektrozeitalter zunehmend verblassen. Heute zählen andere Werte: Digitale Kompetenz, Software-Upgrades, Benutzerfreundlichkeit, Konnektivität. Genau hier setzen chinesische Marken an – mit massiven Investitionen in Forschung und Entwicklung, hochwertigen Produkten und einem wachsenden globalen Selbstbewusstsein.
Volkswagen wollte gegensteuern – und gründete die Softwaretochter Cariad SE, um ein einheitliches Betriebssystem für alle Konzernmarken zu entwickeln. Die Ziele waren ehrgeizig: Smartere Assistenzsysteme, regelmäßige Over-the-Air-Updates, digitale Services auf Augenhöhe mit Tesla. Doch statt Fortschritt brachte Cariad vor allem Probleme: Verzögerungen, Systemfehler, instabile Funktionen. Updates kamen zu spät oder gar nicht – auch, weil China westlichen Herstellern zunehmend den Zugriff auf Fahrdaten und Cloud-Dienste verwehrt. Die Kosten gingen in die Milliarden – das Vertrauen dagegen in den Keller.
Das neue Spiel: Was Chinas Autobauer besser machen
Chinesische Autobauer denken längst nicht mehr wie klassische Industrieunternehmen – sie agieren wie Tech-Konzerne. Sie setzen auf kurze Entwicklungszyklen, radikale Kundenzentrierung und digitale Erlebniswelten. Statt jahrelang am „perfekten Auto“ zu feilen, bringen sie marktreife Modelle in schnellem Takt auf den Markt – und verbessern sie kontinuierlich per Software-Update. Die Innenräume moderner chinesischer Fahrzeuge ähneln eher einem digitalen Cockpit als einem klassischen Armaturenbrett: Sprachsteuerung, große Touchscreens, Streaming-Apps und KI-Assistenten sind für viele junge Käufer wichtiger als Motorleistung oder Fahrwerk. Genau hier verlieren die deutschen Hersteller den Anschluss.
Ein weiterer Vorteil chinesischer Anbieter: Vertikale Integration. BYD produziert Batterien, Chips und Software selbst – effizienter, günstiger und weniger störanfällig. Deutsche Autobauer dagegen sind auf ein komplexes Netz aus Zulieferern angewiesen – ein Nachteil, der sich in jeder globalen Krise schmerzhaft bemerkbar macht.
Patriotismus, Preiskampf, Politik: Der China-Markt entgleitet den Deutschen
Der Wandel in China ist nicht nur technologisch – er ist auch politisch und kulturell. Ein wachsender wirtschaftlicher Nationalismus verändert das Konsumverhalten: Immer mehr Chinesinnen und Chinesen greifen laut einer Studie von Morning Consult gezielt zu heimischen Produkten – aus Überzeugung, aber auch aus patriotischem Pflichtgefühl. Für Volkswagen, Audi und ihre Zulieferer ist das eine bittere Entwicklung. Trotz milliardenschwerer Investitionen in lokale Werke sinken die Marktanteile. Die Kunden kaufen chinesisch – und die Gewinne brechen ein.
Gleichzeitig geraten die Margen massiv unter Druck. Der chinesische Markt ist von Preiskämpfen und staatlich geförderter Konkurrenz geprägt. Subventionen für heimische Hersteller verzerren den Wettbewerb, westliche Anbieter geraten ins Hintertreffen.
Und der geopolitische Druck wächst: Handelskonflikte, neue Zölle, technologische Entkopplung. Die Spannungen zwischen China, den USA und der EU machen das Geschäft zunehmend unberechenbar. Zwar investieren deutsche Hersteller gezielt vor Ort, um Zollrisiken zu umgehen – doch die erhoffte Stabilität bleibt aus.
Realitätscheck: China zwingt die Autoindustrie zum Neustart
Angesichts dieser Gemengelage aus politischem Druck, wachsendem Wettbewerb und kulturellem Wandel bleibt deutschen Herstellern kaum eine Wahl: Sie müssen handeln – und zwar schnell. VW-CEO Oliver Blume betont, dass der Konzern seine China-Strategie „systematisch vorantreibt“. Erste Maßnahmen sind sichtbar: Veraltete Kapazitäten werden abgebaut, Entwicklung „in China für China“ forciert, Preise gesenkt, Kooperationen mit lokalen Partnern geschlossen. Doch das Zeitfenster für die Aufholjagd schließt sich rasant.
Die Realität ist: Der chinesische Markt hat sich vom verlässlichen Renditetreiber zur strategischen Baustelle gewandelt. Die Kontrolle über den wichtigsten Automarkt der Welt haben die deutschen Hersteller inzwischen weitgehend verloren. Wer dort bestehen will, muss sich neu erfinden – nicht mehr als Autobauer, sondern als digitaler Mobilitätsanbieter. Denn der Maßstab für Erfolg liegt längst nicht mehr in Wolfsburg oder Ingolstadt, sondern in Shanghai und Shenzhen.
Der Fall VW ist kein Einzelfall – er steht exemplarisch für eine Industrie, die zu lange an gestrigen Erfolgen festgehalten hat. Und er ist ein Weckruf für den gesamten Wirtschaftsstandort Deutschland: Wer in China bestehen will, braucht mehr als Exportstolz – er braucht Tempo, Technologiekompetenz und radikale Innovationsbereitschaft. Denn die Autoindustrie ist nur der Anfang. Der Strukturbruch erfasst längst auch Maschinenbau, Chemie und Medizintechnik.