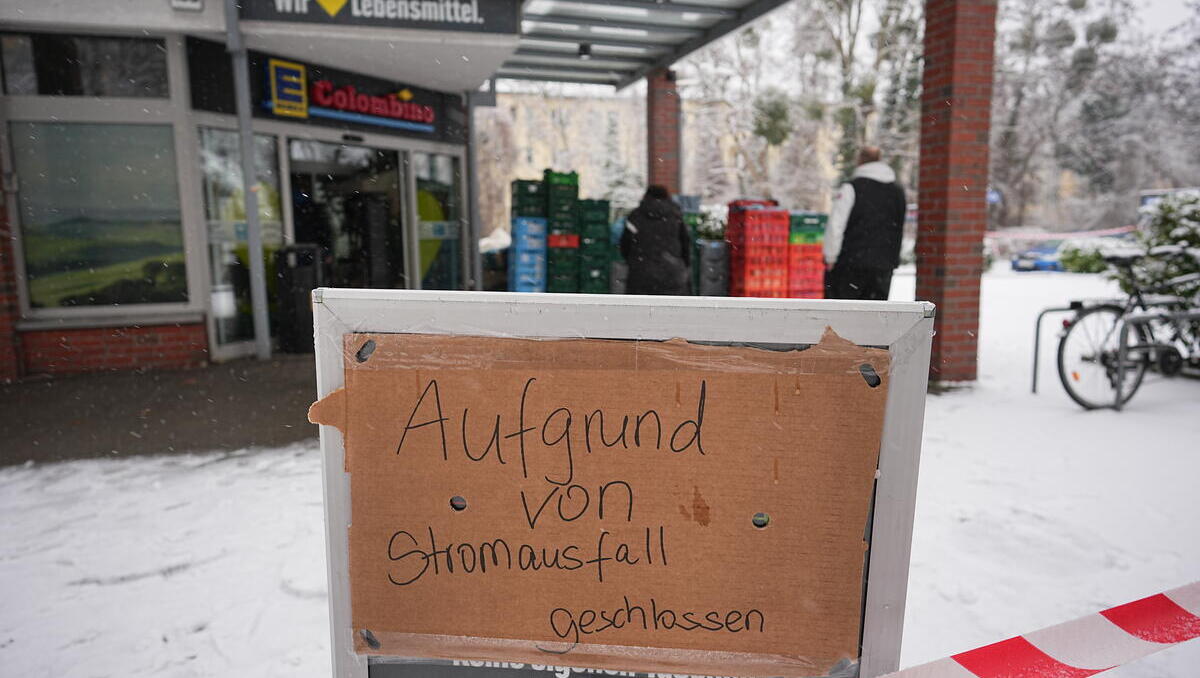Als im Juni 2016 der chinesische Haushaltsgerätehersteller Midea den Augsburger Roboterbauer Kuka für rund 4,5 Milliarden Euro übernahm, war die Aufregung groß. Kuka galt als Symbol deutscher Industrie 4.0-Kompetenz, als unverkäufliches Kronjuwel deutscher Automatisierungstechnologie. Der damalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) warnte im ifo Schnelldienst: „Wir dürfen nicht naiv sein. Es geht hier um strategische Interessen, nicht um normale Übernahmen.“ Die Übernahme wurde zum Wendepunkt in der deutschen Debatte über den Ausverkauf kritischer Technologien.
Cora Jungbluth, Senior Expert China and Asia-Pacific bei der Bertelsmann Stiftung, ordnet die Übernahme von Kuka der chinesischen Strategie „Made in China 2025“ zu: „Beteiligungen chinesischer Unternehmen an ausländischen Firmen sind explizit Teil dieser Strategie“, so Jungbluth in einer Studie Bertelsmann Stiftung zu chinesischen Strategie.
Im Sommer 2025 ist Kuka vollständig in den Midea-Konzern integriert. Während die Produktion am Standort Augsburg fortgeführt wird, ist die Entwicklung komplett mit chinesischen F&E-Einheiten verzahnt. Die Expertin befürchtet den schleichenden Abfluss von Know‑how, der das technologische Profil des Standorts langfristig schwächen dürfte.
China: Systematische Strategie statt Zufall
Ob Mehrheitsübernahmen oder gezielte Beteiligungen: Chinas Engagement in Deutschland folgt keiner Opportunität, sondern einem Plan. Das Programm „Made in China 2025“ dient dabei als Marschroute, um gezielt Schlüsseltechnologien aufzuspüren und zu erwerben und damit die eigene technologische Führungsposition auszubauen. „China kauft nicht wahllos”, so Jungbluth. “Die Übernahmen konzentrieren sich auf Branchen, in denen Deutschland weltführend ist: Robotik, Automatisierung, Biomedizin, neue Antriebstechniken.”
Von 175 chinesischen Beteiligungen in Deutschland zwischen 2014 und 2017 ließen sich 64 Prozent den Zielbranchen der Strategie „Made in China 2025“ zuordnen. Besonders gefragt waren damals Robotik (15 Prozent), Biomedizin (16 Prozent) und alternative Antriebstechnologien (21 Prozent). Bereits vor dem offiziellen Start der Strategie im Jahr 2015 waren chinesische Investoren in diesen Sektoren aktiv. Expertinnen wie Coera Jungbluth werten das als Beleg für die langfristig angelegte Industriepolitik Pekings.
Im Jahr 2024 wurden in Deutschland 1.724 neue ausländische Investitionsprojekte registriert. Dies geht aus dem FDI-Report 2024 (Foreign Direct Investments) von Germany Trade & Invest (GTAI), der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Bundesrepublik Deutschland, hervor. Das entspricht einem Rückgang von rund zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mit 194 Projekten belegte China erneut den dritten Platz unter den wichtigsten Herkunftsländern, hinter den USA (229 Projekte) und der Schweiz (204 Projekte), aber noch vor dem Vereinigten Königreich (149 Projekte) und den Niederlanden (132 Projekte).
Besonders stark nachgefragt sind laut GTAI strategische Branchen wie Digitalisierung, nachhaltige Mobilität und Energieeffizienz, also Sektoren, die mit den Kernzielen von „Made in China 2025“ weitgehend übereinstimmen. Damit wird deutlich: Trotz wachsender geopolitischer Spannungen hat sich die Stoßrichtung der chinesischen Investitionspolitik nicht verändert, sondern eher konsolidiert und weiter diversifiziert.
VW und Katar: Symbol für wirtschaftlichen und geopolitischen Einfluss
Während chinesische Investoren gezielt Schlüsseltechnologien erwerben, verfolgen die Golfstaaten, allen voran Katar und Saudi-Arabien, eine differenzierte Strategie.
Katar hat sich in den letzten Jahren zu einem der größten außereuropäischen Investoren in Deutschland entwickelt.
Laut dem Geschäftsbericht von Volkswagen für das Jahr 2024 hält die Qatar Holding LLC, eine Tochtergesellschaft der Qatar Investment Authority (QIA), 17 Prozent der Stimmrechte an der Volkswagen AG. Damit ist Katar der drittgrößte Anteilseigner des Konzerns. Der größte Anteil entfällt weiterhin auf die Porsche Automobil Holding SE mit 53,3 Prozent, gefolgt vom Land Niedersachsen mit 20 Prozent. Der verbleibende Anteil von 9,7 Prozent entfällt auf Streubesitz (Free Float) an institutionelle und private Investoren.
Diese Struktur ist politisch wie wirtschaftlich hoch relevant: Katar sichert sich über die QIA nicht nur bedeutenden wirtschaftlichen Einfluss, sondern ist als strategischer Partner im Aufsichtsrat der Volkswagen AG vertreten – derzeit durch Hessa Sultan Al Jaber, eine erfahrene Politikerin und Technologieexpertin. Dieses Engagement wird oft als Teil einer umfassenderen geopolitischen Strategie gedeutet.
Nach Ansicht des Energie- und Investmentanalysten Dr. Dawud Ansari vom German Institute for International and Security Affairs (SWP Berlin) verfolgt Katar mit solchen Beteiligungen das Ziel, „über gezielte Minderheitsbeteiligungen Einfluss auf zentrale Industrie- und Technologieentscheidungen zu nehmen, ohne sich operativ einzumischen“. Zwar bezieht Ansari sich in seinem Beitrag primär auf Investitionen im Energiesektor, doch lässt sich seine Analyse auch auf strategische Industrieengagements, wie das bei Volkswagen, übertragen.
Katars Beteiligung steht somit exemplarisch für den strategischen Wandel souveräner Staatsfonds in der Golfregion: weg von klassischen Finanzanlagen, hin zu geostrategisch positionierten Industriebeteiligungen in westlichen Ländern. Das Verhältnis Katars zu Volkswagen zeigt, wie eng wirtschaftliche Interessen und internationale Politik miteinander verwoben sein können.
Ein weiteres strategisches Investment durch Katar erfolgte im Jahr 2022 beim Essener Energieversorger RWE: Die QIA investierte 2,4 Milliarden Euro, um die Übernahme der US-Solarsparte Con Edison Clean Energy Businesses zu ermöglichen. Damit wurde Katar größter Anteilseigner des deutschen Energiekonzerns. Ansari zufolge verfolgt Katar damit das Ziel, sich „zumindest teils gegen einen langfristigen Ausfall von Gewinnen aus fossilen Brennstoffen abzusichern“.
Saudi-Arabien: Diversifikation mit geopolitischer Dimension
Auch Saudi-Arabien intensiviert seine Investitionen über den Public Investment Fund (PIF). Laut dem Allocation and Impact Report (2024) hat der PIF über 19,4 Milliarden US-Dollar in 91 grüne Projekte investiert, darunter Solarparks, Wasserstoffprojekte und nachhaltige Tourismusentwicklungen wie NEOM und Red Sea Global.
Diese Projekte sind Teil der Vision 2030, mit der Saudi-Arabien seine Wirtschaft diversifizieren und unabhängiger vom Öl machen will. Bei der Eröffnung des Saudi Green Initiative Forums am 3. Dezember 2024 in Riad erklärte Energieminister Prinz Abdulaziz bin Salman, die Transformation hin zu erneuerbaren Energien sei „nicht nur eine wirtschaftliche Notwendigkeit, sondern ein geopolitisches Gebot”.
Gabriel Felbermayr, der ehemalige Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW Kiel) und jetzige Präsident des Österreichischen Instituts für Wirtschaftsforschung, betonte bereits 2019: „Die Investitionen der Golfstaaten können kurzfristig stabilisierend wirken, bergen aber langfristig Risiken, wenn sich geopolitische Allianzen verschieben und wirtschaftliche Abhängigkeiten entstehen.“ Diese Einschätzung gewinnt angesichts wachsender globaler Spannungen zunehmend an Relevanz.
USA: Partner mit Kapital und eigenen Interessen
Die Vereinigten Staaten bleiben der mit Abstand wichtigste außereuropäische Investor in Deutschland. Ihre Engagements reichen von Neugründungen über Werkserweiterungen bis hin zu Beteiligungen an Großprojekten, insbesondere in technologiegetriebenen Schlüsselbranchen.
Ein Leuchtturmprojekt ist der geplante Aufbau einer der modernsten Halbleiterfabriken Europas durch Intel in Magdeburg. Das Investitionsvolumen liegt bei rund 30 Milliarden Euro, doch der Baustart wurde mehrfach verschoben. Aktuell ist der Produktionsbeginn frühestens für 2029 bis 2030 angesetzt, unter anderem wegen regulatorischer Einwände und Verzögerungen bei der Bodenaufbereitung. Dennoch gilt das Vorhaben als industriepolitisches Signalprojekt für die europäische Halbleiterstrategie.
Auch im Bereich der digitalen Infrastruktur setzen US-Konzerne Maßstäbe: So kündigte Amazon Web Services (AWS) Investitionen von 7,8 Milliarden Euro in eine neue „European Sovereign Cloud“ mit Standort in Brandenburg für das Jahr 2025 an. Die Cloud soll bis Ende 2025 in Betrieb genommen werden und dann vollständig von EU-Personal betrieben werden. Damit reagiert das Unternehmen auf die wachsenden Anforderungen an digitale Souveränität. Parallel dazu erweitert auch Microsoft seine Rechenzentrumsinfrastruktur in Deutschland, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet.
Gleichzeitig zeigen sich strukturelle Risse: Laut dem aktuellen „EY European Investment Monitor 2025” der Unternehmensberatung EY sank die Zahl neuer US-Investitionsprojekte in Deutschland im Jahr 2024 um 27 Prozent, der stärkste Rückgang unter allen Herkunftsländern. Als Gründe nennen Investoren hohe Energiepreise, regulatorische Unsicherheiten und eine im internationalen Vergleich komplexe Bürokratie. „Deutschland droht, im Standortwettbewerb weiter zurückzufallen“, warnt Peter Ahlers, Co-Autor der Studie und Partner bei EY.
Politisch gelten US-Investitionen in Deutschland traditionell als Ausdruck des transatlantischen Bündnisses und genießen daher eine breite öffentliche Akzeptanz. Doch auch hierzulande wächst die Sensibilität: Kritiker verweisen auf Risiken durch digitale Abhängigkeiten und den Einfluss US-amerikanischer Tech-Giganten in sicherheitsrelevanten Bereichen. So betonte Bundesfinanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) am 23. Juni 2025 auf dem Tag der Industrie in Berlin im Rahmen des Panels „Comeback Germany. Aufschwung zu Exzellenz und Stärke“, dass Deutschland gezielt in seine Standortqualität investieren müsse. In seiner Rede sprach Klingbeil über die Notwendigkeit, Planungs- und Genehmigungsverfahren zu beschleunigen, Energiepreise zu senken und die digitale Souveränität zu stärken, um internationale Investoren langfristig zu binden.
Cosco und das Kanzler-Go: Hamburgs Hafen als Lehrstück deutscher Naivität
Es war ein Deal, der zum Symbol für die Frage wurde, wie viel Einfluss autoritäre Staaten auf kritische Infrastrukturen in Deutschland erhalten dürfen. Im Zentrum stand das eher unscheinbare Containerterminal Tollerort im Hamburger Hafen nahe der Köhlbrandbrücke. Als die chinesische Staatsreederei Cosco jedoch im Jahr 2022 ankündigte, 35 Prozent der Betreibergesellschaft HHLA (Hamburger Hafen und Logistik AG) übernehmen zu wollen, wurde aus dem Geschäft ein Politikum von nationaler Tragweite.
Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), einst Erster Bürgermeister der Hansestadt, stellte sich früh hinter das Vorhaben und gegen den Widerstand von sechs Bundesministerien, dem Bundesnachrichtendienst, der EU-Kommission sowie Verbündeten wie den USA. Die Kritik war deutlich: Der Einstieg Chinas in ein Terminal, das als Teil der kritischen Infrastruktur gilt, könne Deutschland wirtschaftlich wie politisch erpressbar machen. Der damalige Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang warnte im Bundestag: „Russland ist der Sturm, China der Klimawandel.“
Doch Scholz blieb bei seiner Linie. In der Öffentlichkeit verteidigte er den Deal als „richtige Lösung“, es gehe schließlich nur um ein Terminal in einem Hafen mit mehreren Betreibergesellschaften. Dass im Aufsichtsrat der HHLA mit Andreas Rieckhoff ein enger Vertrauter des Kanzlers saß, sorgte für zusätzliche Irritationen. Rieckhoff, langjähriger SPD-Staatsrat und Multiaufsichtsrat in Hamburg, hatte dem Einstieg Coscos zugestimmt, ein Detail, das später politische Brisanz gewann.
Nach zähem Ringen einigte sich das Bundeskabinett im Oktober 2022 schließlich auf einen Kompromiss: Cosco durfte 24,9 Prozent übernehmen, also 0,1 Prozent unterhalb der Schwelle, die Mitspracherechte bei strategischen Entscheidungen ermöglicht. Doch der Schaden war angerichtet und der Cosco-Einstieg wurde zum Lackmustest für Deutschlands Umgang mit autoritären Investoren und zum Menetekel für eine Industriepolitik, die zwischen Standortinteresse und Sicherheitsbedenken zerrieben wird. Seither steht der Cosco-Einstieg in den Hamburger Hafen für die Frage, wie viel geopolitische Naivität sich die Exportnation Deutschland im 21. Jahrhundert noch leisten kann.
Nationale Nachjustierung, aber reicht das?
Als Teil der Antwort wurden das Außenwirtschaftsgesetz (AWG) und die Außenwirtschaftsverordnung (AWV) mehrfach novelliert, zuletzt mit der am 1. Mai 2021 in Kraft getretenen 17. AWV-Novelle. Sie senkte die Prüfschwellen für sicherheitsrelevante Sektoren auf bis zu zehn Prozent der Stimmrechte und erweiterte die Liste kritischer Technologien um Bereiche wie Künstliche Intelligenz, Robotik, Halbleiter, Quanten- und Optoelektronik sowie autonomes Fahren.
„Deutschland hat aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre gelernt”, erklärte Nils Schmid, damals außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, in einem Hintergrundgespräch mit dem Wissenschaftlichen Dienst des Bundestags im Jahr 2022 und fügte hinzu: „Nun steht die Stärkung der technologischen Souveränität im Zentrum sicherheitspolitischer und wirtschaftlicher Überlegungen.”
Auf europäischer Ebene regelt die Verordnung (EU) 2019/452 seit Oktober 2020 die Überprüfung ausländischer Direktinvestitionen. Sie schafft einen Kooperationsmechanismus zwischen den Mitgliedstaaten und der EU-Kommission, bleibt aber in ihrer Wirkung begrenzt. Laut dem Sonderbericht Nr. 27/2023 des Europäischen Rechnungshofs haben sechs Mitgliedstaaten bislang keinen eigenen Prüfmechanismus eingerichtet.
Zudem bestehen erhebliche Unterschiede bei der Definition kritischer Sektoren und der Auslegung zentraler Begriffe wie „öffentliche Ordnung“ oder „nationale Sicherheit“. Diese Regelungslücken, so der Rechnungshof, führen zu „blinden Flecken“, die den Schutz kritischer Infrastrukturen und Technologien beeinträchtigen und damit nicht nur die technologische Souveränität, sondern auch die Integrität des EU-Binnenmarkts gefährden.
Von Kuka bis Katar: Wie viel Kontrolle darf Kapital kosten?
Deutschland steht vor einem strategischen Dilemma. Einerseits sind ausländische Direktinvestitionen ein zentraler Treiber für Wachstum, Innovation und Beschäftigung und bringen dringend benötigtes Kapital, sichern Arbeitsplätze und ermöglichen den Zugang zu Schlüsseltechnologien. Andererseits bergen gezielte Beteiligungen aus China, den Golfstaaten oder von staatsnahen US-Techkonzernen das Risiko eines schleichenden Technologietransfers, geopolitischer Einflussnahme und wachsender Abhängigkeiten in sicherheitsrelevanten Sektoren.
Beispiele wie die Übernahme des Roboterherstellers Kuka durch Midea, der Einstieg von Cosco in den Hamburger Hafen oder die Beteiligung der Qatar Investment Authority an Volkswagen und RWE zeigen, wie stark geopolitische Interessen mit wirtschaftlichen Verflechtungen verwoben sind. Gleiches gilt für US-Investitionen, etwa durch Amazon Web Services oder Microsoft in die deutsche Cloud-Infrastruktur.
Politische Gegenmaßnahmen auf nationaler und europäischer Ebene, von verschärften Investitionskontrollen über sektorale Prüfmechanismen bis hin zu geplanten Reformen der EU-Screening-Verordnung, zielen darauf ab, die daraus resultierenden Risiken zu begrenzen. Doch in seinem Sonderbericht 27/2023 kritisierte der Europäische Rechnungshof weiterhin Regelungslücken und mangelnde Harmonisierung, die den Schutz kritischer Infrastrukturen unter anderem in Deutschland erschweren.
Die Herausforderung bleibt daher bestehen. Nur durch eine klare Definition strategischer Sektoren, einheitliche Prüfstandards und mehr Transparenz in der Risikobewertung kann die EU eine tragfähige Balance zwischen Offenheit für ausländisches Kapital und dem Schutz eigener wirtschaftlicher und sicherheitspolitischer Interessen finden. In Zeiten wachsender geopolitischer Spannungen geht es dabei nicht um technokratischen Feinschliff, sondern um strategische Resilienz.