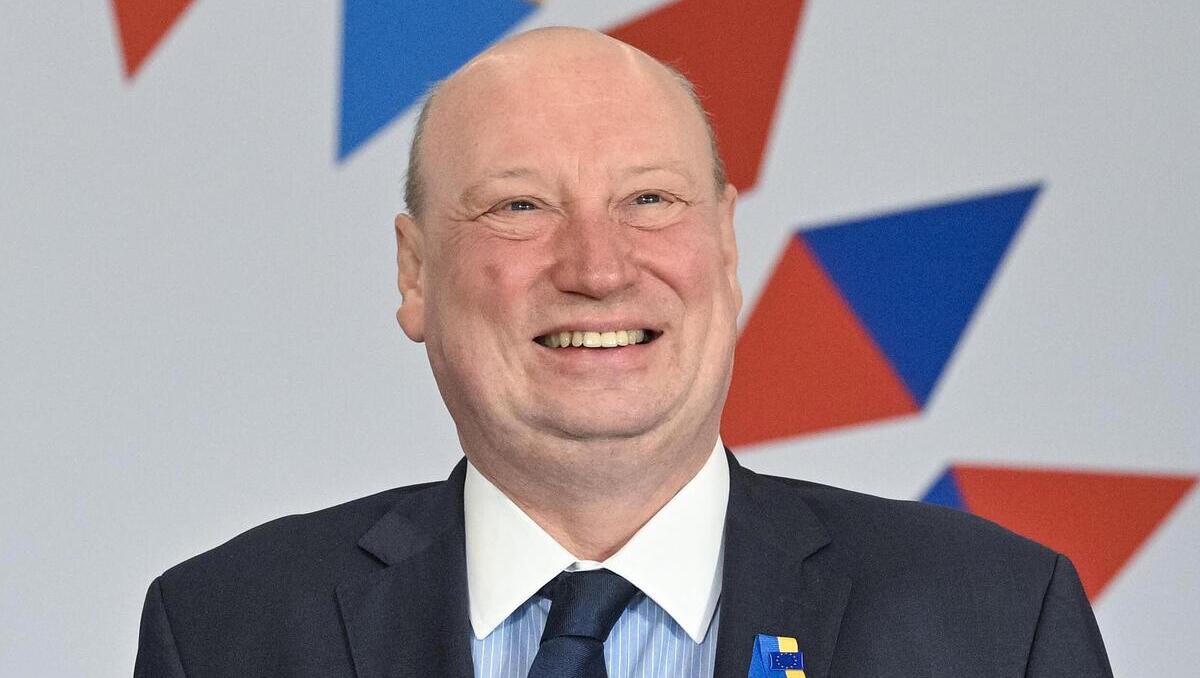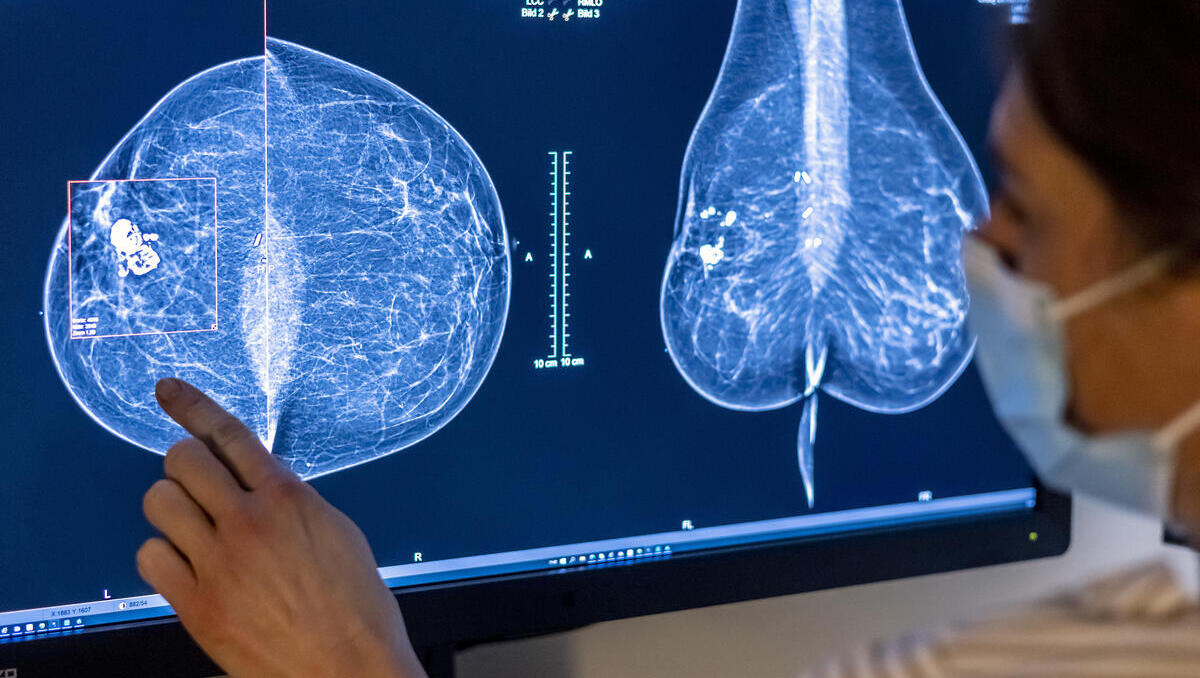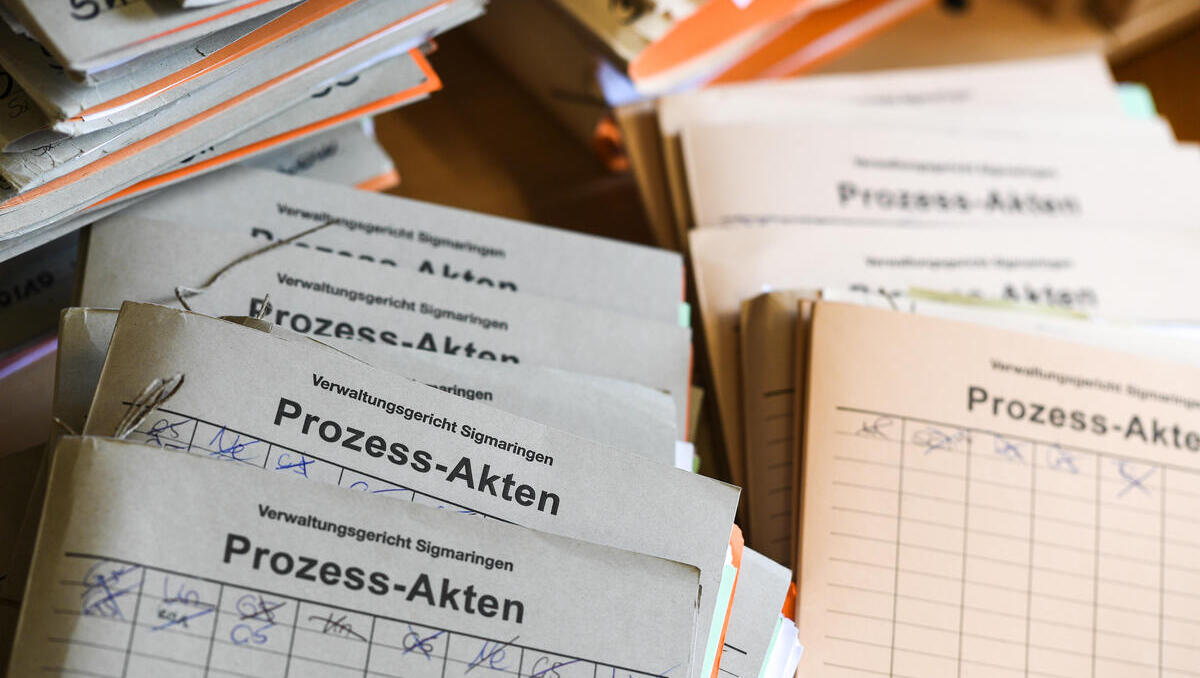ESG-Berichtspflicht durch die Hintertür: Wie Brüssel kleine Firmen in die Nachhaltigkeitsfalle drängt
Wie schwerfällig die Modelle und Empfehlungen für Nachhaltigkeitsberichterstattung kleiner Unternehmen auch nach den angekündigten Vereinfachungen geblieben sind – und warum „freiwillig“ in der Praxis kaum zutrifft.
Die Europäische Kommission hat Empfehlungen zur freiwilligen Nachhaltigkeitsberichterstattung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) veröffentlicht. Was genau beinhalten diese Empfehlungen? Was ist verbindlich – und wie soll berichtet werden?
1. Was ist das „Empfehlungspaket“ der EU?
Zunächst ist das Papier ein Zwischenschritt – kein endgültiger Standard. Es zeigt einmal mehr, wie überreguliert und träge die EU agiert. Zur Erinnerung: Bereits im Februar legte die Kommission das Gesetzespaket „Omnibus I“ zur Vereinfachung vor. Es schlug vor, die verpflichtende ESG-Berichtspflicht gemäß der CSRD-Richtlinie (Corporate Sustainability Reporting Directive) auf Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten zu beschränken. Für kleinere Unternehmen (bis zu 1.000 Beschäftigte) sollte ein freiwilliger Berichtsstandard gelten.
Doch: Dieser Standard liegt noch nicht vor. Stattdessen wurde jetzt eine Empfehlung verabschiedet – als Übergangslösung bis zur offiziellen Annahme eines delegierten Rechtsakts. Dieser kann aber erst erlassen werden, wenn das gesamte „Omnibus I“-Paket in Kraft ist. Zudem weist die Kommission darauf hin, dass der künftige Rechtsakt nicht zwingend dem aktuellen Empfehlungstext entsprechen muss.
2. Wozu dient die neue Empfehlung?
Sie soll eine einheitliche Struktur für die sogenannte freiwillige ESG-Berichterstattung von KMU in der Übergangszeit schaffen.
3. Wenn das Ganze freiwillig ist – warum sich überhaupt damit beschäftigen?
Weil es faktisch nicht freiwillig ist. Große Unternehmen sind durch die EU-Gesetzgebung zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet. Um ihre eigene ESG-Performance bewerten zu können, fordern sie entsprechende Informationen von ihren Lieferanten – also auch von kleinen Unternehmen. Gleiches gilt für Banken, die nachhaltige oder günstige Finanzierungen gewähren wollen. Auch sie können ESG-Daten verlangen.
Die „Freiwilligkeit“ ist also relativ. Die Kommission fordert zudem die Mitgliedstaaten auf, die Umsetzung ihrer Empfehlung aktiv zu fördern. Der Begriff „Empfehlung“ wird beibehalten, um den Anschein von Freiwilligkeit zu wahren – inhaltlich kommt dies aber faktisch einer neuen Pflicht gleich.
4. Was genau beinhalten die EU-Empfehlungen?
Die Kommission veröffentlicht zwei Anhänge zu ihren Empfehlungen für die freiwillige ESG-Berichterstattung kleiner und mittlerer Unternehmen. Der erste Anhang ist im Grunde ein Muster, wie zwei Berichtsarten – entweder nach dem Basis- oder dem erweiterten Modell – aufgebaut werden sollen. Der zweite Anhang enthält „praktische“ Leitlinien zur Anwendung des freiwilligen Berichtsstandards, der im ersten Anhang definiert ist. Es handelt sich also um Anforderungen – und anschließend um Anleitungen, wie diese zu erfüllen sind.
- Anhang 1 (31 Seiten): Vorlage für Berichte – wahlweise im Basis- oder im erweiterten Modell.
- Anhang 2 (41 Seiten): Praktische Anleitung zur Anwendung des freiwilligen Standards.
Die Anhänge enthalten Berichtsmuster, methodische Empfehlungen und Vorgaben zur Berechnung und Berichterstattung in verschiedenen ESG-Kategorien.
5. Das Basis-Modell: Fünf Berichtsbereiche
Noch einmal: Die Berichterstattung ist vereinheitlicht. Man versucht, sie so weit wie möglich zu vereinfachen. Konkrete Anweisungen finden sich in den veröffentlichten Anhängen 1 und 2. Das Basis-Modell umfasst fünf Hauptabschnitte. Zunächst werden grundlegende Angaben über das Unternehmen gemacht: Beschreibung des Unternehmens, Sitz, Zahl der Beschäftigten, Eigentümerstruktur, Tätigkeitsfelder, Produkte und Dienstleistungen.
Auch die Grundlagen für die Berichtserstellung sind hier anzugeben. Im zweiten Abschnitt geht es um Nachhaltigkeitspolitik, also darum, ob das Unternehmen eine ESG-Strategie hat und wie diese aussieht – also der Weg des Unternehmens zu einer nachhaltigeren Wirtschaft. Der dritte Abschnitt umfasst Daten zu Umweltauswirkungen: Dazu gehören Angaben zum Energieverbrauch, zu CO₂-Emissionen, zur Verschmutzung von Wasser, Luft und Boden, zum Umgang mit Abfällen und andere in den Empfehlungen definierte Angaben.
Der vierte Abschnitt betrifft den Umgang mit Beschäftigten: Welche Maßnahmen ergreift das Unternehmen für Gesundheit, Geschlechtergleichstellung, Sicherheit, Fortbildung und Schulung? Der fünfte Abschnitt bezieht sich auf Unternehmensführung und Ethik. Hier müssen auch etwaige Risiken, Strafen oder Verurteilungen wegen Korruption und Bestechung offengelegt werden.
- Basisinformationen: Unternehmensbeschreibung, Sitz, Beschäftigtenzahl, Eigentümerstruktur, Tätigkeitsfelder, Produkt- und Dienstleistungsangebot, Grundlagen für das Berichtswesen.
- ESG-Politik: Ob und wie Nachhaltigkeitsziele, -strategien und -maßnahmen formuliert sind.
- Umweltauswirkungen: Energieverbrauch, CO₂-Emissionen, Luft-, Wasser- und Bodenbelastung, Abfallmanagement.
- Soziales: Maßnahmen zu Gesundheitsschutz, Gleichstellung, Arbeitssicherheit, Weiterbildungsangebote etc.
- Governance & Ethik: Hinweise zu Unternehmensführung, etwaige Korruptionsfälle, ethische Richtlinien und Risiken.
6. Das erweiterte Modell: ESG-Strategie, Risiken, Lieferkette
Dieses wird mit großer Wahrscheinlichkeit dann notwendig sein, wenn Banken es verlangen. Zunächst werden wiederum die Grunddaten zum Unternehmen abgefragt. Der zweite Abschnitt betrifft die Nachhaltigkeitsstrategie: Hier muss dargelegt werden, wie die langfristige Vision aussieht, wer für die Umsetzung verantwortlich ist, welche Initiativen bestehen. Der dritte Abschnitt umfasst die Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Governance (ESG) sowie die Identifizierung von Risiken und Verbesserungspotenzial. Hier ist besonders wichtig, wie die Einschätzungen zustande kommen. Im vierten Abschnitt geht es um ESG-Ziele und Kennzahlen: Welche Zielsetzungen wurden in Bezug auf Emissionen, Ressourcennutzung, Inklusion, Governance festgelegt? Welche Indikatoren werden erfasst?
Der fünfte Abschnitt enthält erneut detaillierte Angaben zu Energieverbrauch, Emissionen, Abfällen, Wasserverbrauch, Abwasser, Materialeinsatz. Im sechsten Abschnitt geht es um die Achtung der Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, Diversität in der Belegschaft, aber auch um die Beziehung zur lokalen Gemeinschaft und um gesellschaftliche Verantwortung. Besonders zu beachten ist, dass auch Vorfälle in Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen oder Arbeitsrechtsverstößen offengelegt werden müssen. Im siebten Abschnitt geht es um Unternehmensführung, Ethik und Compliance. Hier sind interne Kontrollmechanismen, Compliance-Abteilungen, ethische und Antikorruptionsrichtlinien zu beschreiben. Der Bericht bezieht sich außerdem auf Nachhaltigkeit in der Lieferkette: Also wie überwacht ein Unternehmen die ESG-Standards bei Lieferanten? Gibt es Richtlinien zur Auswahl, nach welchen ESG-Kriterien wird entschieden – und so weiter?
- Grunddaten (wie im Basismodell)
- Nachhaltigkeitsstrategie: Langfristige Vision, Verantwortlichkeiten, konkrete Initiativen
- ESG-Wirkung und Risikobewertung: Einschätzung und Beschreibung der sozialen, ökologischen und Governance-bezogenen Risiken und Chancen
- Ziele und Kennzahlen: Welche ESG-Ziele wurden formuliert, wie werden diese gemessen?
- Detaildaten: Detaillierte Berichterstattung zu Energie, Emissionen, Wasserverbrauch, Abwasser, Materialeinsatz, Abfällen
- Soziale Verantwortung: Gleichstellung, Diversität, Menschenrechte, lokale Einbindung – inklusive Offenlegung möglicher Vorfälle
- Governance und Compliance: Interne Kontrollmechanismen, Compliance-Abteilungen, Ethik- und Antikorruptionsrichtlinien, ESG-Kriterien entlang der Lieferkette
Die letzte Kategorie ist besonders brisant: Unternehmen müssen auch offenlegen, wie sie Nachhaltigkeit bei Zulieferern kontrollieren – inklusive ESG-Auswahlkriterien und Sanktionsmechanismen.
Kleine Unternehmen unter indirekter ESG-Berichtspflicht
Auch in Deutschland betrifft die scheinbar „freiwillige“ ESG-Berichtspflicht Tausende kleiner Betriebe. Wer Teil globaler oder nationaler Lieferketten ist, wird durch Anforderungen großer Konzerne oder Banken faktisch zur Berichterstattung gezwungen – unabhängig von gesetzlicher Verpflichtung. Hinzu kommen finanzielle Belastungen: Die Erstellung der Berichte erfordert internes Know-how, externe Beratung und Zeit. Selbst ohne externe Prüfung entstehen hohe Kosten – die besonders kleinere Betriebe treffen.
Gerade im Mittelstand wächst der Unmut über den „sanften Zwang“ durch ESG-Regulierung. Auch in Branchen wie Maschinenbau, Lebensmittel oder IT-Dienstleistungen sehen sich viele KMU gezwungen, ESG-Standards zu erfüllen, um Aufträge oder Finanzierungen nicht zu verlieren.
ESG-Berichtspflicht: In Wahrheit Pflicht durch die Hintertür
Es ist grundsätzlich positiv, dass die Berichterstattung vereinheitlicht wird. Doch das sogenannte freiwillige, vereinfachte Nachhaltigkeitsberichten für kleine und mittlere Unternehmen ist weder einfach noch unkompliziert – und aufgrund der sehr wahrscheinlichen Anforderungen durch Banken auch nicht freiwillig. Die derzeit empfohlenen Berichtsinhalte und Methodologien bedeuten keine wesentliche Vereinfachung. Die Belastungen und Kosten werden für kleine Unternehmen steigen – auch wenn keine externe Prüfung der Berichte vorgesehen ist. Letztlich wird der Preis für diese Belastung wie üblich von den Endverbrauchern getragen. Kurz gesagt: Die Vereinfachung der Gesetzgebung und die Abschaffung überflüssiger Vorschriften stellt sich die EU-Bürokratie ganz anders vor als die Unternehmen selbst – und ebenso anders als die Nutzer oder Käufer von Produkten und Dienstleistungen.