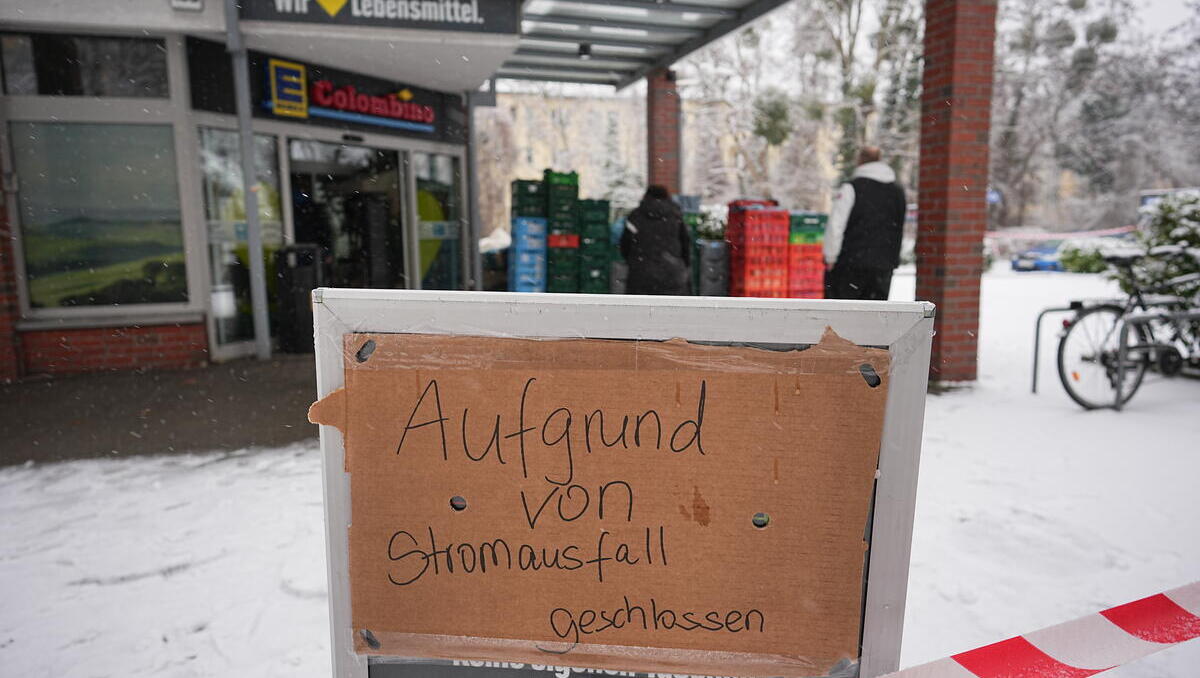Meta, Microsoft und Co.: Der Kampf um KI-Spezialisten eskaliert
In Silicon Valley ist ein extremer Kampf um die besten Köpfe der künstlichen Intelligenz entbrannt. Jüngstes Beispiel ist Matt Deitke: Der 24-Jährige lehnte zunächst Metas Angebot ab, selbst 125 Millionen Dollar konnten ihn nicht von seinem Start-up Vercept weglocken. Doch nach einem Anruf von Mark Zuckerberg, der das Angebot auf 250 Millionen Dollar verdoppelte, sagte er zu. Auch andere Topforscher wurden in den vergangenen Monaten für astronomische Summen abgeworben: Ruoming Pang, zuvor bei Apple, ging im Juli für 200 Millionen Dollar zu Meta. Zudem zahlte Meta 14,3 Milliarden Dollar, um die Hälfte von Scale AI und dessen Gründer Alexander Wang zu übernehmen. Microsoft wiederum holte 20 Deepmind-Forscher von Google, während Open AI Boni einführte, um Mitarbeiter zu halten. „Es ist die intensivste Talentschlacht, die ich in meiner Karriere gesehen habe“, so Open-AI-Chef Sam Altman.
Doch ob sich Hunderte Millionen für einzelne Talente rechnen, bleibt fraglich. Serge Belongie, Leiter des Pioneer Centre for AI in Kopenhagen, hält die Summen für „verblüffend“. Eine rationale Erklärung sei, dass Konzerne damit Markt und Konkurrenz ihre Führungsambitionen signalisieren. Die andere Möglichkeit sei Wunschdenken: die Hoffnung, einzelne Stars könnten den entscheidenden Durchbruch bringen. „Kein seriöser Akademiker glaubt daran. Doch diese Welt funktioniert fast wie eine Religion“, sagt Belongie.
Gigantische Summen, ernüchternde Ergebnisse: KI bisher nur Alltagstechnik
Tatsächlich ist KI-Forschung weit älter als ChatGPT, die Mathematik hinter Sprachmodellen längst publiziert. Deshalb zweifeln viele, dass Silicon Valley aus dem Nichts Superintelligenz erschaffen kann. „Mindestens ein entscheidendes Teil fehlt“, so Belongie. Auch Altman räumt ein, dass vor allem „einige wenige glänzende Namen“ umkämpft seien, in der Hoffnung, sie könnten den Weg zur Superintelligenz weisen.
Die Fixierung auf sogenannte AGI bezeichnet Belongie als „nahezu religiös“. Was „Superintelligenz“ überhaupt bedeutet, sei unklar. Dass Skalierung von Daten und Rechenleistung allein reicht, gilt inzwischen als widerlegt. Chat GPT 5, im August veröffentlicht, blieb ohne spektakulären Fortschritt. Auch andere Forscher sehen Sprachmodelle an Grenzen stoßen. „Wir brauchen neue Strategien“, sagt Joelle Pineau, frühere Meta-Expertin.
Belongie sieht die Zukunft der KI im Scheitern von Visionen
Dennoch investieren die Tech-Giganten weiter massiv. Meta, Microsoft, Amazon und Google steckten im ersten Halbjahr 155 Milliarden Dollar in KI. Meta plant zudem ein Rechenzentrum in Manhattan-Größe. Für Belongie ist die Vorstellung verführerisch, dass eine Intelligenz Programme ersetzt und im Nanosekundentakt Neues erschafft. Doch das sei „magisches Denken“. KI müsse als „ordinäre Technologie“ verstanden werden – ein Werkzeug wie Excel. Im Alltag nutzt Belongie ChatGPT und Gemini, um Routinen zu organisieren. „Ich bin beeindruckt und zugleich enttäuscht. Wegen der vielen kleinen Fehler habe ich keine Angst, dass alle arbeitslos werden.“ Es brauche einen Durchbruch, um die Systeme wirklich verlässlich zu machen.
Während Elon Musk und Sam Altman 2026 oder 2027 als Sprungjahre für AGI sehen, erwartet Belongie das Gegenteil: „2027 wird das Jahr sein, in dem die Grenzen für alle sichtbar werden. Wir werden zurückblicken und über Silicon Valley lachen.“
Künstliche Intelligenz: Praktischer Nutzen statt Übertreibung und Jobabbau
Für ihn liegt der größere Wert in konkreten Anwendungen statt in Visionen von Superintelligenz. Problematisch werde es, wenn das Narrativ genutzt werde, um Jobs zu streichen oder Budgets zu kürzen. So feuerte Klarna 2022 Hunderte Mitarbeiter und musste nach massiven Beschwerden wieder einstellen. „Wenn ich recht habe, wird KI wie andere Werkzeuge ins Ökosystem einsickern. Dann verstummt das idiotische Gerede und wir sehen den echten Nutzen“, so Belongie. KI werde zwar Jobs kosten, aber weniger dramatisch, als Silicon Valley es darstellt. „Versteht man, dass es glorified auto complete ist, ist man weniger anfällig für Hyperbeln.“ Belongie selbst zog es nie dauerhaft ins Silicon Valley. Als Berater von Google und Dropbox gewann er tiefe Einblicke, sah aber auch „viel Grifting“ – heiße Luft, die verkauft wird. „Wenn man damit leben kann, prima. Wenn nicht, ist es hart. Deshalb bin ich hier.“