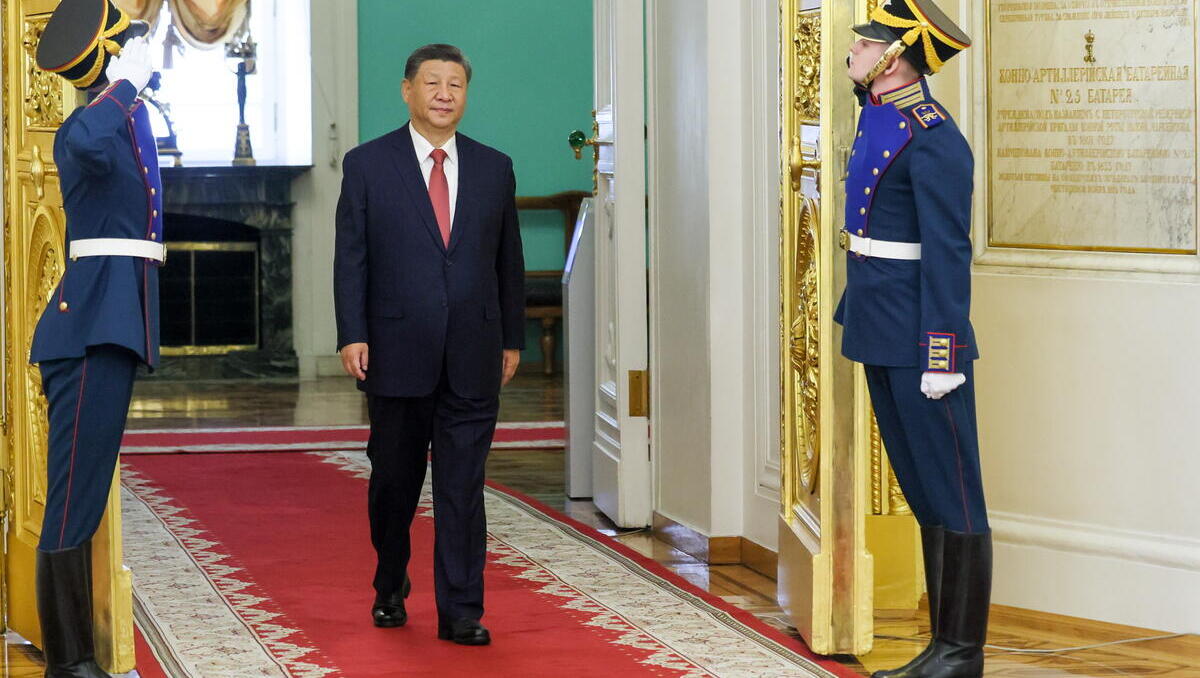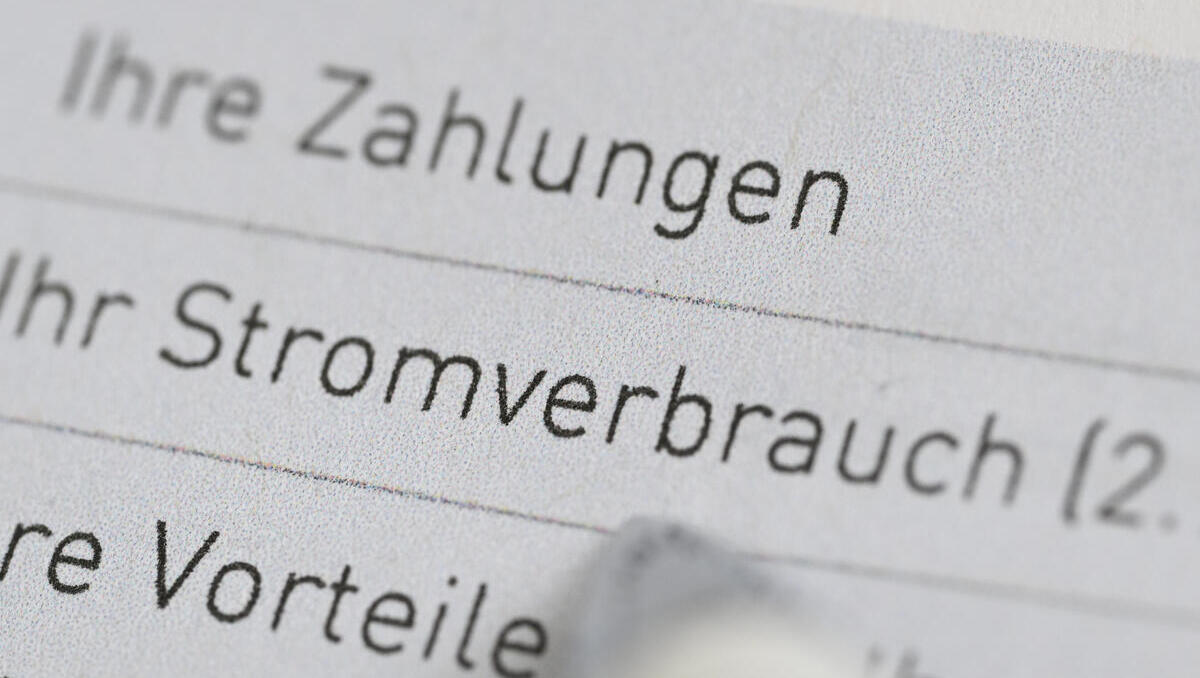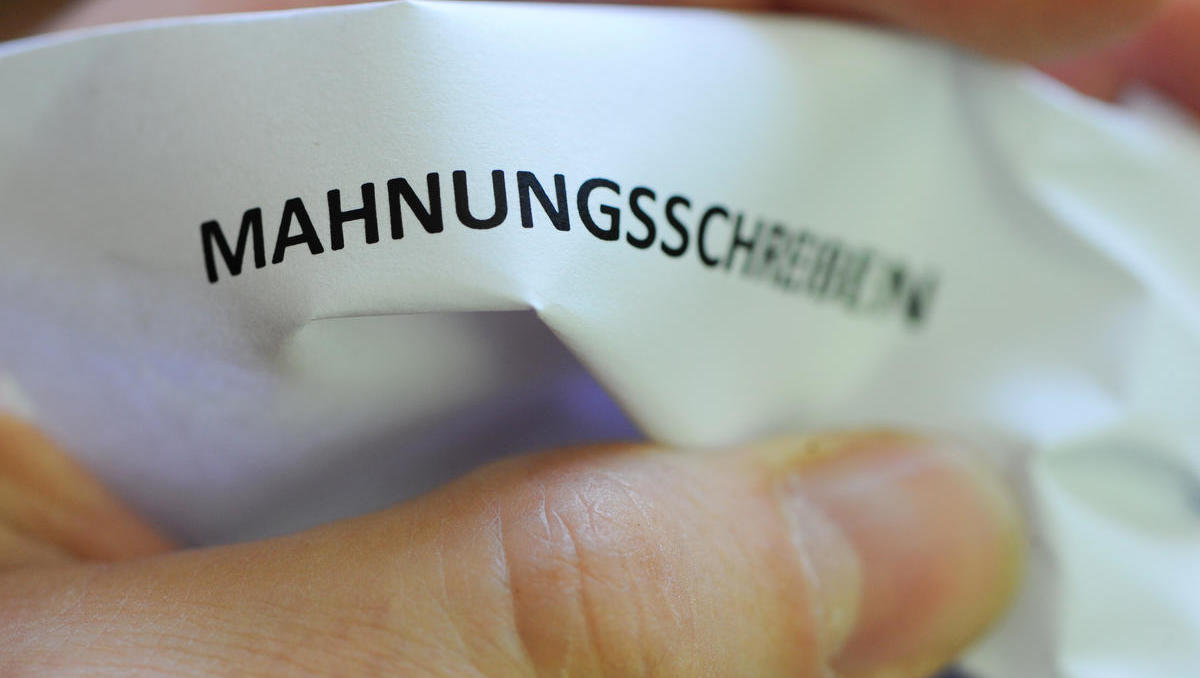Die EU-Führung ist bestrebt, die Entscheidung für den Austritt Großbritanniens aus der Gemeinschaft, als Fehler darzustellen, den die Briten noch bereuen werden. Diese Haltung passt zu dem ständigen Bestreben, alle Mängel der EU für unbedeutend zu erklären. Das ständig wiederholte Motto lautet: Man dürfe doch Kleinigkeiten angesichts der Bedeutung des europäischen Friedensprojekts nicht ernst nehmen. Mit dieser Politik hat die Gemeinschaft zugelassen, dass die „Kleinigkeiten“ zu einem riesigen Problem angewachsen sind, das nun durch den Brexit offenkundig wird. Es wäre sinnvoll, die Reden der britischen Premierministerin, Theresa May, ernst zu nehmen und aus EU-Sicht kritisch zu analysieren.
Frau May hat ihren Erklärungen in den vergangenen Tagen eine klare Trennung angekündigt und Zwischenlösungen abgelehnt, die letztlich doch zu einer Abhängigkeit von Brüssel führen würden. Vor allem wurden drei Ziele genannt:
- Großbritannien verlässt die EU, um nicht mehr der Niederlassungsfreiheit zu unterliegen. Man will selbst entscheiden können, wer zuwandern darf.
- Das EU-Recht wird nicht mehr angewendet, die Anerkennung des sogenannten „acquis communautaire“ zurückgenommen. Regelungen, die man akzeptiert, werden in britisches Recht übertragen, die übrigen verlieren ihre Gültigkeit. Gesetze werden nur mehr vom britischen Parlament beschlossen. Die Rechtsprechung ist Sache der britischen Gerichte, der Europäische Gerichtshof wird nicht mehr als Instanz anerkannt.
- Großbritannien verlässt den EU-Binnenmarkt und die EU-Zollunion. Zwischen der EU und Großbritannien soll ein Freihandelsabkommen geschlossen werden, das einen möglichst freien Waren- und Dienstleistungsverkehr sichert.
Die Abkehr von den Grundfreiheiten
Der freie Personenverkehr bildet gemeinsam mit dem freien Warenverkehr, dem freien Dienstleistungsverkehr und dem freien Kapitalverkehr die vier Grundfreiheiten, die als Fundament der EU angesehen werden. Der freie Personenverkehr begründet das Recht aller EU-Bürger sich überall in der Union niederzulassen und eine Arbeit anzunehmen.
Die Ablehnung der Niederlassungsfreiheit durch das Vereinigte Königreich entstand durch die starke Zuwanderung aus den osteuropäischen EU-Staaten, in erster Linie aus Polen. Die Gastarbeiter werden vielfach als Billig-Konkurrenz der heimischen Arbeitnehmer und somit als Belastung des Arbeitsmarktes gesehen. Zudem wird kritisiert, dass ausländische Unternehmen, etwa polnische, ihre Mitarbeiter in England einsetzen, diese zu den niedrigeren, in Polen üblichen Löhnen bezahlen und dadurch gegenüber britischen Anbietern billiger anbieten können.
Nicht nur die Abstimmung in Großbritannien wurde von diesem Thema beherrscht. Europaweit wird die Bedrohung der heimischen Arbeitsplätze durch Ausländer thematisiert. Angesichts der in fast allen Ländern hohen Arbeitslosigkeit ist es leicht, die Gastarbeiter zum Sündenbock zu stempeln. Damit nicht genug: Auch in Ländern mit geringer Arbeitslosigkeit wie Deutschland kommt die Botschaft bei vielen an. Generell ist das Phänomen zu beobachten, dass die Ausländerfeindlichkeit am stärksten in Regionen ist, wo kaum Ausländer wohnen.
Dass die hohe Arbeitslosigkeit andere Ursachen hat, spielt keine Rolle: Die hohen Steuern, der unflexible Arbeitsmarkt in den meisten EU-Staaten, die Kreditbremse im Gefolge der Regulierungen und die ungenügende Innovationsbereitschaft eignen sich nicht für markige Parolen.
Die EU ist also gefordert, sich dem Thema zu stellen. Populismus, der erfolgreich einen Sündenbock anprangert, ist nur schwer zu bekämpfen. Aber die EU könnte zumindest die rechtlichen Grundlagen der Ausländer-Beschäftigung klären.
Grundsätzlich kann das Gastland bestimmen, dass für die Gastarbeiter aus anderen EU-Staaten die gleichen Bedingungen gelten müssen wie für die heimischen Kräfte. In der Praxis ist dieses Prinzip schwer durchzusetzen. Vor allem sieht die Richtlinie über die Entsendung von Arbeitskräften einige Lücken vor. Diese könnten jedoch im EU-Recht geschlossen werden.
In den Monaten vor der Abstimmung im Vereinigten Königreich wurden London Zugeständnisse gemacht. Großbritannien sollte das Recht bekommen, bei Sozialleistungen und Kindergeld für EU-Ausländer Einschränkungen vorzunehmen. Allerdings wollte man sich nicht von der Freiheit des Personenverkehrs verabschieden, sodass nur eine halbherzige Regelung versprochen wurde, um die britischen Wähler zu beruhigen. Auch galt es, die osteuropäischen Staaten nicht zu verärgern, die von den Überweisungen der Gastarbeiter in die Heimatländer profitieren.
Somit können die EU-Spitzen den Demagogen nicht einmal mit einer klaren Aussage widersprechen.
Dem Druck der Demagogen beugen sich auch Regierungen. Der österreichische Bundeskanzler, Christian Kern, SPÖ, will die Niederlassungsfreiheit für Arbeitnehmer aus den osteuropäischen EU-Staaten einschränken. Der Integrationsminister, Sebastian Kurz, ÖVP, fordert die Konzessionen, die Großbritannien beim Kindergeld zugestanden wurden, für Österreich ein. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist entsetzt, man muss aber in Brüssel zur Kenntnis nehmen, dass der Damm bricht.
Die Brexit-Verhandlungen haben noch nicht begonnen, da wird eines der Hauptthemen zum Streitpunkt innerhalb der EU.
Regulierungswut und Rechtsunsicherheit empören nicht nur die Briten
Der zweite große Schwerpunkt in Theresa Mays Reden der vergangenen Tage ist der Abschied vom EU-Rechtsbestand und vom EuGH.
Die Briten treffen mit dieser Vorgabe den empfindlichsten Nerv der EU. Die von der EU-Kommission betriebene Regulierungswut ist einer der Hauptgründe für die weit verbreitete Skepsis gegenüber der Gemeinschaft. Dass dieses Thema aber nicht als allgemeines Problem diskutiert wird, ergibt sich aus mehreren Faktoren.
- Die vielfach als unsinnig und schikanös empfundenen Vorschriften betreffen immer nur eine bestimmte Gruppe. Jeder Bereich kämpft mit anderen Problemen.
- Für die breite Öffentlichkeit ist das Zustandekommen der Regeln nicht nachvollziehbar. In einem undurchsichtigen Verfahren, das zwischen der EU-Kommission, dem Rat der Regierungen und dem EU-Parlament abgewickelt wird, entstehen die Bestimmungen. Zur Verwirrung trägt der Umstand bei, dass in der EU keine Gesetze beschlossen werden, sondern „Richtlinien“ und „Verordnungen“. Verordnungen gelten unmittelbar EU-weit. Richtlinien müssen in nationale Gesetze der Mitgliedstaaten gegossen werden, die aber nicht zu stark von den Richtlinien abweichen dürfen.
- Die Rechtsunsicherheit beschränkt sich aber nicht auf das Zustandekommen der Bestimmungen. Die Auslegung und Anwendung wird in der Praxis wesentlich von den Beamten der EU-Kommission bestimmt. Auch die Bürokratien in den Mitgliedstaaten spielen hier eine Rolle.
- Rechtsmittel müssen in den Staaten ergriffen werden. Die lokalen Gerichte müssen entscheiden, ob die Verwaltung rechtskonform handelt, wobei aber durch das undurchsichtige System der EU die Rechtslage selbst oft unklar ist. Das letzte Wort hat der EuGH, dessen Entscheidungen nicht selten schwer nachvollziehbar sind.
Die kommenden Verhandlungen über die Bedingungen für den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU werden diese Problematik unweigerlich in den Vordergrund rücken. Gerade die zahllosen Regulierungen werden von den EU-Spitzen gerne als Kleinigkeiten abgetan, die man doch angesichts des Friedenprojekts nicht überschätzen dürfe. Die „Kleinigkeiten“ unterminieren das Friedensprojekt, indem sie für ständigen Ärger sorgen.
Der Freihandel bestimmte bis 1973 die Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien
Das Vereinigte Königreich will den Zustand wieder herstellen, der bis zum EU-Beitritt am 1. Januar 1973 bestanden hat. Bis zu diesem Tag war Großbritannien Mitglied der Freihandelszone EFTA, die auch Dänemark, Norwegen, Finnland, Österreich, die Schweiz, Schweden, Island und Liechtenstein umfasst hatte.
Gemeinsam mit Großbritannien trat auch Dänemark der EU bei.
Nach dem EU-Beitritt des Vereinigten Königreichs wurden nicht zuletzt auf Initiative von London Freihandelsverträge zwischen der EU und den verbliebenen EFTA-Staaten abgeschlossen. Dadurch entstand der größte Freihandelsraum weltweit. Die EFTA-Staaten behielten die volle wirtschaftspolitische Handlungsfreiheit.
In Großbritannien herrschte auch damals keine uneingeschränkte Begeisterung für die EU. Bei der ersten Volksabstimmung in der Geschichte des Landes 1975 stimmten aber 67,2 Prozent für den Verbleib.
1994 wurde der EWR, der Europäische Wirtschaftsraum, geschaffen, der eine Brücke zwischen der EU und der EFTA bildet.
1995 traten aber Österreich, Schweden und Finnland auch der EU bei. In der Folge besteht die EFTA heute nur mehr aus Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz. Im Rahmen des EWR sind nur Island, Liechtenstein und Norwegen mit der EU verbunden. Die Schweiz nimmt am EWR nicht teil, hat aber eine Vielzahl bilateraler Verträge mit der Gemeinschaft.
Diese Sonderregelungen zeigen, dass die Alternative keineswegs lauten muss „Vollmitglied oder keine gemeinsame Basis“. Unweigerlich rücken bei den Brexit-Verhandlungen die rechtlichen Lösungen in den Vordergrund, die bei der Regelung der Beziehungen zwischen der EU und der EFTA gefunden wurden.
Eine Freihandelszone hat den Vorteil, dass der Waren- und Dienstleistungsverkehr zwischen den Teilnehmern frei ist, dass aber jedes Land mit allen anderen beliebige Vereinbarungen treffen kann. Die EU ist hingegen eine Zollunion, die alle 28 Mitglieder zu einer Einheit schmiedet, die gegenüber Drittstaaten wie ein einziger Staat agiert. Hier setzt die Kritik der Briten an, die zwar mit der EU ein Freihandelsabkommen anstreben, mit anderen Staaten aber Vereinbarungen nach eigenem Gutdünken schließen wollen.
Diese Argumentation könnte auch andere EU-Mitgliedstaaten überzeugen. In diesem Zusammenhang dürfte die Frage der Bindungen durch die Zollunion eine geringe Rolle spielen. Das Signal, das aus dieser Diskussion kommt, lautet vor allem „freier Handel, aber sonst keine Bindungen“. Eine Reihe von EU-Regierungen pochen auf die Stärkung der Nationalstaaten und die Schwächung der Union. Diese Tendenz zeigt sich besonders stark in den neuen, osteuropäischen Mitgliedstaaten, die wenig Sinn für eine europäische Solidarität haben. Diese Länder sind aber Nutznießer der Zuschüsse, die von den Nettozahlern finanziert werden.
Die Reaktion der Netto-Zahler ist unvermeidlich
Angesichts des Verhaltens der osteuropäischen EU-Staaten ist eine Reaktion der Netto-Zahler auf Dauer nicht zu vermeiden. Von den 28 Mitgliedstaaten der EU zahlen nur 12 in die Gemeinschaftskasse mehr ein als sie bekommen. Der zweitgrößte Netto-Zahler ist Großbritannien, das nun ausfallen wird, sodass die anderen 11 mehr zur Kasse gebeten werden.
Die anderen 11 sind: Deutschland als der größte Zahler, gefolgt von Frankreich, den Niederlanden, Italien, Schweden, Belgien, Österreich, Dänemark, Finnland, Luxemburg, Zypern.
Die übrigen 16 Staaten kassieren.
Unter diesen Umständen werden sich nicht nur die ausgewiesenen EU-Gegner in den 11 zahlenden Staaten fragen, ob die aktuelle Struktur sinnvoll ist – zumal alle Staatshaushalte sparen müssen.
Für die bekannten EU-Gegner AfD in Deutschland, Front National in Frankreich, Partij voor de Vrijheid in den Niederlanden, FPÖ in Österreich ist der Ausfall des zweitgrößten Zahlers ein willkommenes Argument. Wie stark die EU-Kritik in Italien ist, hat sich zudem anlässlich des kürzlich abgehaltenen Referendums über eine Änderung der Verfassung gezeigt.
Die Brexit-Verhandlungen werden nicht allein ein Tauziehen zwischen London und Brüssel sein, sondern die EU in ihren Grundfesten in Frage stellen.
***
Ronald Barazon war viele Jahre Chefredakteur der Salzburger Nachrichten. Er ist einer der angesehensten Wirtschaftsjournalisten in Europa und heute Chefredakteur der Zeitschrift „Der Volkswirt“ sowie Moderator beim ORF.