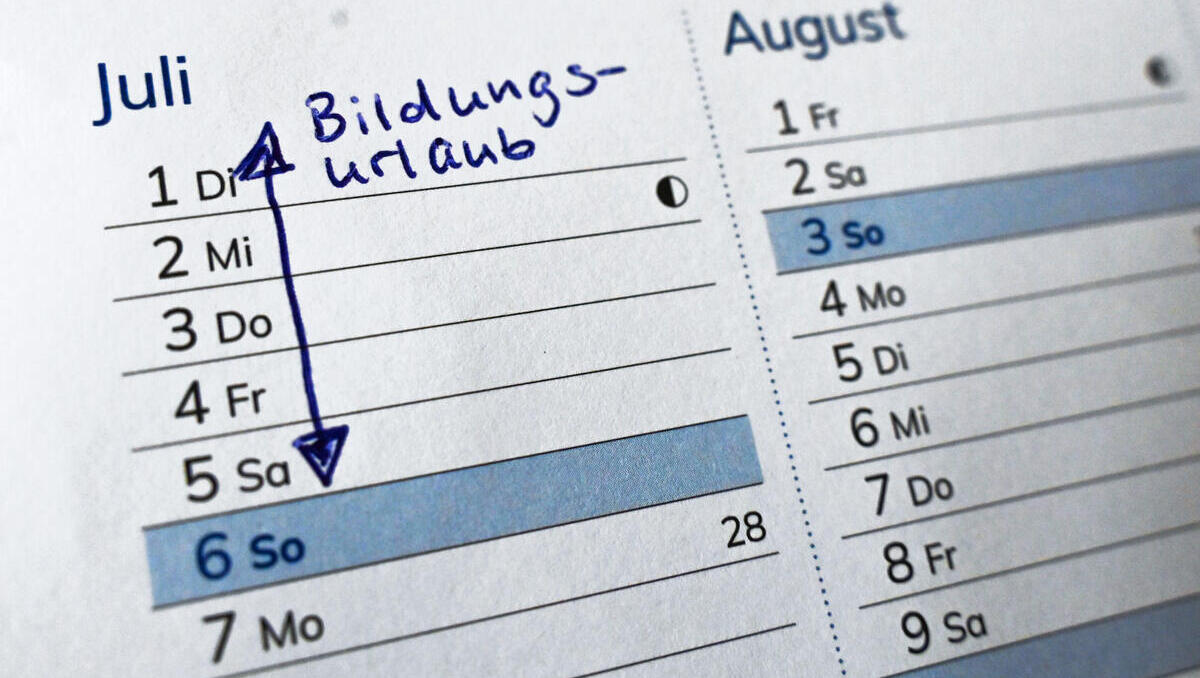Der geplatzte U-Boot-Deal zwischen Frankreich und Australien sorgt für Verstimmung und Empörung. Nicht nur innerhalb der Grande Nation, sondern auch in der EU („nicht akzeptabel“, so Kommissions-Präsidentin von der Leyen) sowie in Deutschland („irritierend und ernüchternd“, so Außenminister Maaß). Es mag verständlich sein, dass man einem Angehörigen des europäischen Staatenbunds beziehungsweise einem engen Verbündeten, der sich im Streit mit einem Land vom anderen Ende der Welt befindet, zur Seite steht. Gerechtfertigt ist es in diesem Fall allerdings nicht.
Lassen Sie uns kurz die Hintergründe rekapitulieren. Im April 2016 orderte Australien in Frankreich zwölf U-Boote (mit konventionellem Diesel-Antrieb), nachdem sich der französische Rüstungskonzern „Naval Group“ im Bieterwettbewerb gegen den deutschen Bewerber Thyssen Krupp Marine Systems sowie die Japaner Mitsubishi Heavy Industries und Kawasaki Heavy Industries durchgesetzt hatte. Der Wert des Auftrags: Circa 31 Milliarden Euro.
Letzte Woche dann, am 16. September, gaben Australien, die USA und Großbritannien die Gründung eines Sicherheitsbündnisses mit Namen AUKUS bekannt, auf dessen Grundlage der Staat im Südpazifik amerikanische Nuklearantriebs-Technologie zur Verfügung gestellt bekommt. Mit ihr wird Australien acht U-Boote ausstatten, die es in Eigenregie produzieren wird (der Pazifik-Staat ist erst der zweite Verbündete, dem die USA die geheime Technik offenbaren, der erste war Großbritannien im Jahre 1958). Den Vertrag mit Frankreich stornierten die Australier.
Wie gesagt: In Frankreich, aber auch in Teilen Europas sowie in Brüssel, brach ein Sturm der Entrüstung los. Auch große Teile der bundesdeutschen Presse warfen Australien Vertragsbruch vor, sprachen davon, dass das – sowieso schon arg angespannte - Verhältnis zwischen Europa auf der einen sowie den USA und seinen Verbündeten auf der anderen Seite einen weiteren schweren Rückschlag erlitten habe.
Die DWN haben recherchiert. Und sind, was die Verantwortung für den Eklat angeht, zu einem anderen Ergebnis gekommen.
So hat ein französischer Offizieller, der ungenannt bleiben wollte, der angesehenen Pariser Zeitung „Le Figaro“ gesagt: „Die australische Regierung hat das Vertrauen in die Fähigkeit [von Naval Group] verloren, die Untersee-Boote rechtzeitig zu liefern. Wir haben den Auftrag nicht ordentlich ausgeführt.“
Ein deutscher Experte, der ebenfalls ungenannt bleiben möchte, sagte den DWN: „Der Deal ist aus Sicht der Australier sehr mies gelaufen. Es gab zahlreiche Probleme. So musste Naval Group bereits kurz nach Vertragsabschluss zugeben, dass es im Zusammenhang mit dem Bau von U-Booten in Indien Opfer eines Hacker-Angriffs geworden war. Das weckte Befürchtungen auf Seiten der Australier, dass die Franzosen die notwendige Geheimhaltung nicht würden gewährleisten können. Weiterhin waren die Kosten für das Projekt im Laufe der Zeit immer weiter gestiegen. Ursprünglich waren 31 Milliarden Euro veranschlagt gewesen, dann waren es schließlich 56 Milliarden Euro. Dabei muss man bedenken, dass eine solche Summe für ein Land wie Australien, das ein Bruttoinlandsprodukt von 1,2 Billionen Euro sein Eigen nennt, viel gewichtiger ist als beispielsweise für Deutschland mit seinen 3,47 Billionen. Und schließlich hat Frankreich das Geschäft sehr einseitig zu seinen Gunsten interpretiert. Dazu muss man wissen, dass die Rüstungsindustrie in Frankreich eine relativ große Rolle spielt, weit größer als beispielsweise hierzulande. Sie befindet sich zu großem Teil in Staatsbesitz, bei Naval Group sind es rund 62 Prozent. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Entwicklung der U-Boote in Frankreich stattfindet, der überwiegende Teil der Produktion, nämlich 90 Prozent, jedoch in Australien. Das haben die Franzosen im Laufe der Zeit auf 60 Prozent runtergehandelt. Sie wollten ihre nicht ausgelastete Rüstungsindustrie mit Jobs versorgen – die Belange Australiens, also ihres Auftraggebers, waren für sie nur zweitrangig.“
Schließlich haben die DWN auch einen hoch angesehenen australischen Experten kontaktiert: Michael Shoebridge, Direktor des Bereichs „Verteidigung, Strategie und Nationale Sicherheit“ der renommierten (nichtstaatlichen!) Denkfabrik Australian Strategic Policy Institute. Er sagte: „Von Anfang an hat es mit dem Projekt Schwierigkeiten gegeben. Man hat versucht, diese auf höchster Ebene zu lösen, sogar der australische Premierminister und der französische Präsident waren involviert.“ Geheim seien diese Probleme nie gewesen – in den australischen Medien und im Parlament seien sie regelmäßig thematisiert worden.
Dass Shoebridge nicht einseitig Partei ergreift, im Gegenteil, wird daran offensichtlich, dass er auch für Australiens Regierung kritische Worte findet. Diese und die Naval Group beziehungsweise Frankreich hätten lediglich eine Vertragspartnerschaft aufgebaut, wie es bei einem normalen Geschäft üblich sei, statt eine Partnerschaft im politischen Sinne: „Die beiden Regierungen haben das U-Boot-Programm nicht zu einer tiefen strategischen technologischen Partnerschaft ausgebaut, sondern es einfach nur als einen sehr, sehr großen Vertrag angesehen.“
Eine Frage kann an dieser Stelle nicht abschließend beantwortet werden. Nämlich die, was die Australier letztendlich wirklich von den Franzosen erwarteten. Die bestellten französischen U-Boote sollten über einen konventionellen Diesel-Motor verfügen – auch die deutschen und japanischen U-Boote wären mit Diesel angetrieben worden. Nach Aussage des von den DWN befragten deutschen Experten erfüllten das deutsche und vor allem das japanische Angebot die Anforderungen der australischen Ausschreibung eigentlich besser als es die französische Offerte tat. Warum setzte sich diese dennoch durch? Um diese Frage – zumindest spekulativ – zu beantworten, muss man wissen, dass Frankreich, anders als Deutschland und Japan, über die für einen Nuklear-Antrieb notwendige Technologie verfügt. Kann es sein, dass die Australier bereits bei Vertragsabschluss darauf hofften, dass Frankreich ihnen früher oder später die Nuklear-Technik zur Verfügung stellen würde? Dass Paris diese Hoffnung jedoch nicht erfüllte? Und dass die Australier, als ihnen dies klar wurde, an einer Erfüllung des Vertrags gar nicht mehr interessiert waren? Derzeit lässt sich nicht sagen, ob dem so war – man kann die Möglichkeit in den Raum stellen, mehr nicht.
Feststehen tut zu diesem Zeitpunkt nur eins: Frankreich hat mit seiner Nachlässigkeit, ja, man kann sagen mit seiner Arroganz, stark dazu beigetragen, dass das Geschäft platzte. Erwähnenswert ist noch, dass die Affäre kein Ruhmesblatt für die DGSE, den französischen Auslandsgeheimdienst, darstellt: Das amerikanisch-britisch-australische Abkommen wird kaum über Nacht abgeschlossen worden sein – aber es traf die französische Regierung völlig unvorbereitet.
Was Australien angeht: Die Mittelmacht, die sich unter starkem chinesischem Druck befindet, seit sie es wagte, Peking zu kritisieren - vor allem in Hinblick auf die noch immer nicht geklärte Herkunft des Corona-Virus -, hat ihre Position gegenüber dem Reich der Mitte in hohem Maße gestärkt (und eins steht außer Frage: Die U-Boot-Anschaffung richtet sich gegen China, gegen niemanden sonst). Nuklear-angetriebene U-Boote sind nämlich um ein Vielfaches kampfkräftiger als konventionell angetriebene. So können sie viel länger unter Wasser bleiben; theoretisch für immer, auftauchen müssen sie in realiter nur, um Vorräte aufzunehmen und die Besatzung auszutauschen. Darüber hinaus sind sie durch ihre größere Schnelligkeit viel besser in der Lage, ihre Position rasch zu wechseln, was ihre Ortung erheblich erschwert. Sowohl das offizielle Sprachrohr der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh), die „Global Times“, als auch die „South China Morning Post“, die für gewöhnlich nicht stramm auf Regierungslinie liegt, veröffentlichten diese Woche Artikel, in denen sie glauben zu machen versuchten, dass die chinesische Marine weiterhin die Region dominiere und Australien sich politisch eher geschwächt habe. Ein Pfeifen im Walde – die vom Westen betriebene Eindämmungspolitik der chinesischen Aggression im Pazifik-Raum verfehlt ihre Wirkung ganz offensichtlich nicht.
Ein Weckruf sollte die Affäre allerdings für Europa und auch für Deutschland sein. Just an dem Tag (15. September), an dem die EU ein neues Strategiepapier zum Umgang mit China vorlegte, in dem unter anderem stand, man wolle mehr Einfluss im Indo-Pazifik und strebe daher auch verstärkte Marine-Einsätze an, wurde die Gründung von AUKUS bekannt. Zufall? Oder wollten die drei angelsächsischen Bündnispartner nicht doch demonstrieren, welche Bedeutung sie den Absichtserklärungen des europäischen Papiertigers beimessen?
Eins dürfte feststehen: Zieht Paris sich nicht in den Schmollwinkel zurück, werden sich die AUKUS-Staaten und Frankreich bald wieder einander annähern. Am Mittwoch wurde bekannt, dass US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schon für den Oktober ein persönliches Treffen geplant haben. Frankreich ist eben eine potente militärische Macht mit globalen Ambitionen – deren Engagement für die Eindämmung Chinas im Pazifik zwar nicht unverzichtbar, aber doch sehr willkommen ist (zur Erinnerung: die französischen U-Boote verfügen über Nuklear-Antrieb). Was das übrige Europa angeht? Und Deutschland? Ein müdes Lächeln wird um die Mundwinkel Joe Bidens und der anderen Staatenlenker ziehen …
Eins sollte in diesem Zusammenhang mit Blick auf Merkels baldigen Abtritt nicht unerwähnt bleiben: Die Kanzlerin hinterlässt ein europäisches Bündnis und ein Land, die auf dem globalen geopolitischen Schachbrett kaum eine Rolle spielen. Weltpolitik – die wird weder in Brüssel noch in Berlin gemacht. Welche Folgen das für eine Nation hat, die so sehr vom Außenhandel abhängt wie Deutschland, bedarf keines Kommentars.