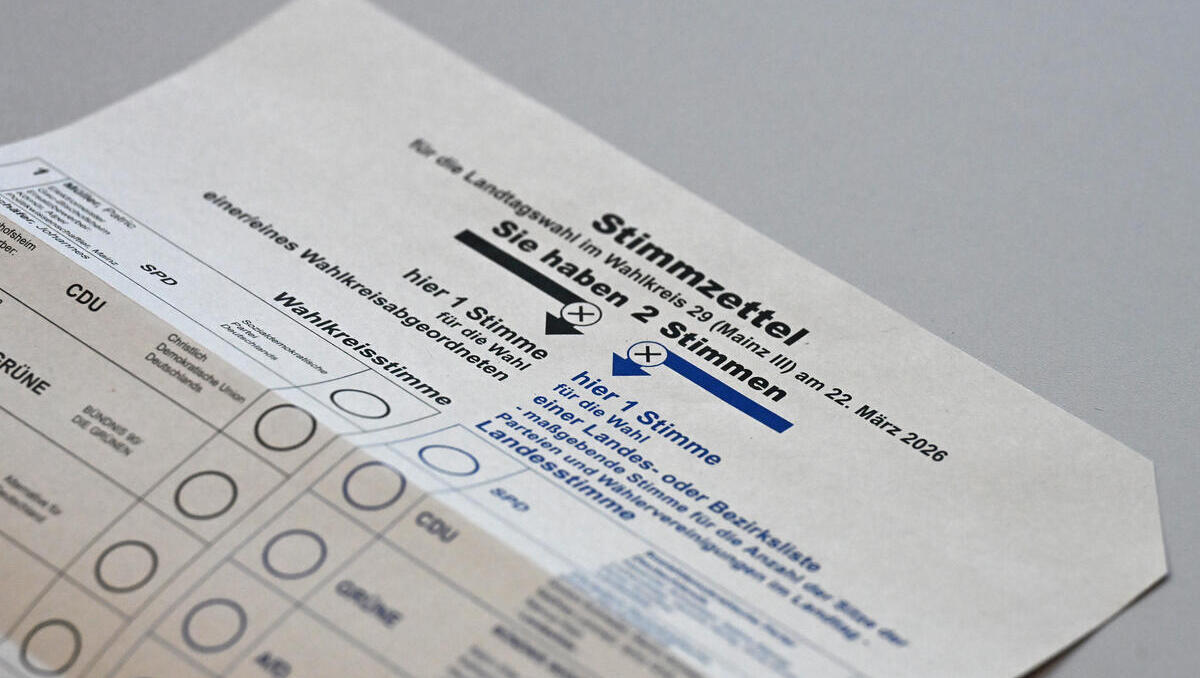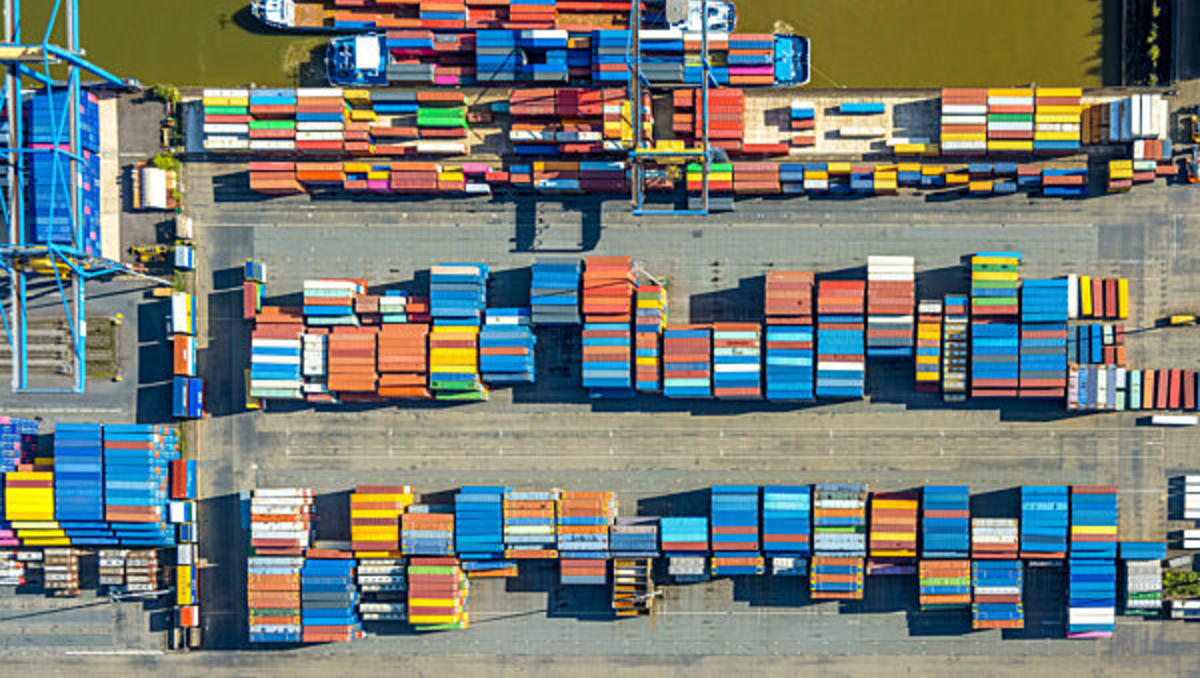Die Europäische Union hat eins ihrer wichtigsten Mitgliedsländer verloren: Großbritannien verfügt über ein Sechstel der Bevölkerung und Wirtschaftsleistung der EU. Ohne das Königreich wird die EU immer noch eine der weltweit größten Wirtschaftsräume sein, aber einen Teil ihrer Dynamik verlieren.
Allerdings gibt es immer noch Hoffnungen auf eine fruchtbares und kooperatives britisch-europäisches Verhältnis. Der erste Schritt besteht darin, über ein Handelsabkommen zu verhandeln. Sich aber zu sehr auf die Details dieser Gespräche zu fixieren, wäre ein Fehler. Der Handel ist für beide Seiten wichtig, aber die genauen Einzelheiten der britischen Handelsbeziehungen zu Europa werden das wirtschaftliche Schicksal des Landes nicht bestimmen. Am wahrscheinlichsten wird ein Abkommen sein, das Zölle für beide Seiten verhindert, aber sogar eine Rückkehr zu den Standardregeln der Welthandelsorganisation wäre nicht das Ende der Welt. Auch wenn ein besserer Deal in den nächsten zehn Jahren vielleicht den Verlust von ein paar BIP-Prozentpunkten verhindern könnte, sind andere Variablen wie die Qualität der Ausbildung, Investitionen und innerstaatliche Regulierung letztlich für das Wachstum wichtiger.
Auf jeden Fall ist die EU mehr als ein Markt. Sie verfügt über eine eigene Währung und hat in einem großen geographischen Gebiet die finanzpolitischen Grenzen abgeschafft. An diesen beiden Schlüsselbereichen hat sich das Königreich nicht beteiligt, und hätte dies zukünftig so bald auch nicht getan. So gesehen hat die EU lediglich „ein Drittel“ eines Mitglieds verloren. Das Verhältnis zu Großbritannien muss klug geplant werden. Aber Tatsache ist auch, dass die europäischen Politiker und Beamten dringendere Themen zu erledigen haben. Der Brexit ist jetzt ein Nebenschauplatz.
An der Spitze der EU-Prioritäten steht nun der Europäische Grüne Deal, an dem sich – angesichts der gemeinsamen Sorgen über das Klima – auch das Königreich weiterhin beteiligen könnte. Langfristig werden die beiden Partner aber verschiedene Richtungen einschlagen, da sich die EU bemühen wird, die Eurozone und das Schengen-Gebiet des dokumentfreien Reisens auszubauen.
Die Ökonomen werden weiter darüber diskutieren, ob der Euro jemals eine gute Idee war, und die Angelsachsen bleiben wohl bei ihrer Ansicht, „er darf nicht kommen, er ist keine gute Idee, er wird nicht überleben“. Die britische Skepsis schien durch die Eurokrise bestätigt zu werden. Trotzdem zeigen die Meinungsumfragen der letzten Jahre, dass sich die europäische Bevölkerung der akademischen Debatte voraus ist: Laut der letzten Zählung glauben fast 80 Prozent der Eurobarometer-Befragten, der Euro sei „gut für die EU“.
Für die jüngeren Generationen, die nie eine andere Währung gekannt haben, ist die Frage, ob sie eine neu eingeführte staatliche Währung bevorzugen, an sich schon absurd. Euroskeptische Parteien und Kandidaten, die explizit für einen Austritt aus der Eurozone eintreten, haben immer wieder Wahlen verloren, und dies nicht ohne Grund. Sogar ein Erzpopulist wie Matteo Salvini von der italienischen Liga hat sein ehemaliges „Kein-Euro“-Motto aufgegeben.
Eine ähnliche politische Dynamik betrifft das dokumentfreie Reisen. Das Schengen-Gebiet ist immer noch in Arbeit, aber die Entwicklungsrichtung ist klar: Anstatt die Reisefreiheit im Inneren zu begrenzen, verstärken die Mitgliedstaaten zunehmend die EU-Außengrenzen. Mit der Zeit wird dies den Wählern das Vertrauen geben, dass sie keine dauerhaften Kontrollen oder Grenzzäune zwischen den Mitgliedstaaten brauchen. Natürlich sind von der Flüchtlingskrise des Jahres 2016 immer noch einige interne Kontrollen übrig, aber dies sind Ausnahmen, die die Regel bestätigen. In den meisten Fällen können sich die Europäer über ungehindertes Reisen auf dem Kontinent freuen.
In Großbritannien werden diese Fortschritte als Teil des viel geschmähten Ziels einer „immer engeren Union“ abgetan, mit der die britischen Wähler noch nie einverstanden waren. Trotzdem wird die EU-Integration bei den verbleibenden 27 Mitgliedern weitergehen und weitere Projekte ins Leben rufen, die die Briten wahrscheinlich sowieso nicht unterstützt hätten. Das prägnanteste (und langfristigste) dieser Projekte ist die europäische Verteidigung. Ironischerweise hat Großbritannien während seiner EU-Mitgliedschaft die Vorschläge für eine gemeinsame Verteidigungstruppe immer abgelehnt. Jetzt hingegen, wo das Land allein steht, unterstützt es diese Idee, da dies die militärische Zusammenarbeit fördert.
Das Königreich hat sich bereits daran gewöhnt, bei der „besonderen Beziehung“ zu den USA die zweite Geige zu spielen, also könnte man annehmen, dass es auch gegenüber der EU ein ähnliches Verhältnis akzeptiert. In den meisten Fällen würde das Land unweigerlich der europäischen Führung folgen, während es gleichzeitig zu Hause ein Gefühl der kulturellen Überlegenheit pflegt. Die britischen Diplomanten wären in der Lage, ihre voreuropäische Tradition der Zurückhaltung zu pflegen und sich über die unpraktischen Programme der polyglotten Europäer erstaunt zu zeigen.
Natürlich muss sich die EU, damit eine solche Beziehung funktionieren kann, ernsthaft darum bemühen, die legitimen britischen Interessen zu berücksichtigen. Dazu muss sie einige schlechte Angewohnheiten überwinden. In ihrem Umgang mit anderen Nachbarn wie den baltischen Staaten oder sogar Norwegen und der Schweiz neigt die EU dazu, sich als anerkannter Hegemon zu verhalten, der häufig eine Position des „nimm es oder lass es“ bezieht. Natürlich spricht die relative Größe der EU in wirtschaftlicher Hinsicht für sich. Aber in einigen Bereichen, wo die EU – ganz zu schweigen von ihren einzelnen Mitgliedern – nur begrenzte Kapazitäten hat, ist Großbritannien stärker, nicht zuletzt bei der Sicherheit und den Geheimdiensten.
Angesichts dessen sollte die EU im Zuge der Handelsgespräche, die im März beginnen, ihren wirtschaftlichen Vorteil nicht zu sehr ausnutzen. Dann könnte der Brexit langfristig zu einer produktiven besonderen Beziehung führen, in deren Rahmen das Königreich ein enger Partner der EU bleiben und einen wertvollen Beitrag zu Frieden und Wohlstand Europas leisten könnte.
Aus dem Englischen von Harald Eckhoff
Daniel Gros ist Direktor des Centre for European Policy Studies.
Copyright: Project Syndicate, 2020.
www.project-syndicate.org