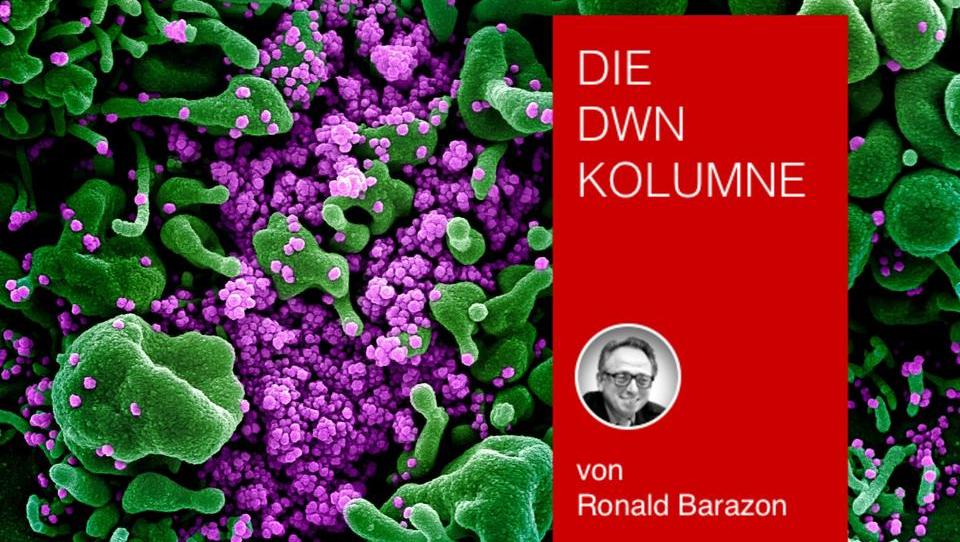Die wahre Krise im Gefolge der Corona-Maßnahmen kommt erst jetzt auf uns zu. In den nächsten Wochen und Monaten muss die Lage unweigerlich immer schlimmer werden. Und das in erster Linie, weil die Politik nicht fähig ist, mit dem Problem professionell umzugehen und einen Tsunami an verwirrenden, ständig sich ändernden Maßnahmen produziert, die nur für Verunsicherung sorgen.
Vor allem erweisen sich die Milliarden-Programme, die die Regierungen mit Hilfe der Europäischen Zentralbank umsetzen, als gigantische Gelddruckmaschinen, die die Wirtschaft nicht in Gang bringen und halten können, weil sie falsch konzipiert sind. Dabei hätten in der aktuellen Lage staatliche Aktionen tatsächlich eine zentrale Bedeutung. Kein Tag vergeht ohne Meldungen über die Kündigung von hunderten Mitarbeitern. Das ist aber nur der Anfang, die Kreditschutzverbände prophezeien bereits eine Pleitewelle. Die im Frühjahr großzügig gewährten Stundungen von Mieten, Kreditraten oder Steuern laufen nun aus und jetzt stehen die Betroffenen vor einem Schuldenberg, zusätzlich zu den laufenden Verpflichtungen, und kämpfen mit Einbußen im Gefolge der schlechten Wirtschaftslage.
Die Staaten und die EZB wollen die Krise mit Geld ersticken
Im Zentrum der Wirtschaft steht die Nachfrage. Ohne Nachfrage haben die Unternehmen nichts zu tun, kündigen Mitarbeiter und müssen letztlich schließen.
- In der Krise geht die private Nachfrage zurück, die Verbraucher sind verunsichert, drosseln den Konsum und sind bei langfristig wirkenden Ausgaben, wie etwa eine Renovierung der Wohnung, zurückhaltend.
- Die Unternehmen steigen daraufhin auf die Bremse und reduzieren die Investitionen.
- In einer derartigen Situation, wie sie auch im Gefolge der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie eingetreten ist, sollte der Staat einspringen: Staatliche Investitionen in die Infrastruktur und steuerliche Förderungen von Investitionen der Unternehmen können und müssen einen entscheidenden Beitrag zur Sicherung der Nachfrage und somit der Arbeitsplätze leisten.
Nun könnte man meinen, dass die riesigen Konjunkturprogramme der Staaten diesen Ansprüchen gerecht werden. Auch von dem grundsätzlich beschlossenen, aber von den Parlamenten noch nicht abgesegneten 750-Milliarden-Paket der EU-Kommission sollte man entsprechende Impulse erwarten. Das ist leider nur in sehr bescheidenem Umfang der Fall.
- Die Aktionen erweisen sich zum Großteil als Geldsegen, der über die Opfer der Krise ausgegossen wird. Diese Vorgangsweise ist momentan, beim Ausbruch der Krise, sicher hilfreich, aber auf Dauer gefährlich.
- Die Wirtschaft ist nur gesund, wenn das verfügbare Geld dem tatsächlichen Umsatz von Waren und Leistungen entspricht.
- Ist dies länger nicht der Fall, kommt es unweigerlich zur Geldentwertung, die das Vertrauen in die Währung erschüttert und in einer galoppierenden Inflation endet.
Der Geldverteilung müsste rasch ein Aufschwung folgen
Entscheidend ist, dass die Geldverteilung nur als Feuerwehraktion kurzfristig zum Einsatz kommt, um eine Panik zu vermeiden. Sehr rasch müssen dann der Konsum und die Investitionstätigkeit ein entsprechendes Volumen erreichen und so nachträglich die Feuerwehr-Geldschöpfung rechtfertigen. Dieser Moment wäre jetzt, im Herbst 2020 nach dem Lock-Down im Frühjahr 2020, gekommen. Davon ist aber nicht die Rede: Wie im Frühjahr steht die Bekämpfung des SARS-II-Virus im Mittelpunkt aller Aktivitäten, die letztlich eine Art „leichten“ oder „milden“ Lock-Down ergeben, der Konsumenten wie Investoren lähmt. Die derzeit reihenweise verfügten Reise-Warnungen bringen die lebenswichtige Mobilität zum Erliegen und verurteilen ganze Branchen zum Stillstand. Unter diesen Umständen bleibt die private Nachfrage noch länger aus.
Die Staaten könnten große Projekte realisieren, um die Nachfrage zu stützen
Somit wären die Staaten gefordert, im großen Stil zu investieren. Der Bedarf ist groß, die Infrastruktur ist in Europa beinahe überall verbesserungsfähig, vom Bildungs- und Ausbildungsbereich, dem Gesundheitswesen über die IT-Ausstattung bis hin zum Verkehr warten Milliarden-Investitionen, die es jetzt gilt zu realisieren. Entscheidend sind klare, definierte Projekte, die professionell gemanagt werden und nicht im Sumpf von Verzögerungen und Skandalen enden. Nur so können die Milliarden der Konjunktur-Programme die Konjunktur stützen.
Darüber hinaus müssten die Staaten deutlich mehr steuerliche Investitionsbegünstigungen bereitstellen als bisher. Das Motto hätte zu lauten „Wer investiert, zahlt keine oder wenig Steuern, wer nicht investiert, wird hoch besteuert!“ Dieses gesunde Prinzip wird nicht nur durch eine zu geringe Dotierung der Maßnahmen gebremst, die Auflagen werden immer komplizierter und behindern die Unternehmer bei ihren Entscheidungen. Besonders bedenklich ist die Tendenz, immer mehr Investitionen nicht über Steuererleichterungen zu begünstigen, sondern über Subventionen aus Brüssel zu fördern. Die Unternehmen sind dabei von der Gunst Brüsseler Beamten abhängig und können nicht frei agieren.
Wie falsch die Dinge laufen, lässt sich bereits an der Entwicklung der Kredite ablesen. Die Ausleihungen an Unternehmen im Euro-Raum sind seit dem Jahresanfang 2020 bis zum August um eindrucksvolle 50 Prozent angestiegen, doch kam es in den vergangenen Monaten zu einem dramatischen Rückgang der Investitionen. Das geborgte Geld, das zudem überwiegend durch staatliche Garantien abgesichert ist, wurde also zum Stopfen der im Gefolge des Lock-Downs entstandenen Löcher in der Kassa genützt.
In Europa wird generell zu wenig investiert, weil der Sozialstaat so teuer ist
Diese problematische Entwicklung ist vor dem Hintergrund der europäischen Wirtschaftsstruktur zu sehen. Im Euro-Raum wird generell zu wenig investiert, der Durchschnittswert liegt bei knapp 15 Prozent der Wirtschaftsleistung. Das können auch Länder wie Deutschland mit einer Investitionsquote von 21 Prozent oder Österreich mit 26 Prozent nicht ausgleichen. Europa wurde bereits vor Corona durch den Mangel an Investitionen im Wettlauf um die internationale Konkurrenzfähigkeit gebremst, jetzt herrscht eine weitgehende Lähmung.
Das strukturelle Problem ist eine Folge des in allen Euro-Staaten mehr oder weniger, aber doch überall üppig ausgebauten Sozialstaats. Die Einrichtungen verschlingen so viel Geld über Beiträge und Steuern, dass in der Folge für Investitionen wenig übrig bleibt. Jetzt geben die Staaten noch mehr Geld aus, um die Menschen und die Unternehmen vor den Folgen von Corona zu bewahren, bauen also einen weiteren Sozialstaat, der alle absichern soll. Wenn die Wirtschaft nicht in Gang kommt, werden immer weniger Unternehmen funktionieren, Arbeitnehmer beschäftigen und den Staat finanzieren. Dann wird die Krise zur totalen Katastrophe. Es dauert nicht lange, bis das eifrig gedruckte Geld diese zwingende Abfolge nicht mehr verdecken kann und das derzeit noch große Vertrauen in den Euro schwindet.
Der Staat sollte die Privathaushalte nicht im Stich lassen
Die wirtschaftliche Entwicklung hängt maßgeblich von der Stimmung in der Bevölkerung ab. Da hat der wochenlange Lock-Down bereits sehr großen Schaden angerichtet. Die Kurzarbeit ist zwar hilfreich, ist aber für alle ein eindeutiges Krisen-Signal. Die Kündigungswelle treibt die Arbeitslosigkeit in die Höhe. Die im Frühjahr gewährten Stundungen von Mieten, Kreditraten und Steuern laufen nun aus und jetzt sehen sich Viele einem angesammelten Schuldenberg gegenüber, der abgebaut werden muss. Und das zusätzlich zu den laufenden Zahlungen. Eine derartige Mehrbelastung ist schon in der Hochkonjunktur kaum zu bewältigen, in der aktuellen Situation bereiten die Stundungen den Weg zu vielen Privatkonkursen.
Bevor man tausende Privathaushalte in den Ruin treiben lässt, würde sich die Zahlung staatlicher nicht rückzahlbarer Zuschüsse empfehlen. Um die Bevölkerung vor einer Katastrophe zu bewahren, ist der Einsatz staatlicher Mittel sicher angebracht. In diesem Zusammenhang ist wohl anzumerken, dass die Staaten für Milliarden an Krediten haften, bei denen angesichts der aktuellen Entwicklung reihenweise Ausfälle schon jetzt abzusehen sind. Da werden die Staaten auch zahlen müssen.
Der Umgang mit Covid-19 sollte sich nicht von der in der Medizin üblichen Praxis unterscheiden
All das warum? Wegen einer Krankheit, die derzeit nur 0,08 Prozent der Weltbevölkerung ans Bett fesselt. Vor kurzem wurde eine Zahl zur Horrormeldung hochstilisiert - eine Million Tote, die vor ihrem Ableben auch Corona hatten – auch – denn die meisten litten bereits unter Vorerkrankungen und waren bereits sehr alt. Diese Relationen interessieren niemanden, jährlich sterben weltweit 60 Millionen Menschen. Die übliche, alljährliche Grippewelle verursacht bis zu 650.000 Todesfälle, zahllose Krankheiten vom Herzinfarkt über Diabetes bis zu TBC, COPD und Lungenkrebs erweisen sich als Massenkiller, doch nie finden weltweite Aktionen statt, die nur annähernd mit dem Einsatz gegen Covid-19 vergleichbar wären.
Aber wegen Covid-19 wird die Welt mutwillig in eine Katastrophe gestürzt. Mutwillig. Ein Arzt nach dem anderen traut sich das Problem auf den Punkt zu bringen.
Die Botschaften lauten:
- Versorgt die tatsächlich an Covid-19 erkrankten Personen, bringt sie bei Bedarf in ein Spital, handelt wie bei jeder anderen Krankheit auch, aber rasch, denn es kann im Ernstfall zu gravierenden Komplikationen kommen.
- Dass die meisten Fälle glimpflich verlaufen, darf nicht sorglos machen. Es besteht aber kein Anlass, die Gesamtbevölkerung in Panik zu versetzen.
- Die hunderttausenden Tests ergeben wenig Sinn: Die Infektion kann jederzeit stattfinden, der Test von gestern ist heute schon wertlos.
- Zehn oder vierzehn Tage Quarantäne mögen beruhigen, treffen aber nicht das Problem. Viren wohnen oft lange in einem Körper, lösen vielleicht nie eine Krankheit aus, vielleicht nach Jahren.
- Die Medizin hat die aktuell Kranken zu versorgen und hat zudem in den vergangenen Monaten bereits gelernt mit Covid-19 umzugehen. Die Gesunden sollten ihre Widerstandskraft stärken. Masken tragen, Abstand halten, die regelmäßige Hände-Desinfektion sind wertvolle Beiträge zur Minderung des Risikos.
- Gänzlich ausschließen kann man das Risiko nicht, auch nicht mit spektakulären Aktionen.
Genau das versucht aber die Politik mit totalen und teilweisen Lock-Downs, mit Reisewarnungen, mit der Gleichbehandlung von symptomlosen Infizierten und tatsächlich schwer erkrankten Personen. Diese Vorgangsweise entspricht der in allen Bereichen der Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik derzeit praktizierte Bekämpfung sämtlicher Risiken, die Sicherheit geben soll. Wie ein roter Faden zieht sich der Versuch, allen Gefahren aus dem Weg zu gehen, vor allem durch die von der EU-Kommission initiierten Regelungen. Beispielhaft sei daran erinnert, dass man den risikolosen Kredit durchsetzen will und nicht akzeptiert, dass das Risiko zum Wesen jeder Finanzierung gehört. Die Versicherungen, deren Aufgabe darin besteht, Risiko zu übernehmen, sollen möglichst risikofrei arbeiten. Die Liste der Risiko-Bekämpfungen ist lang. Und nie will man in Brüssel zur Kenntnis nehmen, dass es kein Leben ohne Risiko gibt, dass ohne Risiko, ohne Misserfolge, ohne Rückschläge keine Entwicklung und folglich kein Erfolg möglich sind. Erforderlich ist nicht die totale Vermeidung des Risikos, diese ist nicht zu schaffen, sondern ein kluges und sachliches Management des Risikos.