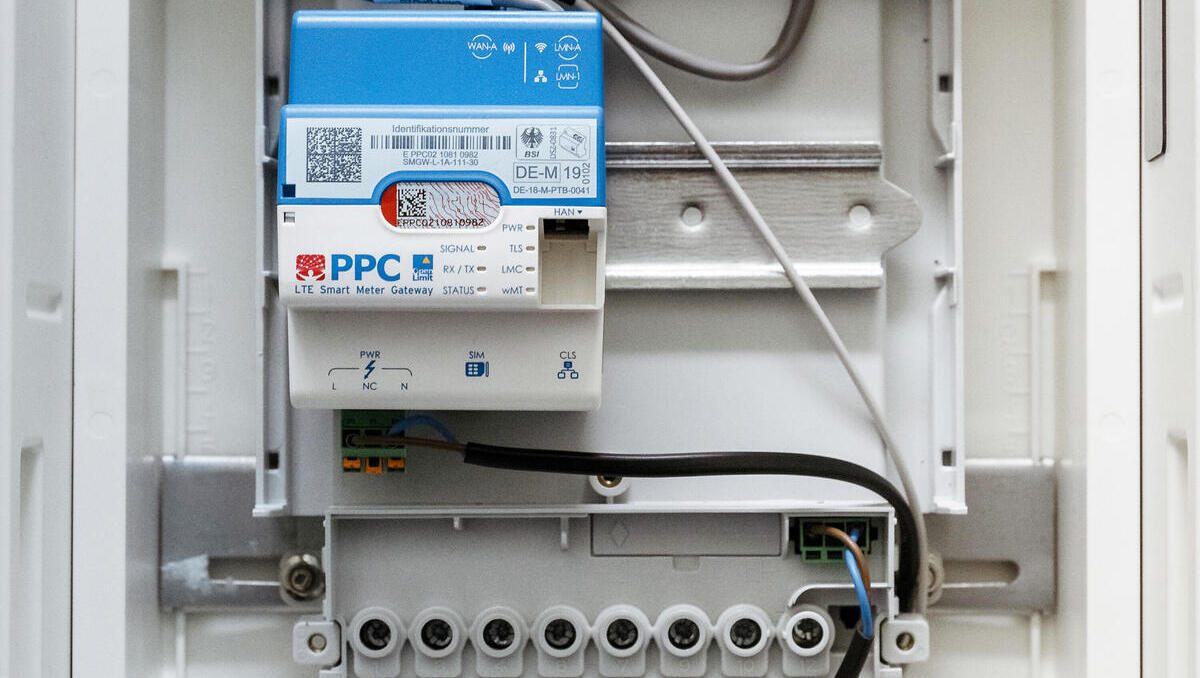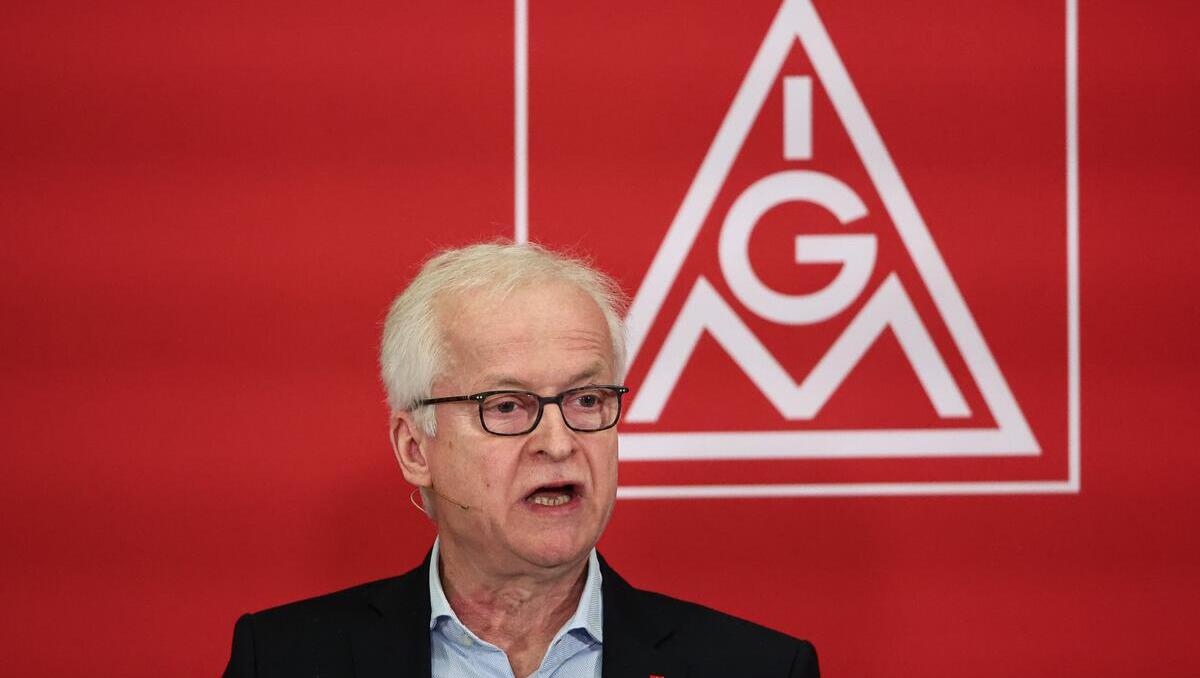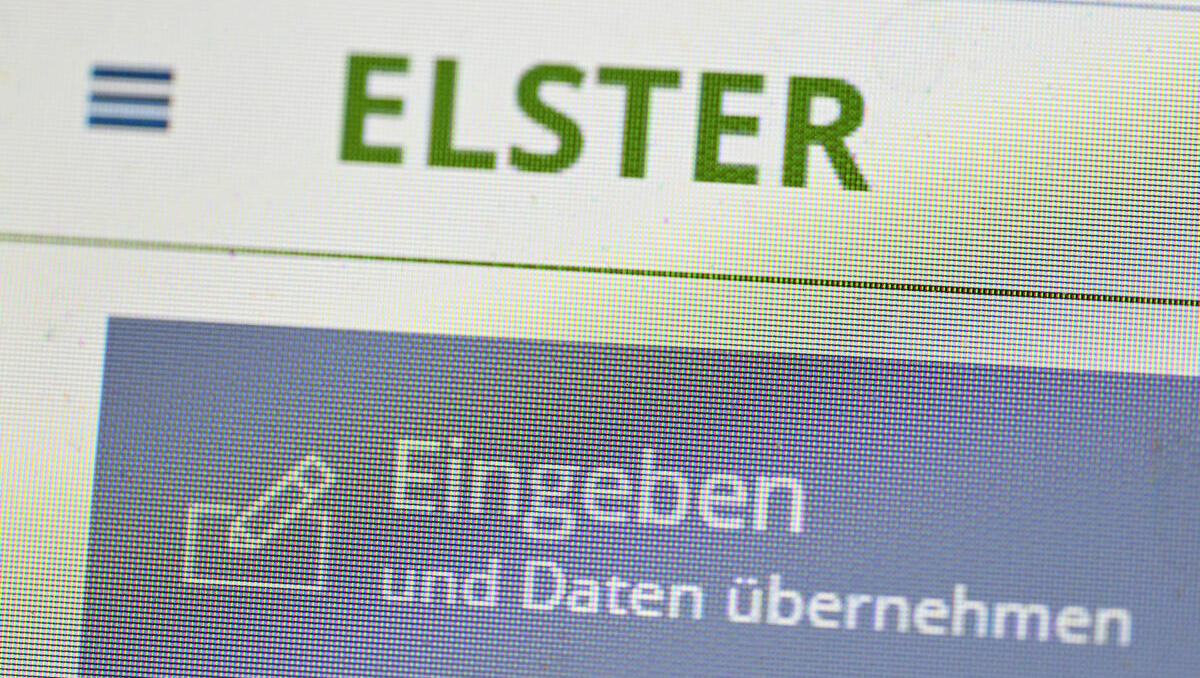Der erste Satellit der Welt war der Sputnik, den die Sowjetunion am 4. Oktober 1957 ins All schoss. Der Start dieser Raumsonde von der Größe eines Volleyballs markierte den Beginn eines über Jahrzehnte andauernden teuren Wettlaufs zwischen Sowjets und Amerikanern um die Vorherrschaft im Weltraum. Nur knapp vier Monate später, am 31. Januar 1958, starteten auch die USA mit dem Explorer 1 den ersten amerikanischen Satelliten.
Erst im Laufe der Zeit begannen auch andere Länder, ihre eigenen Satelliten in den Weltraum zu schicken. Denn es zeigte sich immer mehr, dass Satelliten nicht nur Prestige verschaffen können, sondern auch einen echten militärischen und vor allem einen wirtschaftlichen Nutzen haben. So konnten Satelliten etwa die Wettervorhersagen und überhaupt die Beobachtung der Erdoberfläche immer weiter verbessern. Telekommunikationssatelliten ermöglichten Ferngespräche und später Live-Fernsehübertragungen aus aller Welt. Heute unterstützen Satelliten auch das Internet.
Da Computer und andere Geräte im Verlauf der letzten Jahrzehnte immer kleiner geworden sind, reichen heute für viele Zwecke deutlich kleinere Satelliten. Unternehmen und Universitäten stellen jetzt in der Regel würfelförmige Satelliten her, die dann in erdnahen Umlaufbahnen zum Einsatz kommen. Diese können von einer Rakete ins All mitgenommen werden, oder sie werden auf der Internationalen Raumstation ISS mit einer mobilen Trägerrakete gestartet. Die ständig bemannte ISS ist heute der größte Satellit.
Warum stürzen Satelliten nicht auf die Erde ab?
Jeder Satellit besteht aus vier Hauptbestandteilen: (i) einem Energiesystem, das zum Beispiel solar oder nuklear sein kann, (ii) einer Möglichkeit zur Steuerung seiner Lage, (iii) einer Antenne zum Senden und Empfangen von Informationen und (iv) einer Nutzlast zum Sammeln von Informationen, dies kann zum Beispiel eine Kamera oder ein Teilchendetektor sein.
Um nicht abzustürzen, muss ein Satellit die Schwerkraft zur Erde überwinden. Dazu bedarf es der sogenannten Kreisbahngeschwindigkeit, die an der Grenze der Erdatmosphäre in 180 Kilometer Höhe rund 7,8 Kilometer pro Sekunde beträgt (rund 28.000 Kilometer pro Stunde). Wenn ein Satellit mit dieser Geschwindigkeit parallel zur Erdoberfläche fliegt, so bewirkt die Erdkrümmung, dass er seine Höhe beibehält und um die Erde herumfliegt.
Es gibt mehrere offizielle Zonen von Umlaufbahnen um die Erde. Eine davon ist die sogenannte erdnahe Umlaufbahn, die sich von etwa 160 bis 2.000 Kilometer erstreckt. Dies ist die Zone, in der die Internationale Raumstation ISS ihre Bahnen zieht. Alle bemannten Raumflüge mit Ausnahme der Apollo-Flüge zum Mond fanden in dieser Zone statt. Auch die meisten Satelliten werden in dieser Zone betrieben.
Der beste Ort für Kommunikationssatelliten ist jedoch die geostationäre oder geosynchrone Umlaufbahn in einer Höhe von 35.786 Kilometern über dem Erdäquator. In dieser Höhe ist die Erdrotation etwa gleich der Kreisbahngeschwindigkeit, wodurch der Satellit ständig über demselben Punkt der Erde bleibt. Der Satellit steht somit in ständiger Verbindung mit einer festen Antenne am Boden, was eine zuverlässige Kommunikation ermöglicht. Wenn geostationäre Satelliten das Ende ihrer Betriebsdauer erreicht haben, so müssen sie aus dieser relativ schmalen Zone entfernt werden, damit dort ein neuer Satellit störungsfrei arbeiten kann.
Während einige Satelliten am sinnvollsten rund um den Äquator eingesetzt werden, empfehlen sich andere eher für polare Umlaufbahnen, umkreisen also mit anderen Worten die Erde, indem sie Nordpol und Südpol überfliegen. Beispiele für polarumlaufende Satelliten sind Wettersatelliten und Aufklärungssatelliten.
Bereits im Jahr 2016 waren mehr als 1.400 aktive Satelliten bekannt. Darüber hinaus befinden sich viele Tausend weitere Objekte wie ausgediente Satelliten, Teile von Raketen und anderer Weltraummüll im Erdumlauf. Durch die wachsende Menge an Weltraumschrott steigt auch die Wahrscheinlichkeit einer Kollision. Bei der ersten bekannten Kollision eines aktiven Satelliten mit einem ausgedienten Objekt wurden am 10. Februar 2009 sowohl der US-Kommunikationssatellit Iridium 33 als auch der ausgediente russische Satellit Kosmos 2251 vollständig zerstört.
Wegen drohender Kollisionen müssen die Raumfahrtbehörden heute, wenn sie etwas ins All schießen wollen, die entsprechenden Flugbahnen sorgfältig abschätzen. Agenturen wie das Weltraumüberwachungsnetz der USA behalten den Weltraumschrott vom Boden aus im Auge und alarmieren die NASA und andere Einrichtungen, wenn die Gefahr besteht, dass ein fehlgeleitetes Objekt mit einem wichtigen Satelliten kollidieren könnte. Auch die Raumstation ISS muss von Zeit zu Zeit Ausweichmanöver durchführen.
Was geschieht, wenn Satelliten im großen Stil ausfallen?
Einer der größten Verursacher von Weltraummüll war ein Test zur Zerstörung von Satelliten, den die Chinesen im Jahr 2007 durchführten. Die Trümmer zerstörten sechs Jahre später einen russischen Satelliten. Die NASA, die Europäische Weltraumorganisation (ESA) und andere Institutionen erwägen Maßnahmen, um die Menge an Trümmern im Orbit zu reduzieren. So wird vorgeschlagen, ausgediente Satelliten wieder aufzutanken oder sie auf verschiedene Weisen von ihrer Laufbahn abzubringen, sodass sie abstürzen.
Die gezielte Zerstörung von Satelliten oder zumindest die gezielte Behinderung ihres Betriebs ist auch für das Militär von großem Interesse, da dies ein mächtiges Mittel der Kriegsführung darstellen könnte. Denn ohne die notwendigen Satelliten wird nicht nur ein erheblicher Teil der Weltwirtschaft lahmgelegt, auch die militärische Infrastruktur wäre stark beeinträchtigt. Funktionieren würden dann im Wesentlichen nur noch die Technologien aus der Zeit des Vietnamkriegs – nur dass die Armeen diese überholten Technologien zu großen Teilen ersetzt haben.
Ohne Satelliten müssten internationale Anrufe und der gesamte Datenverkehr auf die terrestrischen und unterseeischen Leitungen umgeleitet werden. Dies würde die Systeme bis an die Grenze ihrer Kapazität auslasten, viele Anrufe könnten nicht mehr durchgestellt werden, Internetverbindungen würden stark eingeschränkt werden oder ganz abbrechen, Mobiltelefone würden unbrauchbar. In abgelegenen Gebieten gäbe es kein Fernsehen mehr, kein Internet und kein Radio. Ohne GPS und Kommunikationssatelliten müssten Flugzeuge und Schiffe wieder nach Radar, Karte und Sicht navigieren. Die Fluglotsen hätten enorme Schwierigkeiten, die vielen Flugzeuge sicher zu leiten.
Neben der Positionsbestimmung liefert GPS auch Daten für die Zeitplanung. Es wird zunehmend eingesetzt, um über Satelliten einen universalen Zeitstandard zu verbreiten. Innerhalb weniger Stunden nach dem Zusammenbruch gäbe es Abweichungen innerhalb des Systems, was zu Problemen oder sogar zu Unterbrechungen zahlreicher Dienste führen würde, etwa des Stromnetzes. Auch das Bankwesen, wo der Zeitpunkt von Transaktionen aufgezeichnet werden muss, wäre betroffen. Kreditkartenzahlungen und Bankkonten könnten einfrieren. Ein Finanzcrash wäre nicht ausgeschlossen.
Die Entwicklung von Anit-Satelliten-Systemen
Offenbar hat China bei der Entwicklung von Raketen und elektronischen Waffen zum Einsatz gegen Satelliten gute Fortschritte gemacht. Dies sagt zumindest das Pentagon in einem aktuellen Bericht an den US-Kongress. Demnach verfügt China bereits über bodengestützte Raketen, die gegen Satelliten in niedriger Erdumlaufbahn eingesetzt werden können. Zudem beabsichtige das Land wahrscheinlich, zusätzliche Waffen zu entwickeln, die Satelliten bis hinauf zur geosynchronen Erdumlaufbahn zerstören können. Chinas Militärstrategen betrachten die Fähigkeit, weltraumgestützte Systeme ausschalten zu können, als zentral für die moderne Kriegsführung, heißt es in dem Bericht.
China selbst hat sich nicht mehr öffentlich zu seinen Waffenprogrammen gegen Satelliten geäußert, seit es im Jahr 2007 bestätigte, dass es eine Rakete zur Zerstörung eines Wettersatelliten eingesetzt hatte. Doch das Land hat seitdem stetig Fortschritte gemacht, heißt es in dem Bericht. Entwickelt wurden etwa Raketen, bodengestützte Laserwaffen, Weltraumroboter und ein System zur Überwachung von Objekten – auf der ganzen Welt und im Weltraum. Auch elektronische Waffen wie Satellitenstörsender, Cyber-Fähigkeiten und Waffen mit gelenkter Energie gehören zu Chinas Arsenal.
Gemäß Chinas militärischer Strategie sollen gegnerische Satelliten bei Bedarf gezielt zerstört werden, um „den Feind zu blenden und zu betäuben“, heißt es in dem Pentagon-Bericht. Auch in anderen Bereichen baue China seine Fähigkeiten aus: bei Satelliten, Trägerraketen, Sensoren und Mondsystemen. Sie alle sollen dazu beitragen, Chinas langfristiges Ziel zu erreichen, die mächtigste Weltraummacht der Welt zu werden.