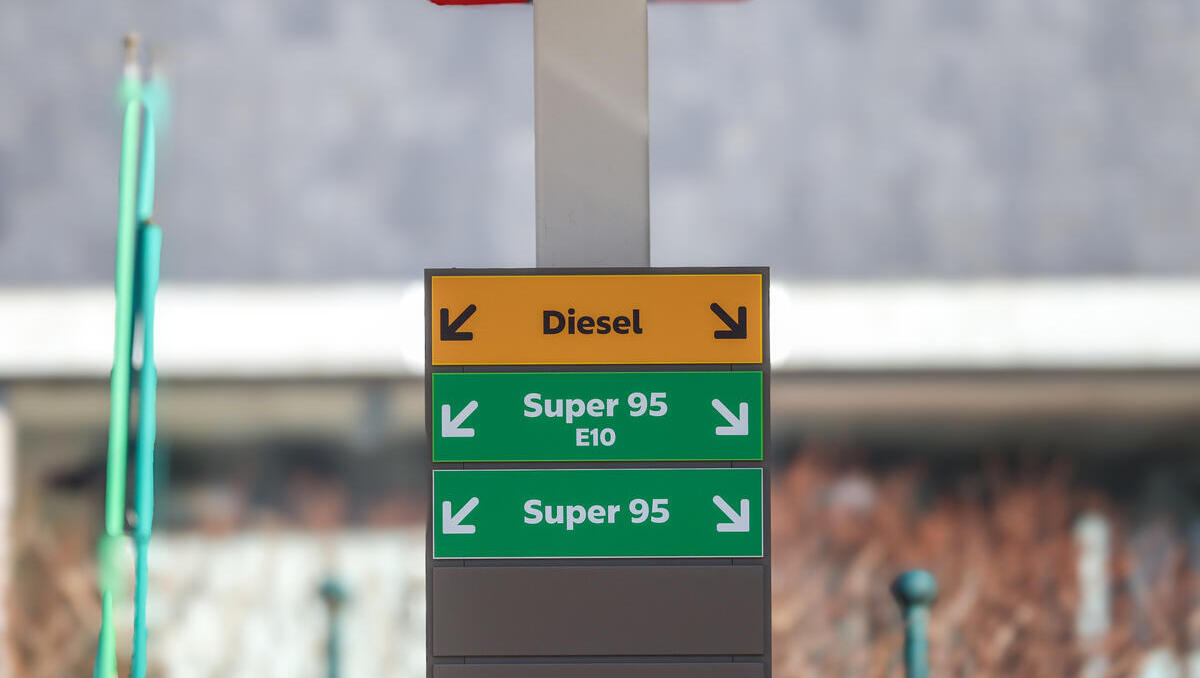Insolvenzen sind ein natürlicher Bestandteil des Wirtschaftsgeschehens. Unternehmen mit überholten Geschäftsmodellen müssen weichen und machen innovativeren Unternehmen Platz. Insolvenzen sind sogar ein notwendiger Bestandteil, um eine Wirtschaft zu erneuern und konkurrenzfähig zu halten. Der Ökonom Josef Schumpeter nannte das „schöpferische Zerstörung“. Das Insolvenzgeschehen gilt zudem als wichtiger Gradmesser für den Zustand der Wirtschaft.
Mitte Dezember meldeten verschiedene Medien, dass es 2020 in Deutschland so wenige Insolvenzen gegeben habe wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und das, obwohl die Wirtschaft während der Wochen des ersten Lockdowns nur im Notbetrieb arbeitete, die Werke der Autoindustrie teilweise stillstanden und ganze Branchen (Messe, Luftfahrt, Tourismus, Kultur, Gastronomie) noch immer ohne Perspektive dastehen. Weniger Insolvenzen als im Vorjahr, obwohl Wirtschaftsforscher wie das Kieler Institut für Weltwirtschaft (ifw) mit einem Einbruch der deutschen Wirtschaft um 7 Prozent für 2020 rechnen. Wie passt das zusammen?
Schäden durch Insolvenzen 2020 so hoch wie nie
Der Schein trügt, wie die Daten der Wirtschaftsauskunftei Creditreform zeigen. Demnach sind 2020 zwei Trends zu beobachten: Mehr Insolvenzen bei Konzernen, dafür deutlich weniger Insolvenzen bei kleinen und mittelständischen Unternehmen. Besonders betroffen von Insolvenzverfahren waren Großunternehmen mit Millionenumsatz. Sowohl in den Umsatzklassen 5 bis 25 Millionen Euro (plus 26,4 Prozent) und 25 bis 50 Millionen (plus 36,4 Prozent), als auch bei Unternehmen mit mehr als 50 Millionen Euro Jahresumsatz (plus 50 Prozent) waren deutlich mehr Insolvenzverfahren zu verzeichnen. Entsprechend hoch lag der verursachte Schaden, 34 Milliarden Euro offener Forderungen gegenüber 23,5 Milliarden Euro im Vorjahr. Durchschnittlich wurde durch eine Insolvenz 2020 ein Schaden von 2,1 Millionen Euro verursacht – und damit etwa doppelt soviel wie im Vorjahr und fast dreimal soviel wie 2018.
Die Corona-Pandemie traf die meisten Konzerne vollkommen unvorbereitet. Nehmen wir den Tourismuskonzern TUI als Beispiel. Anfang 2020 verkündete das Unternehmen noch neue Rekorde bei Buchungen und Umsatz. Dann wurden im Zuge der Pandemie europäische Grenzen geschlossen und der Reisekonzern musste Staatshilfe beantragen, um der Insolvenz zu entgehen. Ähnlich erging es der Lufthansa, die sich nur mit staatlichen Milliardenkrediten über Wasser halten konnte. Das Luftfahrtunternehmen mit dem Kranich im Logo steht sinnbildlich für eine ganze Branche, die um den Verlust zehntausender Arbeitsplätze bangt.
Düster sieht es auch für den Handel aus, der schon in Folge des ersten Lockdowns vermehrte Insolvenzen zu beklagen hatte. Da wäre etwa Galeria Karstadt Kaufhof. Die Kaufhauskette war schon vor Ausbruch der Pandemie in Schieflage geraten und musste im Frühjahr 2020 ins Schutzschirmverfahren. Zwar sind Teile des Konzerns wieder aus dem Insolvenzverfahren raus, doch angesichts des zweiten Lockdowns ist die Zukunft der 28.000 Mitarbeiter weiterhin ungewiss. Im Modeeinzelhandel traf es mit Esprit und Bonita ebenfalls zwei Großunternehmen. Der Damenmodehändler Bonita kündigte inzwischen an, jede dritte der insgsamt 600 Filialen schließen zu müssen. Die Gläubiger des Modekonzerns Esprit mussten einem radikalen Schuldenschnitt zustimmen, um das Unternehmen vor dem endgültigen Aus zu bewahren.
Regierung verschleppt drohende Pleitewelle im Mittelstand
Die Liste der Großinsolvenzen ließe sich noch eine Weile weiter führen: Der Zahlungsdienstleister Wirecard, die Restaurantkette Vapiano, die Friseurkette Klier, der Gerry-Weber-Ableger Hallhuber und die Muttergesellschaft der deutschen Pimkie-Filialen. Sie alle sind 2020 aus verschiedenen Gründen ins Insolvenzverfahren gerutscht. Doch das ändert nichts an dem überraschenden Rückgang der Insolvenzen insgesamt. Laut Prognosen von Creditreform werden die Insolvenzen für 2020 um 13 Prozent zurückgehen – und damit auf den niedrigsten Stand seit Einführung der Insolvenzverordnung 1999. Woran liegt das?
„Im laufenden Jahr hat sich das Insolvenzgeschehen als Seismograph für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung vom wirklichen Zustand der deutschen Unternehmen entkoppelt“, sagt Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Wirtschaftsforschung bei Creditreform. Der Hauptgrund dieser Entkopplung liegt in den immensen staatlichen Ausgaben zur Bekämpfung der Pandemie. Laut Angaben des Bundesfinanzministeriums wurden 2020 allein 156 Milliarden Euro in Corona-Hilfspakete investiert. Darunter waren etwa Mehrausgaben beim Kurzarbeitergeld, Einmalzahlungen für Selbstständige und Unternehmer, denen durch die Lockdowns der Umsatz weggebrochen war, sowie staatliche Notfallkredite für kleine und mittelständische Unternehmen.
Durch diese Hilfsgelder haben sich viele Unternehmen wertvolle Zeit erkauft. Doch die Notkredite müssen zurückgezahlt werden und so manche Branche weiß noch gar nicht, woher das Geld für die Kredittilgung kommen soll. Es handelt sich also nur um Übergangslösungen. Problematisch ist auch, dass durch die Staatshilfen sehr viele Unternehmen am Markt bleiben, die unabhängig von der Corona-Krise eigentlich nicht mehr überlebensfähig sind. Sie waren schon vorher in Schieflage geraten, weil ihre Geschäftsmodelle strukturelle Schwächen aufweisen.
Ein anderer wichtiger Grund für den Rückgang der Insolvenzen liegt in der Aufweichung des Insolvenzrechts. Schon nach der Finanzkrise 2008 wurde der Tatbestand der Überschuldung vorübergehend ausgesetzt, um massenhafte Insolvenzen zu vermeiden. Seitdem ist nicht länger die Überschuldung, sondern die Zahlungsunfähigkeit Auslöser einer Insolvenz. Eine Rückkehr zur alten Insolvenzordnung fand nie statt – im Gegenteil.
Im Zuge der Pandemie hat die Bundesregierung die Insolvenzantragspflicht sogar ausgesetzt, um eine mögliche Pleitewelle hinauszuschieben. So mussten Unternehmen zwischen dem 1. März und dem 30. September 2020 keinen Insolvenzantrag stellen, wenn sie überschuldet oder vorübergehend zahlungsunfähig waren. Erst im Oktober 2020 trat wieder die Insolvenzantragspflicht für zahlungsunfähige Unternehmen und ab dem 31. Januar 2021 auch wieder für überschuldete Unternehmen in Kraft.
2021 rollt eine Insolvenzwelle auf Deutschland zu
Durch die vorrübergehende Aussetzung der Antragspflicht wurde eine Pleitewelle kleiner und mittlerer Unternehmen verzögert. Diese Unternehmen sind immerhin für 65 Prozent aller Insolvenzen verantwortlich. Hier werden überwiegend Fremdanträge durch Sozialversicherungsträger oder das Finanzamt gestellt. Zwischen März und Juni blieben diese Insolvenzanträge komplett aus und danach wurden sie nur zögerlich gestellt. Die Probleme der betroffenen Unternehmen sind seither aber nicht auf magische Weise verschwunden.
„Die deutsche Wirtschaft schiebt seit Monaten eine Welle von Insolvenzen vor sich her“, sagte Thomas Langen vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) gegenüber der Tagesschau. „Erst wenn ab Januar sowohl überschuldete als auch zahlungsunfähige Unternehmen wieder einen Insolvenzantrag stellen müssen, werden wir erkennen, wie groß dieser Anstieg ist und welche wirtschaftlichen Verwerfungen die Corona-Pandemie tatsächlich angerichtet hat.“
Für Langen ist klar, dass „die Welle bald brechen wird.“ Auch andere Marktbeobachter erwarten einen Anstieg der Insolvenzen für 2021. Die Bundesvereinigung Kreditankauf und Servicing (BKS) erwartet, dass die Zahl der Insolvenzen von derzeit circa 4500 pro Quartal dann auf 6000 bis 7000 pro Vierteljahr in die Höhe schnellt. Ähnlich sehen es die Analysten von Creditreform. Nachdem die Insolvenzanzeigepflicht wieder in Kraft ist, dürften die Auswirkungen der Wirtschaftskrise und ein Ende der Eindämmungsmaßnahmen die Insolvenzen in diesem Jahr wieder steigen lassen. Das werde sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen betreffen.
„Wir gehen davon aus, dass wir schon im kommenden Jahr bis zu 110.000 Privatinsolvenzen verzeichnen könnten“, sagte Creditreform-Geschäftsführer Ulbricht der Neuen Osnabrücker Zeitung. Zuletzt lag die Zahl zur Zeit der Finanzkrise so hoch. Im Vergleich zu den Erwartungen in diesem Jahr wäre es fast eine Verdopplung: Für 2020 rechnet die Wirtschaftsauskunftei mit knapp 61.000 Privatinsolvenzen. Was die Unternehmen betrifft, sei mit dem Höhepunkt der Insolvenzwelle für das erste Quartal 2021 zu rechnen. Aufs ganze Jahr geht Ulbricht von „24.000 Firmenpleiten und mehr“ aus. Das wäre ein Anstieg von über 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (18.000).
Die Auswirkungen könnten nicht nur auf angeschlagene Unternehmen begrenzt sein. Schon jetzt herrscht bei manchen Zulieferern durch das verhängte Insolvenzmoratorium große Unsicherheit, ob die Geschäftspartner überhaupt noch zahlungsfähig sind. Sie beliefern in gutem Glauben weiter, ohne etwas von der drohenden Insolvenz des Geschäftspartners zu ahnen. Wenn die Insolvenzanträge dann vermehrt eintreffen, dürfte auch so manches gesunde Unternehmen auf offenen Rechnungen sitzen bleiben und mit in den Strudel gezogen werden.
Auch für den Bankensektor dürfte die drohende Pleitewelle negative Konsequenzen haben. Die Banken sind den Risiken der Unternehmen über Kredite, Anleihen und daraus entwickelte Derivate direkt ausgesetzt. Sollten sich die Insolvenzen häufen, könnten die Banken gezwungen sein, Abschreibungen auf ihr Eigenkapital vorzunehmen. Die Europäische Bankenaufsicht (EBA) warnte bereits vor steigenden Risiken in Bankbilanzen. So sei das Volumen ausfallgefährdeter Darlehen im zweiten Quartal 2020 unter den 135 untersuchten Banken nach jahrelangen Rückgängen erstmals wieder gestiegen.