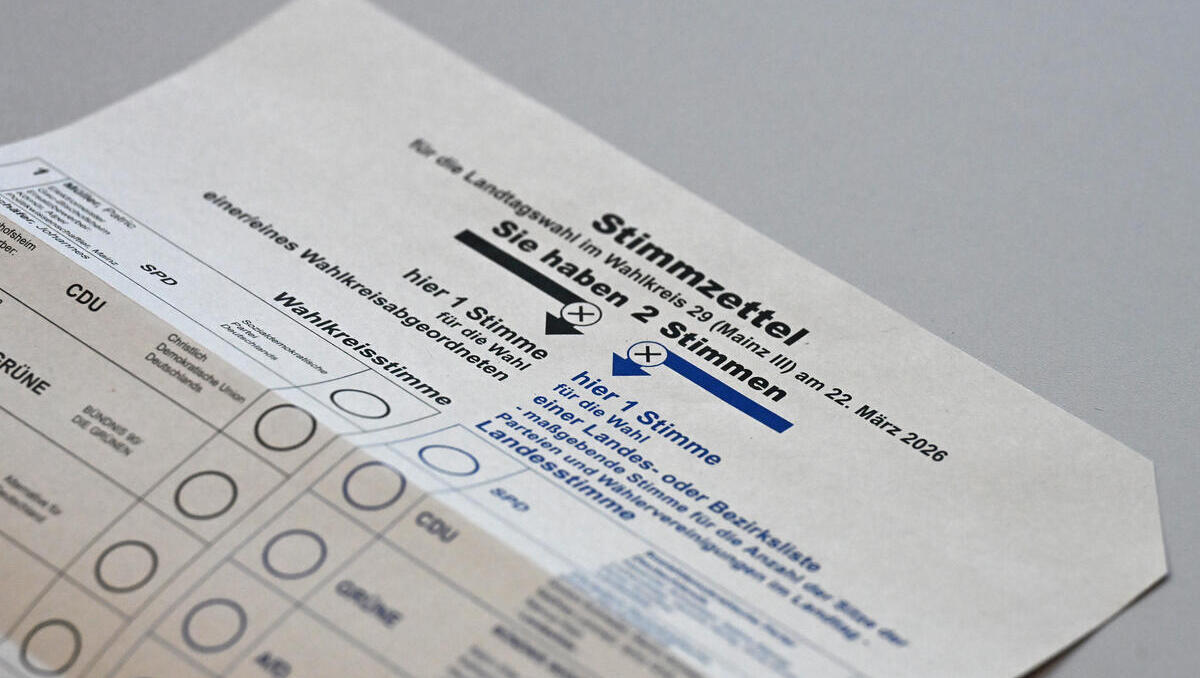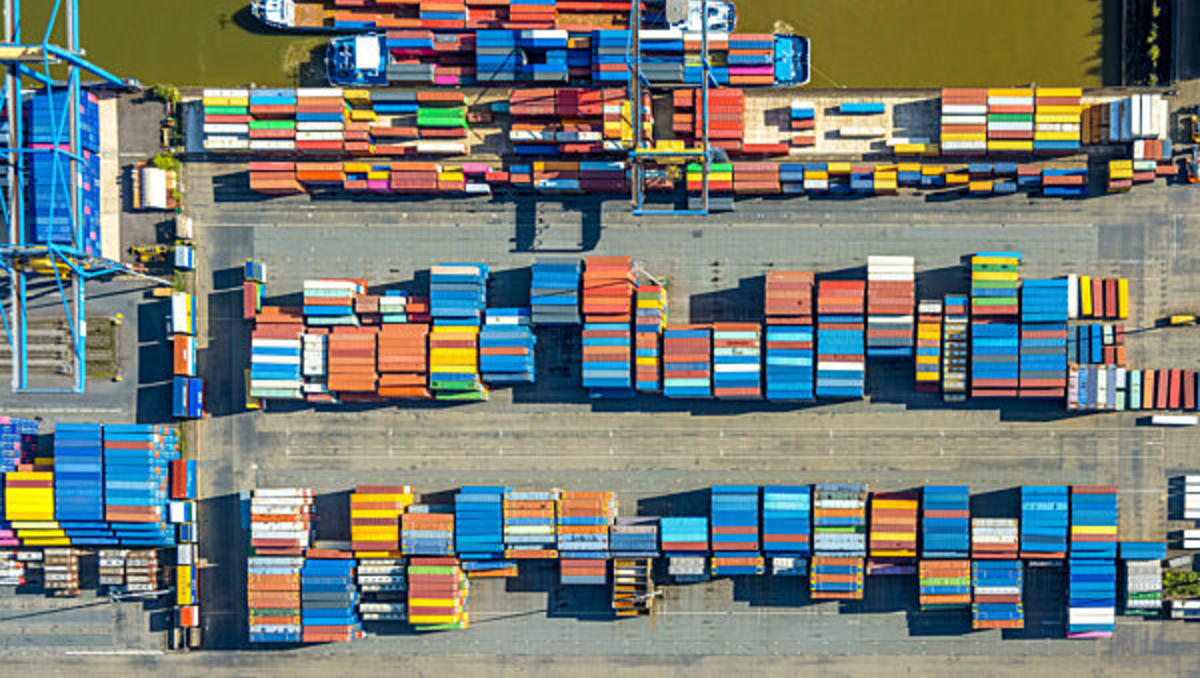Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Die Bundesrepublik Deutschland erwirtschaftet gewaltige Exportüberschüsse. Woran liegt das?
Andreas Nölke: Deutschland hat eine im internationalen Vergleich sehr ungewöhnliche Wirtschaftsstruktur: Die Bundesrepublik ist von Exporten viel stärker abhängig als jede andere große Volkswirtschaft. Damit ist die deutsche Wirtschaft zwar in Bezug auf die Reduktion von Arbeitslosigkeit vorübergehend recht erfolgreich gewesen, langfristig ist das aber ein sehr riskantes Wirtschaftsmodell – und auch jetzt schon bringt es für viele Menschen erhebliche Nachteile mit sich.
Das Problem eines stark export-lastigen Wachstumsmodells liegt für große Teile der Bevölkerung darin, dass für den massenhaften Export preissensibler Güter eine spürbare Lohnmäßigung sowie fiskalische Austerität notwendig sind. Wobei das Beharren auf diesen beiden Grundsätzen – Lohnmäßigung und Austerität – wiederum zu einer schwachen Binnennachfrage führt, zum Nachteil von Branchen wie Handel und Dienstleistung.
Die „krankhafte“ Veränderung der deutschen Wirtschaft hin zu einem extremen Exportmodell begann in den ökonomischen Krisensituationen der letzten 45 Jahre – vor allem die Wirtschaftskrisen der späten 1970er sowie der „Nachwende-Kater“ der späten 1990er. Nachhaltig vertieft wurde sie (die Veränderung) dann in der Finanzkrise und in der Euro-Krise. Es steht zu befürchten, dass die wirtschaftlichen Nachwehen der Corona-Pandemie mit derselben problematischen Droge – Lohnmäßigung und staatliche Einsparungen – bekämpft werden sollen wie in den letzten Krisen und damit die Misere weiter vergrößern.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Übergroße Exportüberschüsse können also keine Grundlage für ein nachhaltiges Wirtschaftsmodell sein?
Andreas Nölke: Nein, das ist viel zu riskant. Die Risiken der Exportabhängigkeit werden insbesondere in Phasen deutlich, die von internationalen politischen Turbulenzen gekennzeichnet sind. So eine Phase erleben wir derzeit: Wir haben den Brexit, die handelspolitischen Spannungen mit der amerikanischen Regierung und den beginnenden Systemkonflikt zwischen China und den USA. Nicht zuletzt der Corona-Ausbruch hat zudem die Risiken einer extrem ausgeprägten internationalen Arbeitsteilung mehr als deutlich gemacht.
Eine ausgeprägte Exportorientierung, wie sie die deutschen Wirtschaft derzeit ihr Eigen nennt, führt aber nicht nur in Zeiten internationaler Turbulenzen zu erheblichen Nachteilen, sondern bereits in ruhigen Phasen. Deutschland sitzt bereits seit Jahren permanent auf der Anklagebank internationaler Organisationen und ausländischer Regierungen, da seine Wirtschaft durch die hohen Exportüberschüsse andere Ökonomien unterminiert. Aber auch viele Menschen in Deutschland leiden unter der extremen Exportfixierung, die mit niedrigen Löhnen, Einsparungen in den sozialen Sicherungssystemen und einer zunehmenden Vermögensungleichheit einhergeht. Zudem ist die extreme Exportfixierung langfristig ökonomisch ineffizient, da sie zu einem Verzicht auf öffentliche und private Investitionen führt sowie verlustreiche Auslandsanlagen mit sich bringt.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Wie wirken sich die deutschen Exportüberschüsse auf die politischen Beziehungen zu anderen Staaten, insbesondere auf die zu den südeuropäischen Staaten, aus?
Andreas Nölke: Die deutschen Exportüberschüsse belasten unsere Beziehungen zu Südeuropa schwer. Das wurde insbesondere während der Eurokrise sichtbar. Die Anpassungslasten in der Krise (beispielsweise in Form von Lohnkürzungen im öffentlichen Sektor, Kürzungen von Renten und Sozialleistungen, Verzicht auf Investitionen sowie Mehrwertsteuererhöhungen – Anm. d. Red.) mussten einseitig von Südeuropa getragen werden, de facto durch eine Reduktion von Importen (die Deutschland nicht traf, weil es sich mit China einen neuen Absatzmarkt erschloss – Anm. d. Red.). Natürlich hätte Deutschland auch seine Binnennachfrage stimulieren und damit die südeuropäischen Exporte unterstützen können – das tat es aber nicht.
Die Entscheidung für diese Anpassung seitens der Südeuropäer war nicht freiwillig, sondern wurde letztendlich durch deutschen Druck erzwungen. Die Bundesrepublik war in einer starken Verhandlungsposition, da sie – im Gegensatz zu den südlichen Ländern – in der Krise
nicht auf Unterstützung durch andere Länder angewiesen war. Es ist daher nicht überraschend, dass das deutsche Exportmodell in diesen Ländern seitdem erhebliche Aversionen hervorruft, besonders deutlich artikuliert in Italien.
Im Mittelpunkt dieser Aversionen steht der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM), der wichtigste Unterstützungsfonds für die südeuropäischen Ökonomien. In Italien stehen die mit der Nutzung des ESM verbundenen Auflagen im Visier der Kritik (während sich in Deutschland die AfD in Opposition zum fiskalischen Beitrag Deutschlands zum ESM gegründet hat). Entscheidend ist, dass diese Konditionen nach dem deutschen exportorientierten Modell modelliert wurden, mit einem Fokus auf Austerität in öffentlichen Haushalten und Lohnmäßigung im Privatsektor.
Es ist keine Übertreibung, das Eurorettungsregime als einen Versuch zu deuten, die südeuropäischen Ökonomien nach dem deutschen Modell einer exportgetriebenen Ökonomie zu restrukturieren, mit Hilfskrediten als Zwangsinstrument.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Und wie sieht es mit den Beziehungen zu den USA aus?
Andreas Nölke: In den letzten Jahren hat sich der Fokus der vom deutschen Exportmodell ausgelösten internationalen Konflikte etwas verschoben. Diese Konflikte finden nicht mehr nur innerhalb der Eurozone statt, sondern nun auch zwischen der Eurozone und dem Rest der Welt. Im Fokus stehen die seit 2012 wachsenden Leistungsbilanzüberschüsse der Eurozone als Ganzes. Inzwischen erzielen ja nicht nur Deutschland, sondern auch die südlichen Krisenländer solche Überschüsse.
Langfristige und zunehmend umfangreiche Leistungsbilanzüberschüsse des größten Wirtschaftsblocks sind für die globale Ökonomie eine erhebliche Belastung. Andere Ökonomien müssen diese Überschüsse absorbieren (wir können ja nicht auf den Mars exportieren), mit ungünstigen Konsequenzen für ihre eigenen Arbeitsmärkte. Seit Präsident Trumps aggressiver Verurteilung dieser Praxis ist dieser Zusammenhang auch einer breiteren Öffentlichkeit bekannt.
Das deutsche Modell allein konnten die Handelspartner noch zähneknirschend tolerieren, zumal die Eurozone in ihrer Gesamtheit bis vor zehn Jahren kaum Überschüsse produzierte. Durch die Anwendung des deutschen Modells nun auch in Südeuropa wird die Situation für sie allerdings unerträglich, zumal die expansive Geldpolitik der EZB zusätzlich dazu beiträgt, dass der Eurowechselkurs recht niedrig liegt und Europa seine Güter noch günstiger auf den Markt bringen kann.
Nicht nur die Reaktion von Ex-Präsident Trump verweist darauf, dass die Bereitschaft unserer Handelspartner, diese Praxis weiter zu tolerieren, begrenzt ist. Da Trumps Kritik der wachsenden EU-Leistungsbilanzüberschüsse legitim war, wird dieses Thema auch bei seinem Nachfolger Biden nicht verschwinden, zumal jener seinen Wahlkampf unter dem Motto „Buy American“ geführt hat.
Früher oder später wird Deutschland – als Hauptquelle dieser Überschüsse – mit der Überschuss-Thematik wieder konfrontiert werden. Die gravierenden ökonomischen Verwerfungen durch die Corona-Krise werden diesen Trend noch verstärken, da die hohen deutschen Exportüberschüsse von den Handelspartnern leicht als Hindernis für ihre wirtschaftliche Belebung durch Reindustrialisierung identifiziert werden können.
Während die unter einer hohen staatlichen Verschuldung und einer wirtschaftlichen Krise leidenden südeuropäischen Ökonomien sich allerdings gegen das deutsche Exportmodell nicht wehren konnten, sieht das beim Rest der Welt – insbesondere den USA – anders aus. Insofern sollten wir uns warm anziehen.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Innerhalb der EU werden die Exporte und Importe über die Target2-Salden verrechnet. Macht sich Deutschland damit politisch erpressbar?
Andreas Nölke: Die Target2-Salden würden erst bei einem Auseinanderbrechen des Euros relevant, was ich derzeit für sehr unwahrscheinlich halte. Erpressbar macht sich Deutschland durch seine extreme Exportorientierung jedoch trotzdem.
So hat beispielsweise Donald Trump während seiner Präsidentschaft den deutschen Außenhandelsüberschuss explizit mit dem deutschen Beitrag zur Finanzierung der NATO verknüpft. Er hat damit den Druck auf die Bundesregierung erhöht, gegen den Willen großer Teile des Bundestages eine deutliche Erhöhung des Militärbudgets vorzunehmen. So müssen im Endeffekt alle Steuerzahler für die Ausnahmestellung des Exportsektors bezahlen.
Diese Situation ist nicht gänzlich neu. Bereits in den 1960er Jahren irritierte der Kontrast zwischen den (damals noch moderaten) deutschen Exportüberschüssen und den (damals sehr hohen) Kosten, die den USA durch die Stationierung amerikanischer Soldaten in Deutschland entstanden. Nach langen Verhandlungen brachte die amerikanische Regierung 1961 die Bundesregierung dazu, einen entsprechenden Ausgleich („Offset“) zu bezahlen. Insgesamt hat die Bundesrepublik im Rahmen des bis 1976 laufenden Abkommens über zehn Milliarden D-Mark als „Truppendollar“ an die USA bezahlt.
Die politische Expressbarkeit einer exportfixierten Nation zeigt sich aber nicht nur gegenüber den USA. Bestes Beispiel: Seit längerem fällt die deutsche Bundesregierung mit einer sehr gemäßigten Rhetorik gegenüber chinesischen Menschenrechtsverstößen auf. Man kann von der Sinnhaftigkeit solcher Belehrungen halten was man will, der Zusammenhang der Abhängigkeit der deutschen Industrie vom Export nach China ist jedenfalls unverkennbar.
Es handelt sich beim deutsch-chinesischen Verhältnis also um eine fragile Konstruktion – eine Situation, bei der die deutsche Außenpolitik und die Interessen der Exportwirtschaft kollidieren, ist leicht vorstellbar. Sanktionen gegenüber China würden in so einer Situation kaum möglich sein, wenn man bedenkt, dass die Sanktionen gegenüber Russland – bei einem Bruchteil des Exportvolumens – für die deutsche Industrie schon sehr schmerzhaft sind.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Die Absatzmärkte USA und China sind für die deutsche Industrie sehr wichtig. Glauben Sie, dass die Spannungen zwischen den beiden um globale Dominanz ringenden Supermächten Konsequenzen für die deutschen Exportmöglichkeiten haben werden?
Andreas Nölke: Hier droht inzwischen die Eskalation eines gelegentlichen Handelskonflikts zu einem vollen Handelskrieg. Inzwischen befinden wir uns nämlich auf einer Eskalationsspirale, bei der beide Seiten die Maßnahmen der jeweils anderen Seite durch neue protektionistische Schritte beantworten.
Diese Spirale wurde Ende 2019 nur vorübergehend unterbrochen, weil der damalige US-Präsident Trump mit China einen Deal abschloss, um seine Unterstützer in den Agrarstaaten kurz vor der Präsidentschaftswahl bei Laune zu halten. Die USA haben auf weitere Strafzölle verzichtet, da China im Gegenzug hohe Importe von Soja und Schweinefleisch versprochen hat.
Manche Beobachter hoffen, dass sich der chinesisch-amerikanische Konflikt nach der Abwahl von Präsident Trump entschärfen wird. Wir sollten aber nicht vergessen, dass diese konfrontative Haltung gegenüber China keine wirre Laune eines ehemaligen Präsidenten war, sondern inzwischen breit im sicherheitspolitischen Establishment der USA verankert ist.
Auch wenn es im Handelskonflikt zwischen China und den USA zwischenzeitlich zu einer vorübergehenden Entspannung kommen sollte, spricht vieles für einen dauerhaften Konflikt zwischen den beiden Großmächten. In den letzten Jahren hat sich auf Seiten der USA nämlich ein fundamentaler Wandel in Bezug auf die Einschätzung Chinas ergeben. Seitdem wird China im außenpolitischen Establishment der USA – und zwar sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten – nicht mehr als Partner, sondern als systemischer Wettbewerber um die geopolitische Vormachtstellung angesehen.
Selbst die Wirtschaft, einschließlich der Wall Street, setzt sich inzwischen nicht mehr durchgehend für ein kooperatives Verhältnis mit China ein. Neben den ewigen Ärger in Bezug auf die Verletzung intellektueller Eigentumsrechte ist inzwischen der Eindruck getreten, dass chinesische Konzerne aufgrund ihrer dynamischen Entwicklung bei Zukunftstechnologien wie 5G und Künstlicher Intelligenz in absehbarer Zeit zu gefährlichen Konkurrenten ihrer amerikanischen Ebenbilder heranwachsen könnten.
Auch nach einer Trump-Präsidentschaft ist daher keine grundsätzliche Entspannung im Verhältnis zwischen den beiden Großmächten zu erwarten. An die Stelle des „War on Terror“ ist nun der geopolitische Wettbewerb mit China als zentrales Motiv der US-Außenpolitik getreten, zunehmend unterstützt durch geoökonomische Rivalitäten.
Aus der Sicht der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik kann sich aus diesem „amerikanisch-chinesischen Weltkonflikt“ ganz leicht eine De-Globalisierung zugunsten zweier getrennter Sphären ergeben, eine unter chinesischer und eine unter amerikanischer Dominanz. Dritte Länder werden sich entscheiden müssen, für die eine oder andere Seite. Für die deutsche Exportindustrie sind das miserable Perspektiven. Die USA sind der wichtigste Absatzmarkt deutscher Exporte, China ist – nach Frankreich – die Nummer drei.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Wird sich die EU auf Dauer als wirtschaftliches Schwergewicht neben China und den USA behaupten können? Und, falls ja, unter welchen wirtschafts- und finanzpolitischen Voraussetzungen?
Andreas Nölke: Das hängt von den Weichenstellungen der nächsten Jahre ab. Zunächst sieht es schlecht aus. Die Corona-Krise trifft die EU wohl noch härter als die USA und sicher wesentlich härter als China. Insbesondere die wichtigen west- und südeuropäischen Exportmärkte Deutschlands werden von der Krise hart getroffen. Ich sehe auch keine mehrheitliche Bereitschaft der deutschen Bevölkerung, Länder wie Italien und Spanien mit fiskalischen Transfers zusätzlich zu unterstützen. Die Ungleichgewichte in der EU werden sich daher noch weiter verstärken.
Ein Niedergang des wirtschaftlichen Gewichts der EU insbesondere gegenüber dem weiter aufstrebenden China lässt sich aus meiner Sicht nur verhindern, wenn Deutschland seine Binnennachfrage durch höhere Löhne und Staatsausgaben mächtig ankurbelt. Das würde nicht nur das Wirtschaftswachstum in Deutschland stärken – insbesondere in den Binnensektoren, die ja in der Corona-Krise besonders stark gelitten haben – sondern auch zu Nachfrage-Impulsen für unsere europäischen Partnerländer führen und damit die EU wirtschaftlich stabilisieren.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Gäbe es Möglichkeiten, die deutsche Volkswirtschaft aus ihrer Exportabhängigkeit zu lösen? Und mit welchen politischen Widerständen wäre bei einem solchen Versuch zu rechnen?
Andreas Nölke: In der aktuellen Krisensituation wird nun vielfach vorgeschlagen, die wirtschaftliche Malaise durch eine Entlastung der Unternehmen und eine neuerliche Lohnzurückhaltung zu beheben. Das wäre genau der falsche Weg. Wir müssen die Krise dazu nutzen, die deutsche Wirtschaft viel besser auszubalancieren.
Im Zentrum einer solchen Ausbalancierung muss die dauerhafte Stimulierung der privaten und staatlichen Binnennachfrage stehen, als Ausgleich für die zwar weiter stattfindenden, aber insgesamt vielleicht etwas zurückgehenden Exporte (die dann übrigens durch höheres Qualitätsniveau angetrieben werden müssen, nicht durch preisliches Dumping). Die private Nachfrage wird bei einer solchen Strategie vor allem durch Lohnerhöhungen angeregt, die durch geeignete Rahmenbedingungen für die Tarifparteien seitens der Politik unterstützt werden können. Die Ausweitung der staatlichen Nachfrage sollte sich auf eine Verbesserung der maroden deutschen Infrastruktur, die Bekämpfung des Klimawandels sowie bessere Dienstleistungen, insbesondere in Bildung und Pflege, konzentrieren.
Eine Ausbalancierung des deutschen Haushaltsmodells bedeutet schließlich nicht den Verzicht auf Exporte. Letztere könnten sogar auf dem etablierten Niveau fortgesetzt werden, wenn die Importe erhöht werden. Allerdings wäre es wichtig, in Zukunft bei den Exporten nicht immer mehr auf Kostenkonkurrenz, sondern vielmehr auf Qualitätskonkurrenz zu setzen, um trotz höherer Löhne Leistungsbilanzdefizite zu vermeiden.
Wenn dieser Qualitätssprung gelingt, ist die Ausbalancierung der deutschen Wirtschaft eindeutig ein Positivsummenspiel, das zu mehr Arbeitsplätzen, einem höheren Lebensstandard und einer international weniger konfliktreichen Rolle Deutschlands führt.
Politischen Widerstand dürfte es trotzdem geben, insbesondere aus jenen Teilen der Exportwirtschaft, die nur durch Niedriglöhne überleben, wie beispielsweise die Schlachtbetriebe. Aber die übergroße Mehrheit der Unternehmen und der Menschen würde profitieren. Dazu gehören nicht nur die Nutznießer besserer öffentlicher Leistungen und Infrastrukturen, sondern auch jene Dreiviertel der Deutschen, die nicht in den Exportsektoren arbeiten. Ganz besonders helfen sollte die Ausbalancierung durch höhere Nachfrage schließlich jenen Freiberuflern und Gewerbetreibenden in den Binnensektoren, die derzeit so sehr unter den Restriktionen der Corona-Maßnahmen leiden.
Info zur Person: Andreas Nölke ist Professor für Politikwissenschaft in Frankfurt. Er hat an der Universität Konstanz Verwaltungswissenschaft studiert und wurde dort auch promoviert. Vor und nach seiner Promotion war er in der Entwicklungszusammenarbeit tätig, unter anderem für Weltbank und Europäische Kommission sowie als Berater in Malaysia. Nach seiner
Habilitation an der Universität Leipzig sowie Lehre an den Universitäten von Amsterdam und Utrecht arbeitet er seit 2007 an der Goethe-Universität sowie seit 2020 für das Leibniz-Institut für Finanzmarktforschung SAFE. Sein Buch „Exportismus – die deutsche Droge“ www.westendverlag.de/buch/exportismus/ ist vor wenigen Tagen im Westend Verlag erschienen.