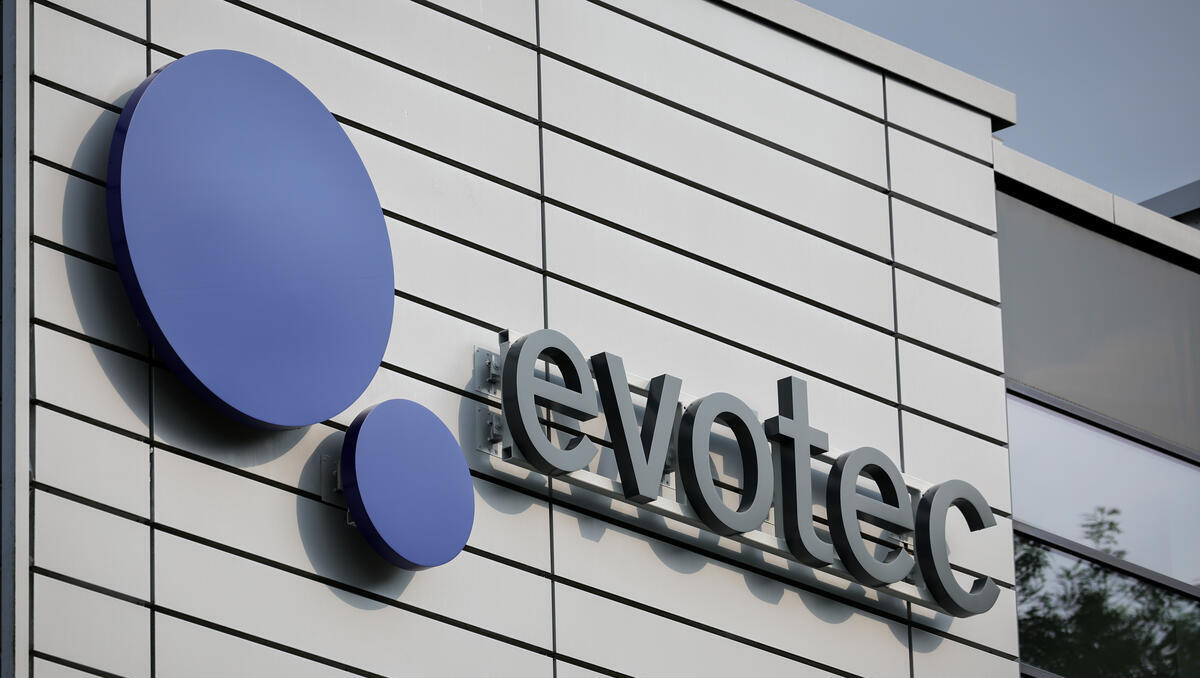Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Frau Prof. Dr. Eschenbacher, die Corona-Krise und die sie flankierenden Maßnahmen haben unser Land seit circa zwei Jahren mehr oder minder fest im Griff. Wollen wir mal optimistisch sein und davon ausgehen, dass wir die Krise im Laufe des Jahres überwunden haben und sich in dem Zeitraum bis dahin nichts Einschneidendes mehr ereignet: Welches Fazit ziehen Sie dann als Wissenschaftlerin, die sich primär mit Krisen und den daraus resultierenden Transformationsprozessen befasst?
Saskia Eschenbacher: Das ist eine sehr weitgefasste Frage, die sich nicht pauschal beantworten lässt. Es gibt eine ganze Reihe von Aspekten, auf die ich einen nach dem anderen eingehen möchte.
Zunächst einmal haben die Ereignisse eine individuelle Dimension. Das heißt, jeder Mensch nimmt sie auf unterschiedliche Weise wahr. Wie rasch für sie oder ihn eine „neue“ Normalität wieder Einzug hält, hängt sowohl vom konkret Erlebten ab als auch davon, wie dieser Mensch mit schwierigen Erlebnissen und Krisen umgeht, sie verarbeiten, und verkraften kann – Stichwort Resilienz - und im besten Falle diese Krisenerfahrungen konstruktiv lernend in Chancen umwandeln kann.
Generell ist zu sagen, dass die vergangenen zwei Jahre für uns alle mit einem gewissen Kontrollverlust einhergegangen sind. Viele mussten erleben, wie ihr Weltbild erschüttert wurde, teilweise auch ihr Bild von sich selbst. Vieles von dem, was wir für selbstverständlich genommen haben, ist es plötzlich nicht mehr. Ein Gefühl der Verwundbarkeit ist deutlich(er) spürbar geworden.
In dieser Situation ist es wichtig, eine gute Strategie für den Umgang mit der Krise und ihren Folgen zu entwickeln. Ich glaube, eine geeignete Strategie ist es, die Krise nicht ausschließlich als Unglück zu begreifen, sondern auch als Chance. Als Lernmöglichkeit. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Theorie des Transformativen Lernens hinweisen. Im Kern geht es darum, dass man die Dinge, die man bisher für
selbstverständlich gehalten und als unumstößlich wahrgenommen und erlebt hat, anfängt zu hinterfragen und kritisch zu reflektieren. Wenn wir Denkgewohnheiten hinterfragen und sie gegebenenfalls der neuen Situation anpassen, eröffnen wir uns Möglichkeitsräume für Veränderungen. Zum Beispiel, die eigene Perspektive zu erweitern – und zwar nicht nur, weil wir dazu bereit sind, sondern weil wir auf Grundlage neuer Erfahrungen und neu hinzugewonnenen Wissens in der Lage sind, die Zusammenhänge besser zu verstehen.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Wofür ist das notwendig? Ist es nicht so, dass wir – sowie die Krise vorüber ist – wieder zu unserem gewohnten Leben zurückkehren?
Saskia Eschenbacher: Zur Normalität, wie wir sie bisher kannten, werden wir aller Voraussicht nach nicht komplett wieder zurückkehren können – dafür waren die Ereignisse zu disruptiv. Wie stark der einzelne Mensch von der Krise mental und physisch (Stichwort Long-Covid) betroffen ist, hängt zum einen - wie bereits gesagt – von den subjektiven Bewältigungsmöglichkeiten und der jeweiligen Persönlichkeitsstruktur ab. Zum anderen aber auch von den konkreten Umständen. Was Letzteres anbelangt: Nehmen wir eine Pflegerin auf der Intensivstation, im Extremfall eine, die in New York oder Bergamo lebt und mit einer riesigen Zahl von Todesfällen konfrontiert war: Sie hat natürlich ganz andere Erfahrungen gemacht (unter Umständen traumatische Erfahrungen) als jemand, der von der Pandemie nur indirekt betroffen war, vielleicht „nur“ in der Form, dass er oder sie ins Homeoffice gewechselt ist.
Aber das ist eben auch eine Veränderung, und zwar eine durchaus spürbare. Schließlich macht es einen Unterschied, ob Sie jeden Tag ins Büro fahren oder nicht: Sie sparen Zeit und Geld, haben dafür aber nicht mehr die Kolleginnen und Kollegen um sich herum. Wie auch immer Sie das für sich persönlich bewerten: Es ist eine Veränderung, mit der Sie lernen müssen umzugehen.
Und dass „digital“ jetzt sozusagen das neue Normal ist, bedeutet eben nicht nur eine Veränderung für Sie, sondern für Millionen von Menschen, genauso wie für Unternehmen. Hier sehen wir einen weiteren Aspekt der Krise: ihre gesellschaftliche Dimension.
Die von der Krise diesbezüglich ausgelösten Veränderungen lassen sich derzeit noch nicht absehen. Wobei mit gesellschaftlichen Veränderungen eben ganz Konkretes gemeint ist – beispielsweise neue Arbeitsplatz-Modelle – aber auch neue Denkansätze. Möglich - in meinen Augen auch wünschenswert -, ist beispielweise, sich klar(er) darüber zu werden, dass von der Krise diejenigen am stärksten betroffen waren, die in der sozialen Hierarchie oftmals nicht besonders weit oben stehen und/oder zu den Geringverdienern und Geringverdienerinnen gehören, obwohl sie systemrelevante Berufe ausüben, wie beispielsweise Pflegekräfte sowie Kassierer und Kassiererinnen. Viele Kleinunternehmen – beispielweise Restaurants und Einzelhandelsgeschäfte – haben stark unter der Krise gelitten, während Großkonzerne wie beispielsweise Amazon ihren Umsatz massiv steigern konnten.
Auch dass die Menschen in Staaten, die wirtschaftlich weniger entwickelt sind als die in hohem Maße privilegierten Länder des Westens, unter der Krise viel stärker gelitten haben beziehungsweise immer noch leiden, sollten wir uns bewusst machen und daraus die notwendigen Handlungsoptionen ableiten. Kurz gesagt: Ich halte es für wünschenswert – und für möglich – dass die aktuelle Krise der Diskussion um Gerechtigkeitsfragen neuen Auftrieb gibt.
Ich hoffe, dass es zu umfangreichen Diskussionen um die zukünftige Organisation des Gesundheitswesens kommen wird – diese Diskussionen werden zum Teil schon geführt. Gleichzeitig sind die, die am massivsten betroffen sind, zum Beispiel Pflegekräfte, häufig kaum am Diskurs und den Entscheidungen bezüglich möglicher Veränderungen beteiligt. In diesem Bereich könnten wir die Chance nutzen und diese Defizite in Lösungsmöglichkeiten umarbeiten, um nachhaltige Veränderungen zu ermöglichen.
Hier berühren sich die gesellschaftliche und die politische Dimension der Krise.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Können Sie uns die erläutern?
Saskia Eschenbacher: Eine Erkenntnis, die wir im Zuge der Pandemie gewonnen haben, liegt sicherlich in der Wahrnehmung und im Bewusstwerden eines Risses innerhalb der Gesellschaft. Es gibt Teile der Gesellschaft, die noch weiter an den rechten Rand gerückt sind, die der Wissenschaft (und in Teilen auch der Demokratie) äußerst skeptisch und bisweilen auch ablehnend gegenüberstehen. Diesen Riss hat es sicher schon vor der Pandemie gegeben, er ist nur stärker deutlich geworden. Das politische System war insoweit nicht erfolgreich, dass es diese Risse nicht überwinden konnte. Ähnliches sehen wir in den USA. In Irland beispielsweise ist es besser gelungen, das konstruktive Moment der Krise zu stärken.
Wir werden uns damit befassen müssen, wie wir wieder Brücken bauen und Einigkeit herstellen können, wie wir diese Krise der Solidarität (zum Beispiel mit den Beschäftigten im Gesundheitswesen) in eine neue Chance verwandeln können. Wir müssen uns darüber hinaus der Tatsache stellen, dass ein gewisser Teil der Bevölkerung unter Umständen von der Politik nicht mehr erreichbar ist. Wie wir als Gesellschaft mit diesen Menschen in Zukunft umgehen wollen, ist eine Frage, deren Beantwortung alles andere als leicht ist.
Hier begegnen wir wieder der individuellen Dimension der Krise: Die Menschen unterscheiden sich in dem, wie Sie die Krise wahrnehmen, ihr begegnen und sie bewältigen können. Ich kann mich zum Beispiel noch gut an die Rede von Angela Merkel am 18. März 2020 erinnern, in der sie die Pandemie als größte Herausforderung nach dem Zweiten Weltkrieg bezeichnete. Im Austausch mit meinen amerikanischen Kollegen und Kolleginnen habe ich immer wieder gehört, wie sehr die ruhige, wissenschaftlich fundierte Rede von Angela Merkel beeindruckt hat. Ich habe die Rede als integrativ empfunden – andere mögen das anders empfunden haben.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Es gibt wohl niemanden, der behaupten würde, Corona sei ein wünschenswertes Ereignis gewesen. Jedoch gibt es den Sinnspruch, dass „jede Krise auch eine Chance“ sei. Was sagen Sie dazu?
Saskia Eschenbacher: Dem ist so, da habe ich keine Zweifel. Eine Krise kann eine kathartische Wirkung haben, und sie kann viel Potential für transformative Prozesse freisetzen. Wir haben die Möglichkeit, uns noch einmal neu für uns persönlich und gesellschaftlich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie wir in Zukunft gemeinsam leben möchten und diese Gesellschaft gestalten wollen. Wir können über soziale Ungleichheit neu nachdenken und politisch die Themen adressieren, die sich unter dem Eindruck der Krise gezeigt haben. Die Entwicklungen in der Medizin stimmen uns hoffnungsvoll, wenn neue Wege in der Behandlung von Krebserkrankungen durch die Erforschung neuer Impfstoffe geebnet werden. Viele lebensnotwendige Operationen, unter anderem Krebsbehandlungen, mussten und müssen immer noch aufgeschoben werden, weil nicht genügend Kapazitäten zur Verfügung stehen. Auch anhand von diesem Beispiel sehen wir, wie individuelle, gesellschaftliche und politische Dimensionen miteinander verwoben sind. Wir können versuchen, die Krise überall dort, wo es möglich ist, lernend konstruktiv in Chancen umzuwandeln. Das hat auch den Vorteil, dass wir aktiv an tiefgreifenden Veränderungen mitwirken können, etwa im Gesundheitswesen oder mittels unseres Einsatzes für eine sozial gerechtere Welt. Die Erfahrungen, die wir gewonnen haben, können wir dann in der Auseinandersetzung und Bewältigung anderer Krisen nutzen, etwa der Klimakrise
Vielleicht war unser Fokus in den vergangenen zwei Jahren manchmal zu destruktiv. Der Krise konstruktiv zu begegnen und sie dadurch nicht nur als Herausforderung, sondern auch als Chance zu sehen - das haben wir tendenziell vernachlässigt.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Frau Prof. Dr. Eschenbacher, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Zur Person: Dr. Saskia Eschenbacher ist Professorin für Erwachsenenbildung und Beratung an der "Akkon Hochschule für Humanwissenschaften" in Berlin und seit Oktober 2019 Gastprofessorin am Teachers College der Columbia University in New York City (USA). Sie arbeitet seit vielen Jahren als Beraterin in freier Praxis sowie als Dozentin und Trainerin im In- und Ausland (u.a. Bosch, DVV International in Osteuropa). Im Rahmen ihrer Forschung und internationalen Vortragstätigkeit (u.a. Columbia University sowie New York University) widmet Sie sich der Frage nach tiefgreifenden Veränderungs- und Transformationsprozessen.