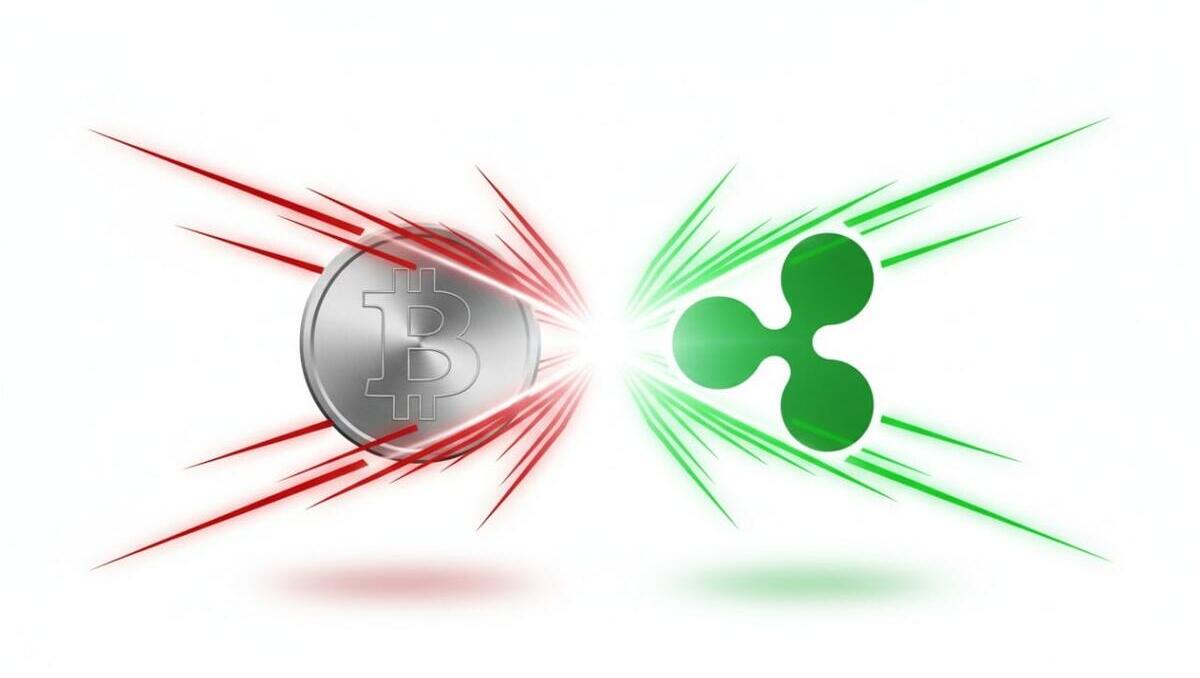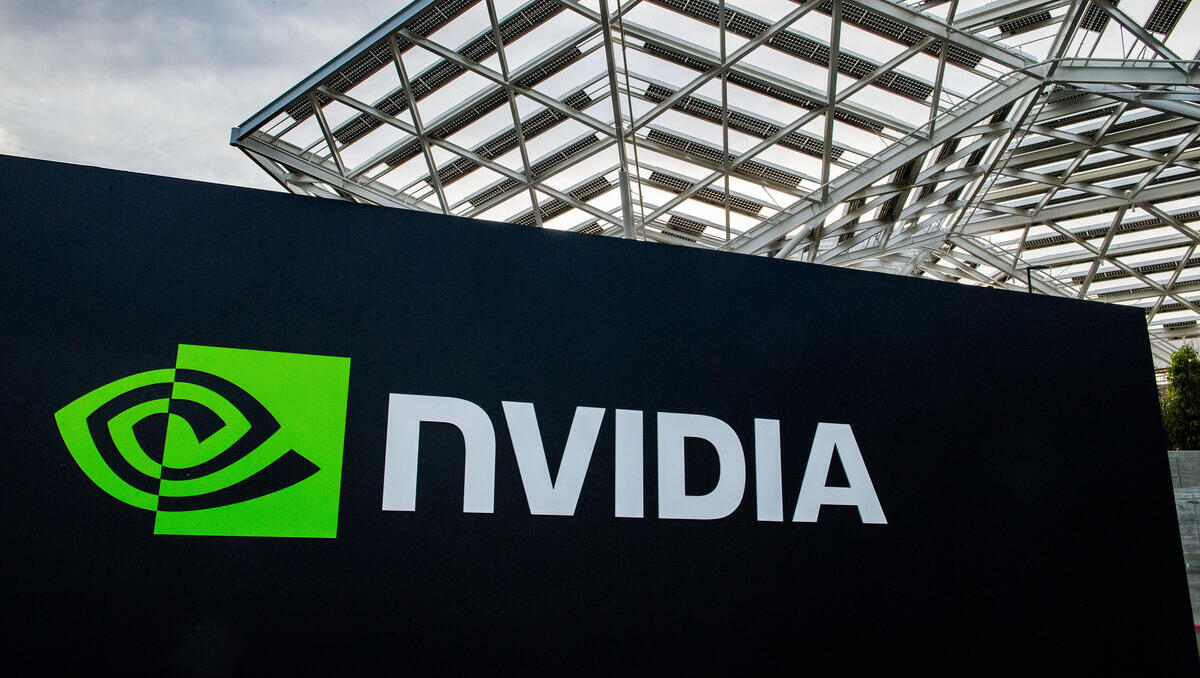Vor dem Europäischen Parlament zündete Frankreichs Präsident Emmanuel Macron diese Woche ein Feuerwerk von Bekenntnissen zu Europa. Er lobte die Abgeordneten in höchsten Tönen, rühmte aber die Kommission und entwarf ein Bild von der EU als kraftvolle, international einflussreiche Institution, die die Zukunft gestalten werde. Nach Paris zurückgekehrt, musste er allerdings wütende Proteste über sich ergehen lassen, vor allem von der rechtspopulistischen Marine le Pen und vom altlinken Jean-Luc Mélenchon. Macron würde die französische Nation verraten, hieß es, und man werde es ihm bei den kommenden Parlamentswahlen im Juni schon zeigen. In Straßburg hatten die EU-Abgeordneten hingegen mit stehenden Ovationen auf den neuen „Mister Europa“ reagiert. Offenbar wurden sowohl in Paris (von den Gegnern der europäischen Idee) als auch in Straßburg (von ihren Befürwortern) nur Macrons laute, leidenschaftliche Pro-Europa-Parolen vernommen und die tatsächlichen Pläne des französischen Präsidenten inmitten der allgemeinen Begeisterung schlichtweg überhört. Und diese Pläne haben es in sich, und zwar gewaltig: Sie laufen, ob man es glaubt oder nicht, auf die Abschaffung der EU, so wir wie sie heute kennen, hinaus.
Ein lockerer Verbund
Macron machte unmissverständlich klar, dass eine Aufnahme der Ukraine in die EU mindestens noch Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte dauern werde. Diese harte Botschaft milderte er allerdings durch die Feststellung ab, dass die tapfer für die Demokratie kämpfende Ukraine schon jetzt ein Mitglied der europäischen Familie sei. Und dann zündete er eine politische Bombe (die die Frage eines Beitritts der Ukraine zur EU schon fast zur Nebensache werden lässt): Eine neue Organisation müsse her, ein sogenannter „Solidarischer Verbund europäischer Staaten“. Ein Verbund, dem sowohl die EU-Mitglieder als auch die -Nichtmitglieder angehören sollen, in dem es dann - unter anderem - möglich sei, die Ukraine näher an die EU zu binden. Beitreten können sollen auch, Macron hat es explizit erwähnt, ehemalige, mittlerweile ausgetretene Mitglieder. Diese Bezeichnung passt derzeit nur auf Großbritannien. Allerdings ist es alles andere als unwahrscheinlich, dass es in naher Zukunft weitere solcher ehemaligen EU-Mitglieder gibt - man denke nur an die beiden osteuropäischen Länder Ungarn und Polen, die die gemeinsame Politik der EU kaum bis gar nicht mittragen und als mögliche Austrittskandidaten gelten.
Mehrheitsentscheidungen statt Einstimmigkeit
Ausführlich beklagte Macron, dass in der EU nur mit größter Mühe Entscheidungen zustande kommen. Er verwies auf die derzeit gegebene Notwendigkeit, in vielen Bereichen Einstimmigkeit erzielen zu müssen und verlangte, dass man dieses Prinzip bei den meisten Fragen aufgeben müsse. Schließlich entscheide in der Demokratie - bei aller Rücksicht auf Minderheiten - stets die Mehrheit, und das sei auch gut so.
Dieses Thema ist schon oft ausgiebig diskutiert worden, allerdings ließ sich Macron nicht auf Details ein. Welche Mehrheit ist gemeint? Die Zahl der Bürger? Die EU hat 448 Millionen Einwohner, 224 Millionen plus eine Stimme wären also die Mehrheit. Dann könnten Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Staaten, also die ursprünglichen Gründungsmitglieder, allein bestimmen. Oder ein anderes Modell: Jedes Mitgliedsland hat eine Stimme - aber das würde bedeuten, dass die Stimmen von kleinen Ländern wie Zypern und Malta durchgehend das gleiche Gewicht hätten wie die Stimmen von Riesen wie Deutschland und Frankreich, und dass theoretisch die Mehrheit der 14 bevölkerungsärmeren die Mehrheit der 13 bevölkerungsreichen Staaten überstimmen könnte, was dazu führen würde, dass Entscheidungen gegen die überwiegende Mehrheit der EU-Bürger getroffen werden könnten. Auch die Frage, bei welchen Themen es lediglich eine Zweidrittelmehrheit braucht und bei welchen die Einstimmigkeit, wurde nicht geklärt, obwohl ja feststeht, dass kein Staat gerne auf die Möglichkeit verzichtet, mit einem Nein eine ihm unliebsame Entscheidung (und nebenbei die gesamte EU) zu blockieren. Zumal die einzelnen Staaten in Bereichen, in denen keine Einstimmigkeit vorgeschrieben ist, Druck ausüben können mit der Androhung, bei einer Abstimmung, für die ein einstimmiges Votum notwendig ist, ihr Veto einzulegen. Auch diese Option wird niemand gerne aufgeben wollen.
Der Rat der EU-Regierungen soll sich als kraftvolle Europa-Regierung profilieren
Wie dem auch sei: Der Wechsel von der Notwendigkeit zur Einstimmigkeit zu Mehrheitsentscheidungen ist nur eine von vielen Bomben, die Macron gezündet hat. Er sprach auch den Rat der EU-Regierungen an, dessen Vorsitz Frankreich und somit Macron im ersten Halbjahr 2022, also bis Ende Juni, innehat. Dem Kollegenkreis im Rat aus Staats- und Regierungschefs rief er vom Rednerpult des Parlaments zu, doch mutiger zu sein, mehr Entschlussfreude zu zeigen: „Wir bilden ein Gremium, das sich nicht traut, als solches zusammenzutreten und zu entscheiden. Wir laden immer auch die Straße ein.“ Diese Vorgangsweise behindere ebenfalls die Effizienz der EU. Eingebettet war diese Botschaft übrigens in ein wortreiches Bekenntnis zu mehr Demokratie und mehr Kontrolle durch das Parlament …
Macrons Aussagen bezüglich des EU-Rats ist im Zusammenhang mit seinem Bekenntnis zu Mehrheitsentscheidungen zu sehen. Derzeit müssen im Rat 27 Staats- und Regierungschefs eine Einigung erzielen und jede und jeder schielt dabei auf die eigenen Wähler zu Hause, kurzum, „auf die Straße“, wie Macron es formuliert. Das soll nach Willen des französischen Ministerpräsidenten in Zukunft vermieden werden. Aber, um nochmals auf die bereits erläuterten Schwierigkeiten zurückzukommen: Sollen in Zukunft tatsächlich die Führer von nur sechs Staaten über das Schicksal Europas entscheiden? Oder bei der Variante „Jeder Staat eine Stimme“ eine Minderheit an Europäern einer Mehrheit ihren Willen aufzwingen können? Dass ein derartiger Weg die Begeisterung für die EU stärken würde, ist zu bezweifeln.
Das EU-Parlament auf dem mühsamen Weg, ein echtes Parlament zu werden
Besonders frivol erscheint die Verkündung dieser Pläne im Hinblick auf das EU-Parlament, das sich seit langem um eine Stärkung seiner Kompetenzen bemüht. Ein Verfassungskonvent unter Leitung des ehemaligen französischen Finanzministers und Präsidenten Valéry Giscard d’Estaing ließ in den Jahren 2002 und 2003 diesbezügliche Hoffnungen aufkeimen. Damals wurde ein Verfassungsentwurf vorgelegt, der das EU-Parlament tatsächlich gestärkt hätte. Wie in allen Demokratien, wäre das Parlament für das Erlassen der Gesetze und die Kommission für deren Ausführung zuständig gewesen. Bevor noch über diesen Vorschlag näher verhandelt wurde, setzten die Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten jedoch einen kurzgehaltenen Paragrafen durch, in dem festgeschrieben wurde, dass ohne Zustimmung des EU-Rats der Regierungen keine Gesetze, also keine Richtlinien und Verordnungen, beschlossen werden dürfen. In der Folge lehnten zudem Referenden in Frankreich und in den Niederlanden das Projekt ab.
Und jetzt, zwanzig Jahre später, erklärt Macron vor dem Parlament, dass der EU-Rat noch stärker, gleichsam zu einer echten Regierung Europas werden solle. Man sollte meinen, von den Abgeordneten wäre ein Aufschrei gekommen, wütende Proteste wären auf den Franzosen niedergegangen. Aber nein: Den Schlag ins Gesicht haben die Abgeordneten, aber auch die anwesenden Vertreter der Kommission, einfach so hingenommen. Es scheint, als sei kaum einer mit dem Schicksal des damaligen Verfassungskonvents vertraut. Vielleicht ließen sie sich auch davon Sand in die Augen streuten, dass Macron voller Eifer verkündete, dass er die Bemühungen um eine Stärkung des Parlaments unterstütze und dass er sich dafür einsetze, dass die Abgeordneten auch Gesetzesinitiativen starten können, ein Privileg, das derzeit fast ausschließlich der EU-Kommission vorbehalten ist. Großes Verständnis brachte er auch der kürzlich mit knapper Mehrheit beschlossenen Wahlrechtsreform entgegen: Demnach soll künftig eine kleine Gruppe von Abgeordneten direkt von allen EU-Bürgern gewählt werden können, während man bislang nur über eine Wahl im jeweiligen Heimatland ein Ticket in das EU-Parlament bekommt. Allerdings muss diese Reform von den Parlamenten der Mitgliedsländer noch abgesegnet werden.
Das Parlament behindert sich selbst und stärkt die Kommission
Die Haltung des Parlaments ist widersprüchlich. Nach dem Scheitern des 2002/2003er-Verfassungskonvents trat im Jahr 2009 der Lissabonner Vertrag in Kraft, der - wenn auch eher in bescheidenem Umfang - die Position des Parlaments gegenüber der Kommission und dem Rat gestärkt hat. Statt allerdings diesen zusätzlichen Spielraum zu nutzen, schränken sich die Abgeordneten selbst ein: Im Lissabonner Vertrag ist nämlich die Möglichkeit vorgesehen, dass das Parlament nur Prinzipien zu den verschiedenen Themen beschließt und die Ausformulierung der Richtlinien und Verordnungen im Rahmen von „delegierten Rechtsakten“ der Kommission überträgt - und was machen die Abgeordneten? Lassen diese Möglichkeit regelmäßig zur Anwendung gelangen, wodurch die Kommission, die in der Regel neue Gesetze vorschlägt, nach einer prinzipiellen Zustimmung durch das Parlament, diese Gesetze auch formuliert und die Anwendung besorgt. Ein entscheidendes Fundament der Demokratie, die Gewaltenteilung zwischen Gesetzgebung und Verwaltung, wird somit ständig verletzt, und diesen Missstand hat in erster Linie das Parlament zu verantworten, da es ja auf seine Kompetenzen weitestgehend verzichtet. Auf diese Groteske ging Macron in seinen Lobeshymnen für die Arbeit der EU-Abgeordneten allerdings nicht ein …
Im Juni soll der Startschuss für die Vorbereitungen der „Macron-EU“ fallen
Macron will noch im Juni, vor dem Ende seiner Vorsitzführung im EU-Rat, die Installierung eines neuen Konvents durchsetzen. Dieser Konvent soll die Überarbeitung der EU-Verträge vorbereiten, also wie sein Vorgänger vor zwanzig Jahren, eine neue EU-Verfassung auf den Weg bringen. „Bei so einem Projekt müsse man im Vorhinein wissen, was am Schluss herauskommen soll“, meinte der französische Präsident. Diese eigenartige Feststellung wirft die Frage auf, wozu man dann einen Konvent mit monatelangen Diskussionen braucht … Man muss nun davon ausgehen, dass die einzelnen Punkte, die Macron in seiner Rede angesprochen hat, eine Art Aufträge für den Konvent sind, die nur noch in Gesetzesform gegossen werden müssen. Vereinfacht ausgedrückt: Macron will eine Struktur, in der er und die anderen Staats-Chefs die Entscheidungen treffen (natürlich stets unter der Kontrolle durch das EU-Parlament, aber dessen mangelnde Durchsetzungsfähigkeit haben wir ja schon weiter oben beschrieben).
Somit liegt ein Rückblick nahe, was denn Giscard d’Estaing vor zwanzig Jahren wollte, dass der damalige Konvent zustande bringen möge. Sein Grundsatz war, man müsse endlich die Frage beantworten „Qui fait quoi?“, „wer macht was?“ Er wollte erreichen, dass in der EU-Verfassung klargestellt wird, für welche Aufgaben die Kommission und das Parlament für welche Bereiche die Mitgliedstaaten zuständig sind. Er fand es unter anderem unerträglich, dass die zentralen Planungsstellen überall eingreifen, aber letztlich doch die Staaten weitgehend autonom agieren; und dass die EU-Gesetzgebung stets Vorrang besitzt, obwohl für zahlreiche Bereiche die EU gar nicht zuständig ist. Sein Ziel war es, Ordnung in die Arbeit der einander durch widersprüchliche Kompetenzen behindernden Institutionen zu bringen.
Letztlich will Macron zwanzig Jahre später das Gleiche erreichen. Mit ein Grund für das immer noch herrschende Chaos ist die damalige Weigerung der Mitgliedstaaten, allen voran Frankreichs, das Giscard d’Estaing-Konzept anzunehmen, weil man nichts von der eigenen Souveränität abgeben wollte. Das Nein kam in erster Linie vom damaligen französischen Präsidenten, Jacques Chirac. Der aktuelle Präsident Macron ist, wenn man seine emotional vorgetragenen Botschaften für bare Münze nimmt, für eine Stärkung der EU, wenn man die Details ansieht, sogar für eine Macron-EU. Nun kann niemand leugnen, dass die EU in ihrer gegenwärtigen Organisationsform nur mangelhaft funktioniert und dringend reformiert gehört, und Macrons Initiative somit grundsätzlich zu begrüßen ist. Aber: vielleicht sollte man auch sagen, zu begrüßen wäre - wenn der ehrgeizige Franzose sie (die Initiative) nicht gar zu sehr auf seine eigenen Vorteile und Ambitionen zugeschnitten hätte.
Eine persönliche Erinnerung an Giscard d‘Estaing
Bei einem Interview, das ich mit ihm in einer Sitzungspause des Konvents im Jahr 2003 führte, sinnierte Giscard. „Es ist jetzt alles schwieriger als früher und wird noch schwieriger durch die wachsende Zahl an Mitgliedern. Ich erinnere mich gerne an die Zeiten, als ich meine Kollegen aus den anderen EU-Ländern zu einem Abendessen bei mir zu Hause einlud und wir im freundschaftlichen Gespräch die Weichen der europäischen Politik stellten. Das geht heute nicht mehr; unter den aktuellen Bedingungen brauchen wir eine Verfassung, die für klare Verhältnisse sorgt.“ Hintergrund: Als Giscard Finanzminister war, von 1969 bis 1974, zählte die EU sechs Mitglieder (Frankreich, Deutschland, Italien sowie die drei Benelux-Staaten). In seiner Zeit als Präsident, von 1974 bis 1981, kamen Großbritannien, Irland und Dänemark hinzu. Am Tag unseres Gesprächs, im Jahr 2003, hatte die EU 15 Mitglieder. Heute sind es bereits 27, und in der EU herrschen immer noch Strukturen, die schon zu Zeiten, als ihr nur die sechs Gründungsmitglieder angehörten, nicht optimal waren.