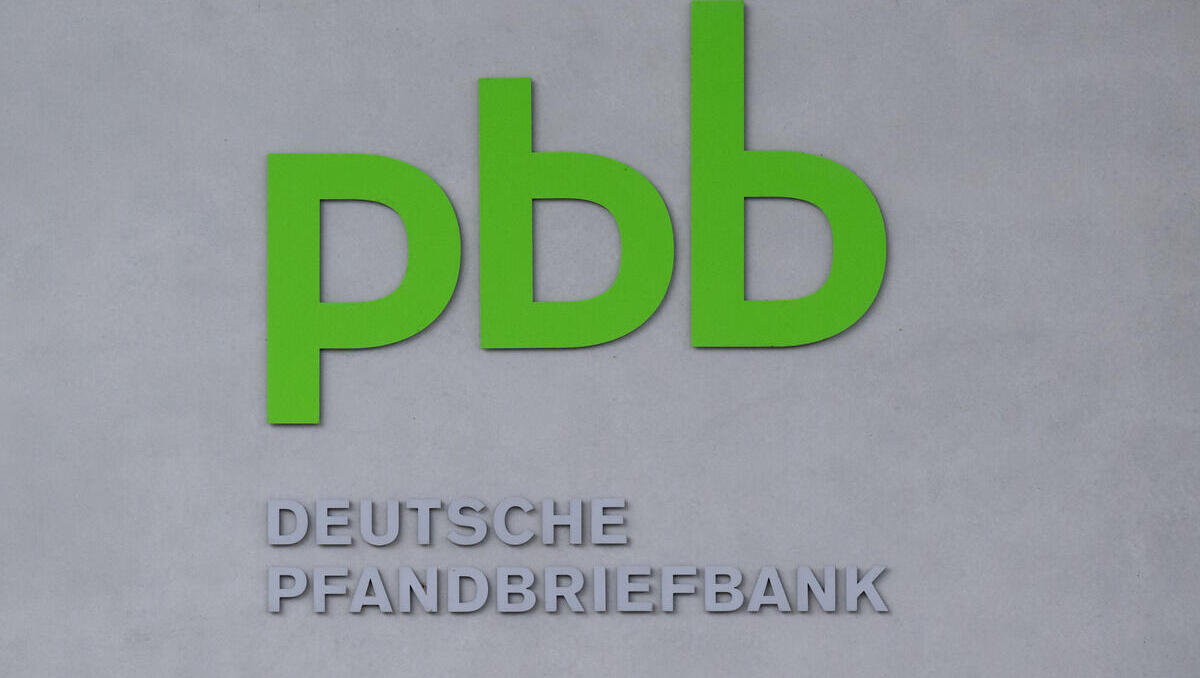Deutschland steht vor einem drängenden Problem: Einem akuten Mangel an bezahlbarem Wohnraum, der insbesondere einkommensschwache Haushalte vor enorme Herausforderungen stellt, wenn es darum geht, eine angemessene und stabile Wohnsituation zu finden. Die Suche nach bezahlbarem Wohnraum wird zu einem Wettlauf gegen die Zeit, doch bislang fehlen wirksame Lösungen, um dieser Situation entgegen zu wirken.
Trotz des von der Bundesregierung ins Leben gerufenen „Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen“ präsentiert sich die Situation auf dem deutschen Wohnungsmarkt äußerst düster. Ursprünglich hatte diese Initiative das ehrgeizige Ziel, bis 2030 eine Million neue Wohnungen zu schaffen und den Erhalt bestehender Sozialwohnungen sicherzustellen. Leider steht bereits heute fest, dass die politische Vorgabe, bis zum Jahr 2023 insgesamt 100.000 neue Wohnungen für einkommensschwache Menschen zu bauen, deutlich verfehlt wird.
Alarmierende Signale kommen von Vertretern der Kommunen und der Wohnungswirtschaft, die vor einer bedrohlichen Entwicklung warnen: Einem dramatischen Stillstand auf dem sozialen Wohnungsmarkt, der insbesondere in den Großstädten spürbar ist. Es droht eine regelrechte Sozialwohnungsnot und zahlreiche geplante Bauprojekte könnten in den kommenden Jahren scheitern. Der Spitzenverband der Wohnungswirtschaft (GdW) bestätigt diese beunruhigende Tendenz und führt aus, dass zehntausende Mietwohnungen nicht wie geplant errichtet werden.
Axel Gedaschko, Präsident des GdW, äußerte seine Besorgnis gegenüber der Augsburger Allgemeinen: „Etwa 70 Prozent aller geplanten Projekte werden entweder komplett abgesagt oder zumindest für längere Zeit zurückgestellt“, warnt Gedaschko. Es ist absehbar, dass dies insbesondere in den Ballungszentren zu einer weiteren Verknappung des Wohnraums und steigenden Mieten führt.
Prekäre Lage beim bezahlbaren Wohnraum
Auch Gerd Landsberg, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, äußerte sich besorgt: „Die steigenden Baukosten führen derzeit dazu, dass zahlreiche Neubauprojekte im frei finanzierten sowie gefördertem Wohnungsbau auf Eis gelegt werden beziehungsweise nicht neu begonnen werden“, erklärte Landsberg.
Zudem wird der Mietwohnungsbau durch hohe Bauauflagen im Neubausektor gebremst. Bauwillige werden von den Kommunen immer stärker gefordert und zur Kasse gebeten. Hohe Energievorgaben, Stellplatzverpflichtungen (auch im Bereich der Elektro-Mobilität) oder die Kostenbeteiligung an Straßenbau und Kitaplätzen sind nur einige der Faktoren, die die Rentabilität von Wohnungsbauprojekten beeinträchtigen.
Die Quoten-Regelungen für den sozialen Wohnungsbau verschärfen dieses Problem. Die Kommunen legen über verbindliche Sozialquoten fest, wie viele Wohnungen im Neubau für sozial benachteiligte Menschen reserviert sein müssen. Normalerweise beträgt diese Quote 30 Prozent aller neu entstehenden Wohnungen. Das bedeutet beispielsweise, dass bei einem geplanten Neubau mit 20 Wohneinheiten insgesamt sechs Wohnungen für den sozialen Wohnungsbau bereitgestellt werden müssen. Viele Wohnungsbaugesellschaften schrecken daher vor Investitionen in Wohnungsbauprojekte zurück, da diese Vorgaben das Bauen zunehmend unattraktiv machen.
Günstiges Wohnen nur für einkommensschwache Personen?
Diskussionsbedürftig ist auch der Kreis der begünstigten Personen, denen eine stabile und bezahlbare Wohnperspektive geboten werden soll. Die staatliche Förderung richtet sich nach festgelegten Einkommensgrenzen und Kriterien, um einkommensschwachen Haushalten den Zugang zu bezahlbarem Wohnraum zu ermöglichen.
In Berlin beispielsweise gelten bestimmte Einkommensgrenzen als Richtlinie, um die Förderberechtigung im sozialen Wohnungsbau festzulegen. Diese Grenzen variieren je nach Haushaltsgröße und orientieren sich am Durchschnittseinkommen der Region oder Stadt. Ein Einpersonenhaushalt gilt als förderberechtigt, wenn das jährliche Einkommen die Grenze von etwa 20.000 bis 25.000 Euro nicht überschreitet. Bei einem Zweipersonenhaushalt liegt die Einkommensgrenze in der Regel bei etwa 25.000 bis 32.000 Euro pro Jahr. Haushalte mit Kindern haben je nach Anzahl der Kinder und Haushaltsgröße eine Einkommensgrenze von etwa 35.000 bis 40.000 Euro pro Jahr.
Normalverdiener, also Personen mit einem Einkommen oberhalb dieser Grenzen, können regelmäßig nicht von den Vorteilen des sozialen Wohnungsbaus profitieren. Doch auch Durchschnittsbürger sehen sich mit zunehmenden Herausforderungen konfrontiert, bezahlbaren Wohnraum zu finden. Die regulären Mietpreise übersteigen aufgrund der hohen Nachfrage und begrenzten Verfügbarkeit oft ihre finanziellen Möglichkeiten. Es erscheint, dass die Förderprogramme derzeit nicht den realen Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechen.
Gerechtigkeit im Wohnungsmarkt: Eine Frage des Ausgleichs
Ein aktuelles Beispiel aus einem neuen Baugebiet in Hannover verdeutlicht die Debatte: Während eine Mieterin stolze 1800 Euro Miete für ihre Wohnung zahlt, werden im selben Neubauviertel auch Sozialwohnungen zu weit günstigeren Konditionen an einkommensschwache Personen auf Belegschein-Basis vermietet. Beide Wohnungen sind bautechnisch auf dem neuesten Stand.
Diese Diskrepanz erscheint unfair und es ist verständlich, dass vor allem Normalverdiener, die hohe Mieten zahlen müssen, die Ungleichheit im Wohnungsmarkt kritisieren. In Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt verschärft sich die soziale Ungleichheit, wenn der soziale Wohnungsbau ausschließlich auf einkommensschwache Bevölkerungsgruppen abzielt.
Ein möglicher Lösungsansatz könnte darin liegen, einen ausgewogenen Mix aus Sozialwohnungen und bezahlbarem Wohnraum für die Mittelschicht zu schaffen. Dadurch ließe sich eine bessere Balance zwischen sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher Realität erreichen.
Es liegt in der Verantwortung der politischen Entscheidungsträger, geeignete Maßnahmen und Anreize für Bauwillige zu schaffen, ohne sie mit zusätzlichen Projektauflagen zu belasten. Den Bedürfnissen der Wohnungsbaugesellschaften sollte stärker Beachtung geschenkt werden, beispielsweise durch alternative Modelle wie die Erfüllung der Sozialwohnungsquoten in Wohnungen außerhalb der Neubauprojekte. Zudem müssen öffentliche Wohnungsbaugesellschaften selbst viel aktiver im sozialen Wohnungsbau werden.
Zudem erfordert es Lösungen, um sicherzustellen, dass der soziale Wohnungsbau dauerhaft zu günstigen Wohnungen führt. Ein Problem ist, dass die Belegungsbindung als Sozialwohnung zeitlich begrenzt ist. Denn private Bauherren haben regelmäßig kein wirtschaftliches Interesse daran, anhaltend niedrige Mieten anzubieten. In Berlin beträgt die Sozialbindung beispielsweise 30 Jahre. Nach Ablauf dieser Frist können die Wohnungen auf dem freien Markt vermietet oder verkauft werden, entgegen ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung als Sozialwohnungen. Auch hier muss die Politik ansetzen. Anderenfalls wird die Wohnungsnot, auch angesichts von weiter steigenden Zuwanderungszahlen, nicht behoben werden.