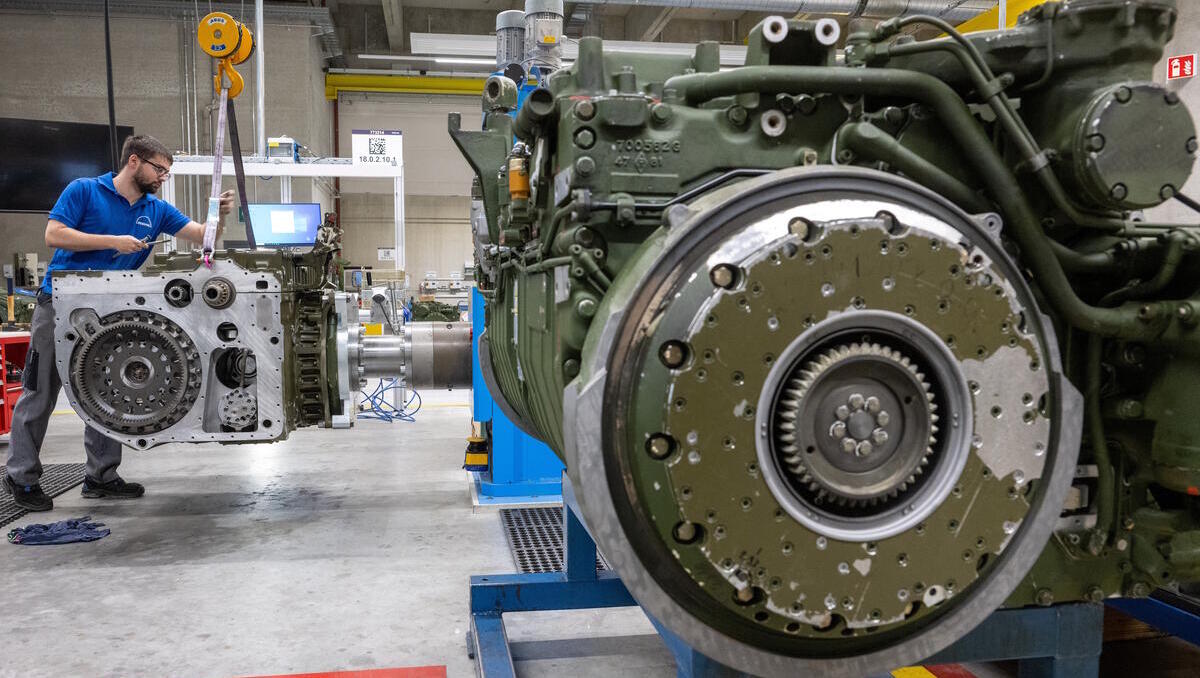Die Linkspartei hat die zehn Abweichler um Sahra Wagenknecht aufgefordert, ihre Bundestagsmandate unverzüglich niederzulegen. Das Vorgehen von Wagenknecht & Co sei unverantwortlich, aber erwartbar gewesen, sagte Linken-Co-Chef Martin Schirdewan am Montag in Berlin. Die Rückgabe der Mandate könne die Existenz der Fraktion sichern.
Wagenknecht will mit einem kleinen Team an Verbündeten zum Jahreswechsel 2024 eine eigene Partei gründen. Die Beteiligten sind allesamt bereits aus der Linkspartei ausgetreten, wollen dieses Jahr aber noch in der Bundestagsfraktion bleiben, wenn diese dies zulässt.
Die Linken waren 2021 bei der Bundestagswahl eigentlich knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert, zogen aber aufgrund von drei Direktmandaten mit Fraktionsstatus in den Bundestag ein. Die drei Linken-Politiker Gesine Lötzsch, Sören Pellmann und Gregor Gysi betonten, die zehn Abweichler seien nur durch sie ins Parlament eingezogen. Ihre Mandate jetzt noch zu behalten, käme einem unmoralischen Diebstahl gleich. Die Linke stellt bislang 38 Abgeordnete im Bundestag.
Schirdewan sprach von einer Zäsur für die Linkspartei. Der scheidende Fraktionschef Dietmar Bartsch sagte, die Fraktion werde souverän und in Ruhe entscheiden, ob Wagenknecht & Co zunächst in der Fraktion bleiben könnten. Im Herbst nächsten Jahres steht unter anderem in Thüringen eine Landtagswahl an. In Thüringen werden die Linken versuchen, Bodo Ramelow im Amt des Ministerpräsidenten zu halten. Der erbittert geführte Streit über den Kurs der Linken habe die Partei jahrelang gelähmt, weswegen die jetzigen Austritte auch eine Chance seien, so Schirdewan.
Wie verändert Wagenknecht die Parteienlandschaft?
Die geplante Partei von Sahra Wagenknecht hat nach der Ansicht einiger Wahlforscher das Potenzial, die Parteienlandschaft in Deutschland zu verändern. Laut Meinungsforschungsinstitut Insa könnten sich 27 Prozent der Befragten vorstellen, eine Wagenknecht-Partei zu wählen. Mit ihren migrationskritischen Positionen könnte die ehemalige Linkspartei-Politikerin der AfD vor allem in Ostdeutschland Konkurrenz machen. Ihr Gegensatz zwischen einer angeblich korrupten Elite und einem vernünftigen Volk sei ebenfalls rechtes Gedankengut, sagt Politologe Wolfgang Schroeder von der Universität Kassel. „Letztlich vertritt sie eine rechtspopulistische Position mit links-keynesianischen Elementen.“ Unklar ist aber, ob das Potenzial für eine solche Partei am Ende auch echte Wählerstimmen bedeutet.
Wagenknecht kündigte am Montag auf einer Pressekonferenz wie erwartet die Gründung einer neuen Partei an, die bei der Europawahl im Juni antreten soll. Offen ist noch, ob sie auch an allen drei Landtagswahlen im September 2024 in Sachsen, Thüringen und Brandenburg teilnehmen wird.
Einigkeit herrscht bei fast allen Experten, dass der Parteiaustritt von Wagenknecht und der früheren Bundestags-Fraktionsvorsitzenden Amira Mohamed Ali der Linkspartei schaden wird, die ohnehin eine Reihe von Wahlschlappen zu verkraften hatte. „Für die Linke dürfte das der Todesstoß sein“, glaubt Forsa-Chef Manfred Güllner. Politologe Schroeder sieht den Niedergang der Partei ganz unabhängig von Wagenknecht. „Für die Linkspartei war das Totenglöckchen schon lange geläutet.“
Eine direkte Auswirkung sieht der Forsa-Chef, wenn die neue Partei bei der Landtagswahl in Thüringen im kommenden Jahr antreten sollte: Dann seien die Wiederwahl-Ambitionen von Ministerpräsident Bodo Ramelow gefährdet, dem einzigen Landeschef der Linken. Zwar genießt Ramelow deutlich höhere Zustimmungswerte als seine Partei und betont die Loyalität seines Landesverbandes. „Aber es reicht eben schon, wenn bei der Landtagswahl drei, vier Prozent der Wähler nicht mehr die Linken, sondern eine Wagenknecht-Partei wählen“, sagt Güllner.
Weil Wagenknecht rechtspopulistische Themen setzt und am Montag erneut im Krieg Russlands gegen die Ukraine auf eine „Friedenslösung“ statt Waffenlieferungen pochte, gibt es die Vermutung, dass die neue Partei der AfD Konkurrenz machen könnte. Die Politikerin wirbt selbst damit, dass sie für diese eine „seriöse Adresse“ sein könne. „Wagenknecht ist in der AfD sehr beliebt - in unserer Erhebung vor einigen Wochen hatte sie mehr Zuspruch von AfD- als von Linken-Anhängern“, betont der Forsa-Chef. Laut Insa denken 40 Prozent der AfD-Wähler und 32 Prozent der befragten Ostdeutschen darüber nach, der neuen Partei ihre Stimme zu geben. Das wird von allen anderen Parteien gerade mit Blick auf die Kommunal- und Landtagswahlen in Ostdeutschland in 2024 mit Spannung beobachtet. Bei den Grünen, in der Union und der SPD hofft man insgesamt darauf, dass sich die neue Partei und die AfD gegenseitig kannibalisieren - einen Aderlass bei den eigenen Anhängern fürchtet man kaum.
Schadet Wagenknecht der AfD?
Doch die Experten warnen vor voreiligen Schlussfolgerungen: „Sympathie heißt noch lange nicht, dass die neue Partei am Ende auch gewählt wird“, betont Güllner. AfD-Wähler seien überzeugter von ihrer Wahl als ihnen unterstellt werde. Sie habe bisher auch nicht abgeschreckt, dass es mit dem thüringischen Landeschef Björn Höcke einen extremen Rechtsaußen in der Partei gebe. „Ich glaube deshalb nicht, dass die neue Partei der AfD sonderlich schadet“, sagt Güllner. Schroeder sieht eher eine weitere Schwächung der politischen Mitte. „Wenn die neue Partei von der AfD Wähler gewinnen will, muss sie in einen Radikalitäts- und Populismus-Wettbewerb eintreten“, warnt er. „Ich fürchte, der Wettbewerb wird eher die Popularitäts- und Irrationalitäts-Spirale weiterdrehen.“
Wagenknecht gab sich am Montag Mühe, die Fixierung auf ihre Person im Verein „Bündnis Sahra Wagenknecht“ als „Übergangsphänomen“ herunterzuspielen. „Wenn dieses Projekt, erfolgreich ist, dann ist es wirklich historisch in dem Sinne, weil wir erstmals auf Bundesebene eine Partei sehen, die sich rund um eine Person gründet“, sagt Thorsten Faas, Parteienforscher der FU Berlin im ZDF. Aber Schroeder zweifelt an den Erfolgschancen des Konstrukts. „Ich bin skeptisch, ob eine Ein-Personen-Partei in Deutschland wirklich funktioniert“, sagt er. Zwar gebe es internationale Beispiele für solche personenbezogenen Bewegungen wie mit Sebastian Kurz in Österreich oder Emmanuel Macron in Frankreich. Aber im deutschen System dürften sich positive und negative Effekte der Fixierung auf eine Person eher die Waage halten, glaubt er. (Reuters)