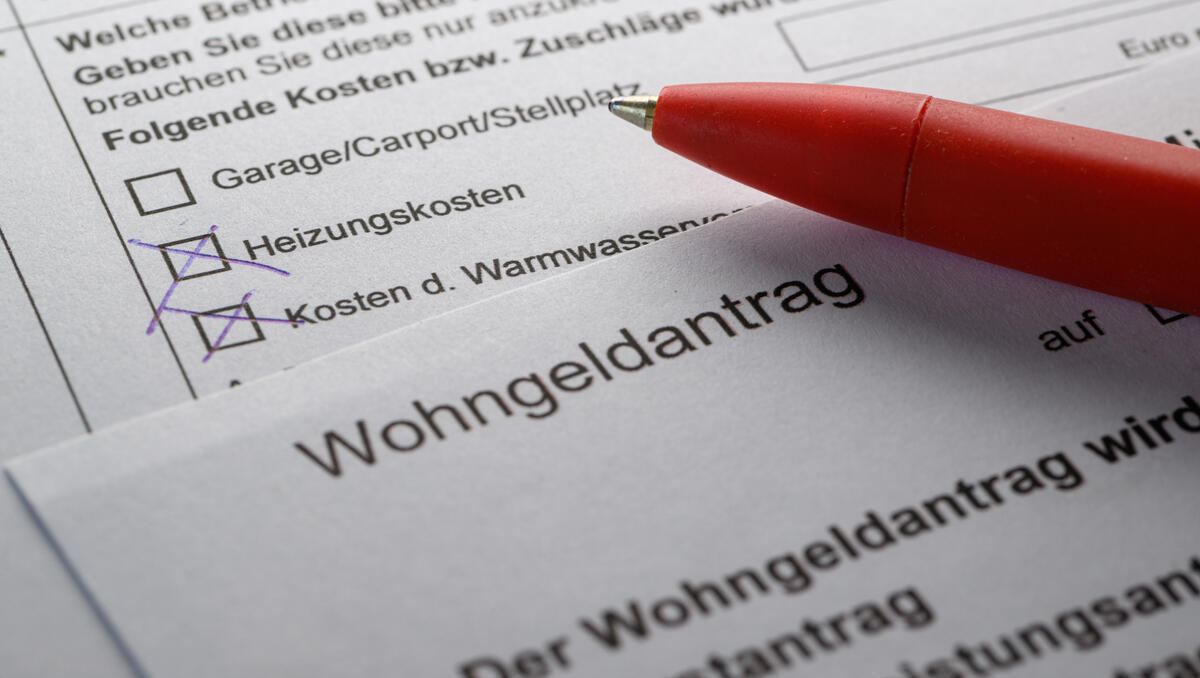Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat mit seinem Vorschlag einer Neuaktivierung der Wehrpflicht eine Diskussion ausgelöst. Sein Konzept sieht eine Reform der Wehrpflicht mit einer selektiven Einberufung vor: Ein verpflichtendes Auswahlverfahren soll bestimmen, wer zum Wehrdienst einberufen wird. Weitere Personen könnten alternativ sozialen oder ökologischen Dienst leisten. Das Ziel des Verteidigungsministers: eine flexiblere und bedarfsgerechtere Wehrpflicht, von der sowohl die Bundeswehr als auch der soziale Bereich profitieren.
Dafür sollen junge Menschen zwischen 18 und 25 Jahren bis zu einem Jahr entweder bei der Bundeswehr oder in sozialen Einrichtungen mitwirken können. Während Männer in das verpflichtende Auswahlverfahren einbezogen werden, bleibt die Teilnahme für Frauen aus Verfassungsgründen freiwillig. Das Konzept soll nicht nur die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands stärken, sondern auch dem Fach- und Arbeitskräftemangel im sozialen Bereich entgegenwirken. Könnte eine neue Wehrpflicht also auch den Zivildienst wiederbeleben? Experten aus dem Sozial- und Wohlfahrtsbereich bezweifeln dies.
Realistische Umsetzbarkeit fraglich
Dr. Joß Steinke, Bereichsleiter für Fragen der Sozial- und Wohlfahrtsarbeit beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) in Berlin, hält eine Rückkehr zum klassischen Zivildienst für kaum umsetzbar. “Ich halte einen verpflichtenden Gesellschaftsdienst oder eine Wiedereinführung des Zivildienstes in diese Richtung schon deswegen für in keinster Weise realistisch, weil allein der Aufbau einer Administration am Arbeitskräftemangel scheitern würde”, so Steinke und fügt hinzu: “Wir stehen erst am Anfang eines Arbeitskräftemangels. Die geburtenstarken Jahrgänge der sogenannten Babyboomer gehen erst jetzt in Rente, das Problem wird sich also erst noch verschärfen.”
Auch Rainer Hub, der bei der Diakonie Deutschland in Berlin die strategische Entwicklung und Koordination der Freiwilligendienste mitverantwortet sowie im Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) die politische Lobbyarbeit im Bereich des zivilgesellschaftlichen Engagements mitgestaltet, sieht eine Rückkehr des Zivildienstes auf Basis des Grundgesetzes und Paragraf 4.3. der Kriegsdienstverweigerung nicht: “Wenn alle müssen, müssen auch alle irgendwo untergebracht werden.” Das sei organisatorisch kaum zu bewältigen und finanziell unrealistisch. Für eine flächendeckende Pflichtlösung wären laut Hub 12 bis 15 Milliarden Euro pro Jahr nötig. “Mittel hiervon wären besser investiert in eine deutliche Stärkung und Weiterentwicklung der Freiwilligendienste, um Anreize für gesellschaftliches Engagement zu schaffen, anstatt junge Menschen zu zwingen.”
Kritik übt Hub auch an der Position der Union, die in einem eigenen Vorschlag eine allgemeine Dienstpflicht für Jugendliche fordert: “Dieser Vorschlag ist weder praktikabel noch gerecht. Es geht nicht darum, junge Menschen zu einer Dienstpflicht zu verdonnern, sondern ihnen sinnvolle Möglichkeiten der gesellschaftlichen Teilhabe zu bieten.” Zudem übersehen Teile in der Union, dass es bereits funktionierende Freiwilligendienste gebe, die mit mehr Unterstützung eine weitaus nachhaltigere Wirkung entfalten könnten.
Alternative zum Zivildienst: Ausbau der Freiwilligendienste
Steinke und Hub sind sich einig, dass die grundsätzliche Bereitschaft in der Gesellschaft für zivilgesellschaftliches Engagement hoch ist. “Wir erleben jeden Tag, dass Menschen sich engagieren wollen, allerdings nur, wenn die Rahmenbedingungen stimmen”, beobachtet DRK-Fachmann Steinke. Das Problem liege nicht am mangelnden Willen, sondern an fehlenden Strukturen und finanziellen Anreizen. “Viele junge Menschen sind bereit, sich sozial zu engagieren, aber sie müssen sich das leisten können”, ergänzt Rainer Hub von der Diakonie. “Ohne eine stabilere Finanzierung werden Freiwilligendienste weiterhin für viele unattraktiv bleiben bzw. nicht möglich sein.”
“Wir brauchen ein Recht AUF, keine Pflicht ZUM Freiwilligendienst”
Sowohl das DRK als auch die Diakonie Deutschland plädieren daher für eine Stärkung der bestehenden Freiwilligendienste. “Wir sind für den Ausbau und die Weiterentwicklung der Freiwilligendienste, weil sie freiwillig besser wirksam werden”, sagt Hub, schließlich sprächen die Zahlen für sich: Seit der Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 sei die Zahl der Freiwilligendienstleistenden von 35.000 auf rund 100.000 gestiegen. “Wenn das Budget mitwächst, könnten wir das mittelfristig auf 200.000 steigern”, so Hub weiter. Dafür müsse aber die Finanzierung geklärt werden.
Die Kosten für alle Formate der Freiwilligendienste belaufen sich laut Hub bei 100.000 Teilnehmenden auf ca. 600 Millionen Euro pro Jahr. Bei einer Verdoppelung auf 200.000 Teilnehmende und der gleichzeitigen Weiterentwicklung der Rahmenbedingungen lägen die Kosten bei gut zwei Milliarden Euro jährlich. “Das ist deutlich günstiger als eine allgemeine Dienstpflicht, die mit bis zu 15 Milliarden Euro pro Jahr zu veranschlagen wäre”, zitiert der Experte der Diakonie Berechnungen von Wirtschaftswissenschaftlern.
Hinzukomme für Hub, dass die intrinsische Motivation für ein soziales oder ökologisches Jahr viel wichtiger sei als eine verpflichtende Teilnahme: “Menschen, die sich freiwillig engagieren, bleiben der Gesellschaft oft langfristig verbunden und setzen ihr Engagement auch später fort.” Deutschland brauche ein Recht auf einen Freiwilligendienst, keine Pflicht zum Dienst. "Nur so kann echte gesellschaftliche Verantwortung entstehen.
Kirche und Gesellschaft: Kritik an einer Dienstpflicht
Während die finanzielle Argumentation klar für den Ausbau der Freiwilligendienste spricht, bleibt die gesellschaftliche Akzeptanz einer verpflichtenden Dienstpflicht umstritten. In einer gemeinsamen Stellungnahme äußerten sich etwa das Kommissariat der deutschen Bischöfe (DKB) und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) kritisch zu einer Dienstpflicht.
DKB und EKD plädieren stattdessen für eine bessere strukturelle Förderung freiwilliger sozialer Dienste. Zugleich warnen sie vor Zwangsmaßnahmen, die nicht nur ineffizient seien, sondern auch gegen grundlegende Prinzipien des Engagements verstoßen könnten. “Zwangsdienste führen nicht zu nachhaltigem gesellschaftlichem Engagement”, so Rainer Hub von der Diakonie Deutschland. “Was wir brauchen, sind Rahmenbedingungen, die den Freiwilligendienst attraktiver machen und Menschen aller gesellschaftlichen Schichten ermöglichen, sich zu engagieren.”
Vision 2030: Ein Rechtsanspruch auf Freiwilligendienst
Als Antwort auf diese Herausforderungen setzt die Initiative ‘Freiwilligendienste Vision 2030’ von zivilgesellschaftlichen Organisationen und Wohlfahrtsverbänden auf eine langfristige und strukturell verankerte Förderung. Kernpunkte sind ein Rechtsanspruch auf einen Freiwilligendienst für alle, die sich engagieren wollen, ein staatlich finanziertes Freiwilligengeld in Höhe des BAföG, um finanzielle Hürden abzubauen, sowie eine systematische Einladung und Beratung aller Schulabgänger, um Freiwilligendienste attraktiver zu machen.
Nach Berechnungen der Initiative wäre eine Verdoppelung der Freiwilligendienstplätze auf 200.000 mit zusätzlichen 2,7 Milliarden Euro realisierbar – und damit immer noch deutlich günstiger als eine Dienstpflicht. “Wir haben bereits funktionierende Strukturen”, betont Joß Steinke vom Deutschen Roten Kreuz. “Diese auszubauen und besser zu fördern, wäre ein sehr effizienter und zielführender Weg. Das ist besser als vermeintlich einfache Lösungen in die Welt zu setzen, die am Ende kaum umsetzbar sind.”
Folgen knapper Finanzierung
Steinke warnt darum eindringlich vor den Folgen einer unzureichenden Finanzierung der Freiwilligendienste: “Wir stehen insgesamt im sozialen Sektor schlechter da als vor fünf Jahren bei Beginn der Corona-Pandemie. In der Pflege fehlen Kapazitäten, Klinikinsolvenzen nehmen zu, die Sozialberatung wird zurückgefahren und soziale Angebote fehlen oder stehen vor dem Aus.” Hohe Bürokratie und überbordende Dokumentationen seien ein weiteres Problem. Der DRK-Experte sieht hier ein besonderes Misstrauen gegenüber der sozialen Arbeit.
“Wir müssen uns ein Beispiel an den großen Kampagnen für MINT-Berufe nehmen und zudem über neue Finanzierungsmöglichkeiten nachdenken”, forderte Steinke. Langfristige Finanzierungsmodelle und eine gezielte Digitalisierung, zum Beispiel im Bereich der Beratungsleistungen, seien daher viel nachhaltiger. Ganz ähnlich sieht das Rainer Hub von der Diakonie Deutschland mit Blick auf die Freiwilligendienste: “Wenn das Budget so bleibt oder weiter gekürzt wird, werden wir keine nachhaltige Wirkung erzielen. Die Schere zwischen Kosten und Refinanzierung ist in den letzten Jahren zunehmend auseinander gegangen. Die Refinanzierung muss dringend überdacht werden.”
Bundestagswahl 2025 ist Weichenstellung für die Zukunft
In ihrem Bundestagswahlpapier 2024 fordern die Verbände eine langfristige Sicherung und Verbesserung der Freiwilligendienste. Dazu gehören ein gesetzlich verankertes Recht auf Freiwilligendienst mit auskömmlicher Finanzierung auf BAföG-Niveau, eine kostenlose Nutzung des Nah- und Fernverkehrs für Freiwilligendienstleistende sowie eine stärkere Förderung von Bildungsangeboten zur Stärkung von Demokratiekompetenz und gesellschaftlichem Engagement.
“Ein gut ausgestatteter Freiwilligendienst ist die realistischere und effektivere Lösung als eine Dienstflicht für alle”, resümiert Joß Steinke vom DRK. Rainer Hub von der Diakonie Deutschland ergänzt: “Die Politik muss begreifen, dass wir keine kurzfristigen Wahlkampfversprechen brauchen, sondern eine nachhaltige Finanzierung und Strukturverbesserungen. Ohne klare langfristige Konzepte werden wir in fünf Jahren die gleichen Probleme diskutieren – nur unter noch schwierigeren Bedingungen.”
Steinke unterstreicht zudem, dass Zivildienst nicht die Antwort auf alle Probleme sei: “Er ist ein Diskussionsstrang, aber nicht die Lösung für die Herausforderungen im sozialen Bereich.” Er betont, dass sehr viele Menschen sich auf soziale Dienste und Einrichtungen fest verlassen. Gleichzeitig laufen überall im Land Kürzungsdiskussionen. „Zu sagen, wir können uns das alles nicht mehr leisten, ist einfach. Aber die Folgen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt sind fatal. Wir dürfen daher von denen, die Kürzungen vorschlagen oder vorsehen, daher auch Antworten auf die Frage erwarten, wie Menschen denn bei Wegfall dieser Leistungen künftig versorgt, aufgefangen und beraten werden sollen.“
Diakonie sieht politische Risiken durch mangelnde Finanzierung
Rainer Hub vom BBE warnt zudem vor den politischen Folgen einer unzureichenden Finanzierung und vor der Gefahr, dass Parteien wie die AfD von einer wachsenden Unzufriedenheit mit sozialen Strukturen profitieren könnten. “Wenn wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht aktiv fördern, indem wir freiwilliges Engagement stärken, überlassen wir das Feld denen, die einfache Antworten auf komplexe Probleme geben”, so Hub. Zudem kritisiert er die Haltung der CDU/CSU in der Debatte: “Wer sich das 'C' im Namen gibt, sollte sich auch für eine soziale Verantwortung einsetzen. Eine allgemeine Dienstpflicht löst keine Probleme, sondern schafft neue.”Beide Experten sind sich einig: Die Bundestagswahl wird maßgeblich darüber entscheiden, ob Freiwilligendienste gestärkt oder Verpflichtungen eingeführt werden, die in der Praxis kaum realisierbar sind. “Wenn wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt wirklich fördern wollen, wäre es klug, die richtigen Anreize setzen – damit ist wahrscheinlich auch am meisten zu erreichen”, bekräftigt Steinke.