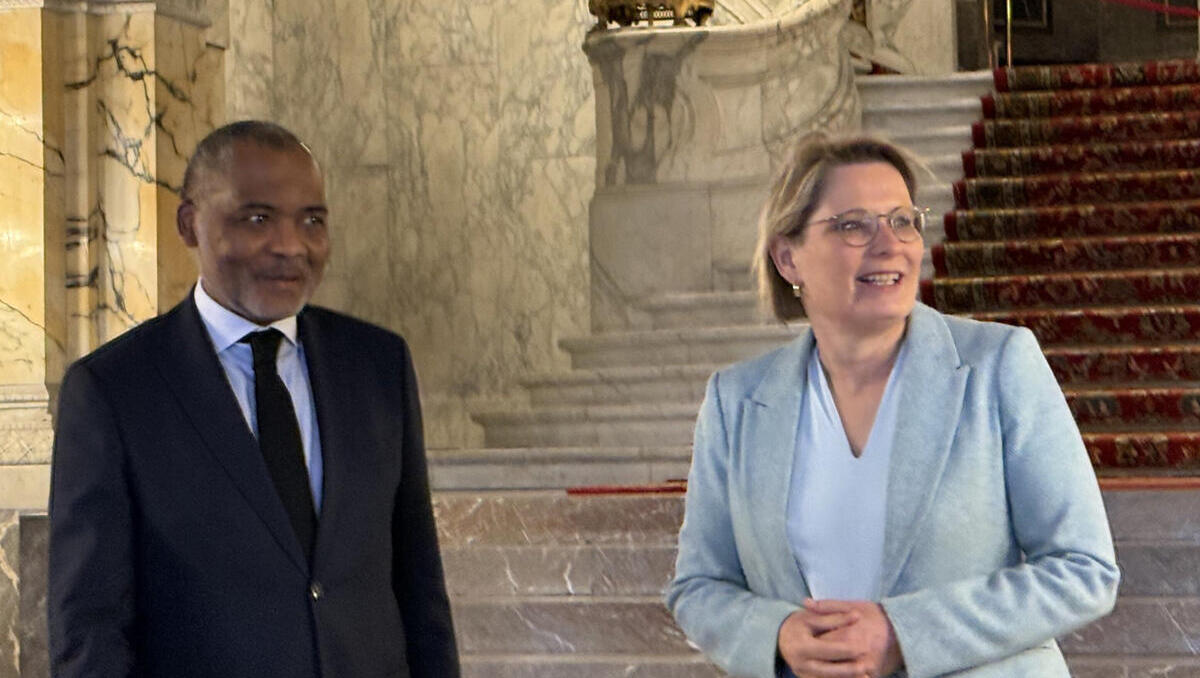Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Herr Professor Plumpe, über 150.000 Menschen haben auf Youtube einen Kurzvortrag von Ihnen angeschaut. In dem Video weisen Sie auf zahlreiche Probleme hin, die die deutsche Wirtschaft betreffen. Wie sind die Reaktionen auf diesen Vortrag ausgefallen?
Werner Plumpe: Reaktionen auf solche historischen Diagnosen, die einen starken Bezug zur Gegenwart haben, sind in der Regel zustimmend. Allerdings erwarten viele Zuhörer anschließend eine Art Lösung – also konkrete Vorschläge, wie sich die aktuelle Lage verbessern lässt. Als Wirtschaftshistoriker bin ich jedoch oft nicht in der Lage, diese Art von Therapie zu liefern, da es schwierig ist, die Zukunft zuverlässig zu analysieren.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Würden Sie als Historiker sagen, dass es sich um eine „normale“ Wirtschaftskrise handelt, oder ist diese in gewisser Weise einzigartig, etwa in ihrer Schwere?
Werner Plumpe: Ich halte sie auf jeden Fall für einzigartig. Was die aktuelle Situation historisch besonders macht, ist die seit etwa 30 Jahren rückläufige Produktivitätsentwicklung. Die wirtschaftliche Dynamik ist sehr gering, und die Krisen – sei es politischer, militärischer oder wirtschaftlicher Natur – treffen auf eine ohnehin schwache Wirtschaft mit niedrigen Investitionsquoten. Diese Kombination aus niedriger ökonomischer Dynamik und vielfältigen Krisenphänomenen ist in der Tat historisch einzigartig.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Woran liegt es, dass die Produktivität zurückgeht?
Werner Plumpe: Um es genauer zu sagen: Seit Mitte der Neunziger Jahre sind die Produktivitätszuwächse deutlich gesunken, und seit etwa 2018/2019 nimmt die Produktivität sogar ab – das bedeutet die Wirtschaftsleistung pro Kopf. Dafür gibt es viele Gründe. Im Kern steht eine sehr niedrige Investitionsquote, sowohl von privaten als auch öffentlichen Seiten – also der Anteil von Investitionen in Maschinen, Fabriken, Straßen etc. an der Wirtschaftsleistung. Ein Grund hierfür ist, dass sich Investitionen in Industrieunternehmen weniger lohnen als Investitionen im Finanzsektor, die oft nicht direkt zur Produktivität beitragen. Auch die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank hat eine Rolle gespielt: Die langen Phasen niedriger Zinsen haben den Druck auf Unternehmen verringert, profitabel zu wirtschaften. Dadurch konnten sich weniger produktive Unternehmen am Markt halten, die unter normalen Bedingungen nicht überlebensfähig gewesen wären – ein Phänomen, das als „Zombiefizierung“ bezeichnet wird. Zudem sind die bürokratischen und regulatorischen Belastungen für Unternehmen stark gestiegen. Auch die politische Förderung des Niedriglohnsektors, etwa durch die Hartz-IV-Reformen, hat eine Rolle gespielt. Dies führte dazu, dass in Deutschland wenig produktive Tätigkeiten stark gewachsen sind.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Sie haben in Ihrem Vortrag darauf hingewiesen, dass die Investitionsquote Ende der Siebziger Jahre bei 8 Prozent lag, was damals bereits als bedenklich galt. Heute liegt sie bei nur 2 Prozent. Gab es einen bestimmten Zeitpunkt, an dem Deutschland „falsch abgebogen“ ist, oder war das ein schleichender Prozess?
Werner Plumpe: Ich würde sagen, es war ein schleichender Prozess, der in vielen westlichen Ländern zu beobachten ist, aber in Deutschland besonders ausgeprägt ist. Es gab nicht den einen entscheidenden Moment oder die eine politische Maßnahme, die alles verändert hat.
Beispielsweise wurden die Hartz-IV-Reformen als wichtige Maßnahme zur Stabilisierung des Arbeitsmarktes betrachtet, ohne die langfristigen Folgen für die Produktivität zu berücksichtigen. Auch die Niedrigzinspolitik, die mit dem sogenannten Quantitative Easing begann und letztlich auf den ehemaligen US-Notenbankchef Alan Greenspan zurückgeht, wurde nicht sofort als problematisch erkannt. Es ist also das Resultat vieler einzelner Entscheidungen, die zusammen diesen schleichenden Prozess ausgelöst haben – bis er Ende der 2010er Jahre unübersehbar wurde.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: In Ihrem Vortrag sagen Sie, dass die deutsche Industrie vor allem darunter leide, dass ihre alten Stärken geopfert worden seien. Könnten Sie das näher erläutern?
Werner Plumpe: Die wichtigsten Punkte sind schnell genannt: Deutschland verfügte über ein großes Arbeitskräftepotenzial, das gut ausgebildet und im internationalen Vergleich relativ kostengünstig war. Heute gibt es einen Mangel an hochqualifizierten und gut ausgebildeten Fachkräften – nicht nur bei Akademikern, sondern auch bei Facharbeitern. Dieser Mangel wird sich durch den demografischen Wandel weiter verschärfen. Der Versuch, diese Arbeitskräfte durch Zuwanderung zu ersetzen, hat bislang nicht funktioniert, da viele Zuwanderer nicht den Anforderungen des Arbeitsmarktes entsprechen. Das führt zu der paradoxen Situation, dass die Zahl der qualifizierten Arbeitskräfte sinkt, während die Zahl der wenig qualifizierten Arbeitskräfte steigt.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Welche weiteren Stärken hat Deutschland eingebüßt?
Werner Plumpe: Der Wirtschaftsstandort profitierte lange von einer günstigen Energieversorgung. Im 19. Jahrhundert und der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es Kohle, die in Deutschland in großen Mengen vorhanden war. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es das Erdöl, das sogar mit erheblichen Preisvorteilen nach Deutschland kam, um die Kohle zu verdrängen. Als die Sorge aufkam, dass Erdöl knapp werden könnte, wurde es durch Atomenergie und importiertes Erdgas ersetzt oder ergänzt. Jetzt sollen all diese Energieträger abgeschafft werden. Das bedeutet, dass die deutsche Industrie derzeit mit einem Wechsel der Energiequellen zurechtkommen muss, der ihre Kostenstrukturen grundlegend verändert und sie im internationalen Wettbewerb zurückwirft – ebenso wie bei den Arbeitskräften.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Welche Rolle spielt der Staat in diesem Zusammenhang?
Werner Plumpe: Schaut man sich die Zahlen an, wird schnell deutlich, dass der Staat einen erheblichen Teil der Wirtschaftsleistung beansprucht. Die Staatsquote – der Anteil der Staatsausgaben am BIP – liegt heute bei etwa 50 Prozent, die Staatsverschuldung sogar noch höher. Historisch gesehen ist das außergewöhnlich. Im Kaiserreich lag die Staatsquote bei etwa 15 Prozent, und während des Wirtschaftswunders bis 1969 unter 30 Prozent. Heute leisten wir uns im historischen Vergleich einen sehr großen und sehr teuren Staat. Der Staat hat mittlerweile mit fast 6 Millionen Beschäftigten ein historisches Hoch erreicht und ist faktisch der größte Wirtschaftssektor Deutschlands. Hinzu kommt, dass die Kosten durch Regulierung und Bürokratie deutlich gestiegen sind. Wenn man diese drei Faktoren – Bürokratie- und Staatskosten, Energiekosten sowie die Verschlechterung der Arbeitskräftestruktur – berücksichtigt, wird deutlich, dass sie die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft erheblich belasten. Viele Unternehmen ziehen deshalb in Erwägung, ob andere Standorte für sie nicht vorteilhafter wären.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Wenn man dies mit anderen Ländern vergleicht, würden Sie sagen, dass Deutschlands Wirtschaft besonders schlecht dasteht?
Werner Plumpe: Andere westliche Länder stehen vor ähnlichen Problemen. Aufgrund der Wirtschaftsgeschichte Deutschlands, mit einem besonders großen Industriesektor, trifft es unser Land jedoch besonders hart. Noch immer werden in Deutschland etwa 25 Prozent der Wertschöpfung in der Industrie erzielt, während dieser Anteil in den USA, Frankreich oder Großbritannien niedriger ist. Das bedeutet, dass das industrielle Herz der deutschen Wirtschaft besonders stark betroffen ist. Und das passiert zu einer Zeit, in der sich die internationale Konkurrenzsituation dramatisch verschärft hat – vor allem durch den Aufstieg Chinas und anderer asiatischer Länder. Chinesische Unternehmen haben deutlich niedrigere Produktionskosten. Ein gutes Beispiel dafür ist die deutsche Automobilindustrie: Der technologische Vorsprung in der Verbrennungstechnologie war historisch einzigartig, doch durch die Energie- und Klimapolitik musste dieser Vorteil aufgegeben werden, um sich auf die Elektromobilität zu konzentrieren. Hier treten nun chinesische Unternehmen als ernstzunehmende Konkurrenten auf.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Wie steht Deutschland in wichtigen technologischen Bereichen wie Künstlicher Intelligenz oder Energietechnik da?
Werner Plumpe: In der Künstlichen Intelligenz spielt Deutschland – und Europa insgesamt – kaum eine Rolle. Die meisten Patente in diesem Bereich stammen aus den USA, Japan, Südkorea und China. In der Atomtechnologie war Deutschland früher führend, doch heute ist das industrielle Wissen und die Forschung in diesem Bereich nicht mehr auf dem neuesten Stand. Die Forschung wurde weitgehend eingestellt.
Dieses Muster zeigt sich auch in vielen anderen Technologiebereichen. Der Staat fokussiert sich stark auf sogenannte grüne Technologien und erneuerbare Energien, die entweder technologisch nicht besonders anspruchsvoll sind oder sich wirtschaftlich nicht rentieren, wie beispielsweise die Wasserstofftechnologie. Das führt dazu, dass wissenschaftliche Disziplinen, die für die Industrie von hoher Bedeutung sind, an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Wir investieren enorm in die Energiewende und stecken dort immense finanzielle sowie geistige Ressourcen hinein. Das mag politisch gewollt sein, aber für die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland ist es nicht vorteilhaft.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Jemand wie Robert Habeck würde vermutlich argumentieren, dass wir heute handeln müssen, um den CO2-Ausstoß zu verringern, da die Folgen in 40 oder 50 Jahren gravierend wären. Menschen müssten in manchen Teilen der Welt umgesiedelt werden und die Temperaturen würden extrem steigen. Was würden Sie dem entgegnen?
Werner Plumpe: Ich würde sagen, man kann versuchen, den Klimawandel zu verhindern, aber ich halte es für ziemlich aussichtslos, vor allem, wenn das nur von Deutschland aus geschieht. Den Klimawandel kann man nicht aufhalten, man kann lediglich versuchen, ihn zu begrenzen. Aber wir stellen unsere Energiebasis um und investieren nicht wirklich in Bereiche, die tatsächlich wirksam sein könnten. Man müsste vor allem Technologien und Möglichkeiten in Entwicklungsländern viel stärker unterstützen.
Außerdem kann man versuchen, auf die Veränderungen und Schwankungen des Klimas mit technologischer Anpassung zu reagieren. Gerade im Bereich der Kernenergie gibt es Möglichkeiten, CO2-neutrale Energie zu erzeugen. Doch hier geht es nicht darum, die Wirtschaft durch technologische Anpassungen zukunftsfähig zu machen. Es geht vielmehr um ideologische Programme. Ich glaube, es ist manchen sogar recht, wenn man die Automobilindustrie zerstört oder erheblich verkleinert.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Sie spielen auf diejenigen an, die sich für „Degrowth“, also das Schrumpfen der Wirtschaft, aussprechen.
Werner Plumpe: Ja, meine Position ist klar: Man hätte die traditionellen Stärken weiterentwickeln müssen, um die Industrie, insbesondere das produzierende Gewerbe sowie Forschung und Entwicklung, auf eine klimakompatible technologische Weise zu modernisieren. Durch einen wirtschaftlichen Strukturwandel hätte man die Herausforderungen bewältigen können. Die deutsche Wirtschaft hat sich in den letzten 200 Jahren enorm verändert. Heute erinnert kaum noch etwas an die Wirtschaft vor 150 Jahren. Es gibt keinen Grund, diesen dynamischen Wandel zu unterschätzen oder gar zu blockieren. Doch genau das geschieht gerade mit der grünen Industriepolitik, die glaubt zu wissen, was zukunftsfähig ist, dabei aber die historisch gewachsenen Stärken der deutschen Wirtschaft ignoriert.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Man sollte also auf die Innovationskraft des Marktes vertrauen – dass Unternehmen mit cleveren Ideen kommen werden, um CO2 zu sparen?
Werner Plumpe: Genau. Wir befinden uns doch nicht auf dem technologischen Stand der Siebziger oder Achtziger Jahre. Weltweit wird über neue Generationen von Reaktoren diskutiert, über neue Methoden im Umgang mit nuklearen Abfällen und vieles mehr. Doch in Deutschland herrscht seit den Achtziger und Neunziger Jahren eine apokalyptische Stimmung, die besagt: „Das geht auf keinen Fall, das muss alles weg.“ Man tut so, als sei die technologische Entwicklung in diesem Bereich stehen geblieben. Aber das ist nicht der Fall. Auch die Atomenergie unterliegt dynamischen technologischen Veränderungen, deren Potenzial man nicht einfach verschenken sollte. Doch Deutschland steigt vollständig aus und setzt auf Solar- und Windenergie, was zu offensichtlichen Problemen führt, insbesondere im Winter. Es fehlt eine grundlastfähige Energieversorgung, die Preise sind extrem volatil und hoch, was die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft beeinträchtigt. Eine Hochtechnologie wird verdrängt und durch eine nicht funktionierende Technologie ersetzt, die keine konkurrenzfähigen Kostenstrukturen ermöglicht.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Würden Sie sagen, dass die ökonomische Bildung in der breiten Bevölkerung abgenommen hat? Etwa gibt es Aussagen von Politikern, die ein mangelndes Verständnis von Wirtschaft nahelegen.
Werner Plumpe: Ich glaube nicht, dass die wirtschaftliche Bildung in der Bevölkerung generell abgenommen hat. Sicher gibt es heute mehr Menschen, die glauben, man müsse nicht arbeiten, sondern könne ein Grundeinkommen vom Staat beziehen. Das ist eine gewisse Verarmung des ökonomischen Wissens. Aber diese Erklärung ist mir zu einfach. Das Hauptproblem sehe ich bei der politischen Elite und den Meinungsmachern. Vielen fehlt das Basiswissen über wirtschaftliche Zusammenhänge und die Konsequenzen politischen Handelns. Sie glauben an Theorien wie die „Modern Monetary Theory“, die meint, man könne unbegrenzt Schulden machen. Das ist ein politischer Machbarkeitswahn, der wenig mit der ökonomischen Realität zu tun hat.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Wie hat es Deutschland in der Vergangenheit geschafft, sich aus Wirtschaftskrisen zu befreien?
Werner Plumpe: Ein Beispiel sind die Siebziger Jahre. Die Bundesrepublik hat damals gut mit Krisen umzugehen gewusst, weil wir eine stabilitätsbewusste Bundesbank hatten. Diese gibt es heute nicht mehr, die Geldpolitik wird jetzt von der EZB gemacht. Ein weiterer Punkt war die Fähigkeit zur „inneren Abwertung“, also die Bereitschaft, sich Krisen durch eigene Sparsamkeit und wirtschaftliche Anpassung zu stellen. Diese Haltung, dass harte Arbeit und Anpassung erforderlich sind, ist heute kaum noch vorhanden. Heute dominiert die Vorstellung, der Staat werde schon zahlen.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Wie beurteilen Sie in diesem Zusammenhang die libertäre Reformpolitik von Javier Milei in Argentinien? Er hat die Staatsausgaben drastisch reduziert und die Hälfte aller Ministerien geschlossen. Wäre das auch für Deutschland sinnvoll?
Werner Plumpe: Man muss abwarten, was dabei herauskommt. Was Milei macht, ist ein Experiment. Erste Daten, etwa zur Inflation, zeigen positive Veränderungen. Die bisherigen wirtschaftspolitischen Maßnahmen Argentiniens, die auf Staatsaufblähung und Verschuldung setzten, haben nicht funktioniert. Milei versucht nun eine drastische Wende. Angesichts der argentinischen Erfahrung gibt es kaum Alternativen.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Sehen Sie einen Silberstreifen am Horizont – wird sich Deutschland von seiner wirtschaftlichen Schwäche befreien können?
Werner Plumpe: Kurzfristig nicht. Es gibt keine politischen Mehrheiten für grundlegende Reformen. Man wird am überdimensionierten Sozialstaat und der grünen Transformation festhalten, obwohl das teuer und ineffizient ist. Man wird die Schuld anderen geben: Putin, China, Trump. Eine echte Selbstreflexion sehe ich nicht. Erst wenn die Finanzierungsmöglichkeiten durch Steuern und Schulden drastisch eingeschränkt werden, könnte sich etwas ändern. Im Moment sind die finanziellen Spielräume aber noch zu groß, um den Kurs zu ändern.
***
Werner Plumpe (geboren 1954 in Bielefeld) ist ein deutscher Wirtschaftshistoriker. Er war von 1999 bis 2022 Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Frankfurt am Main. Von 2008 bis 2012 war er Vorsitzender des Verbandes der Historiker und Historikerinnen Deutschlands. Er forscht unter anderem zur Geschichte von Wirtschaftskrisen und des Kapitalismus. Zuletzt erschienen die Bücher “Das kalte Herz: Kapitalismus, eine andauernde Revolution” (2019) und “Wirtschaftskrisen: Geschichte und Gegenwart” (2017).