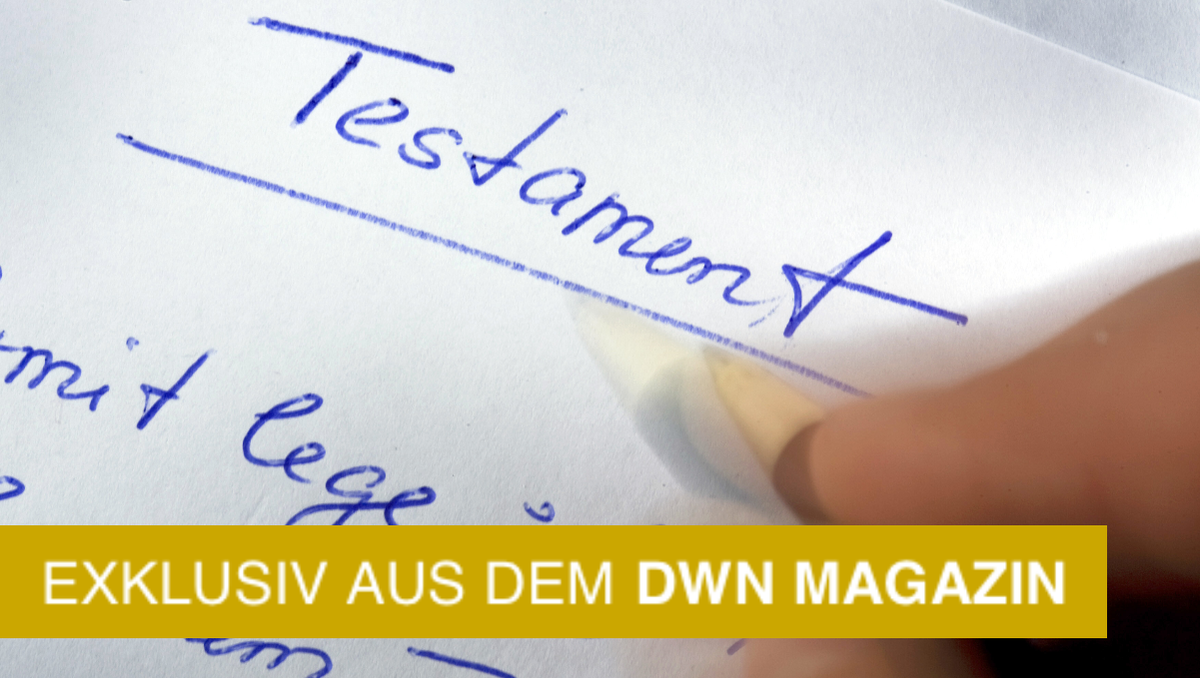Im Februar 2001 erschienen in der „New York Times“ und im „Wall Street Journal“ Anzeigen von rund 120 vermögenden US-Amerikanern. Zu den Unterzeichnern zählten Multimilliardäre wie Warren Buffett und George Soros. In den Aufrufen warnten sie davor, die Erbschaftssteuer abzuschaffen. Ihr Argument: Dies wäre „schlecht für unsere Demokratie, unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft“. Ausgerechnet jene, die von einem Wegfall der Steuer am meisten profitiert hätten, traten öffentlich für eine Begrenzung ihres Reichtums ein.
Hintergrund der Aktion war eine Steuerreform, die der US-Kongress unter dem damaligen Präsidenten George W. Bush geplant hatte, inklusive der vollständigen Abschaffung der Erbschaftssteuer, in der politischen Debatte auch als „death tax“ bezeichnet, also als „Sterbesteuer“. Der Begriff war Teil einer politischen Kampagne der Republikaner, welche die Erbschaftssteuer emotional negativ aufladen und öffentlich delegitimieren sollte. Zum damaligen Zeitpunkt lag der Spitzensteuersatz für Nachlässe über fünf Millionen Dollar bei 55 Prozent. Das heißt: Für alles, was über dieser Schwelle lag, mussten Erben mehr als die Hälfte an den Staat abführen.
Die Erbschaftsgesellschaft wächst
Ein Vierteljahrhundert später ist das Thema auch in Deutschland präsent, doch eine breite gesellschaftliche Debatte bleibt weitgehend aus. Während in den USA offen über Vermögenskonzentration und Gerechtigkeit gestritten wird, herrscht hierzulande bemerkenswerte Stille. Die Erbschaftsteuer bleibt ein Politikum. Fakt ist: Wer heute in Deutschland zu Vermögen kommt, tut dies immer seltener durch unternehmerisches Risiko. „Nicht mehr die eigene Leistung, sondern die Herkunft entscheidet immer häufiger über den Vermögensstand“, heißt es in einem Beitrag des SWR mit dem Titel „Gerechter erben“.
Tatsächlich wurden im Jahr 2023 Erbschaften und Schenkungen im steuerlich erfassten Umfang von 121,5 Milliarden Euro veranlagt. Das ist ein Anstieg um 19,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr und zugleich ein historischer Höchstwert. Berücksichtigt man die zahlreichen steuerfreien Übertragungen, die durch hohe Freibeträge nicht erfasst werden, dürfte das tatsächliche jährliche Erbschaftsvolumen laut Experten deutlich höher liegen, in konservativen Schätzungen bei rund 400 Milliarden Euro.
In ihrer Studie „Erben und Vererben 2024“ spricht die Deutsche Bank von einer „wachsenden Bedeutung vererbter Vermögen“ für die Altersvorsorge und den Vermögensaufbau. Demnach rechnen bereits 34 Prozent der künftigen Erben mit einer Erbschaft von mindestens 250.000 Euro. Zugleich ist das Erbe ungleich verteilt. So erwarte in Ostdeutschland nur etwa jeder Sechste eine Erbschaft, in Westdeutschland dagegen jeder Vierte. Die Studie spricht in diesem Zusammenhang von einem strukturellen Wandel, bei dem die Herkunft stärker über die Vermögensperspektiven entscheidet als die individuelle Leistung. Dadurch gerate die soziale Mobilität unter Druck, was weitreichende Folgen für das gesellschaftliche Verständnis von Gerechtigkeit in einer auf Eigenleistung gegründeten Ordnung habe.
„Erbschaften sind nicht mehr Randphänomene, sondern ein zentrales Element der Vermögensbildung”, schreibt Isabell Stamm vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. In ihrem Beitrag „Vermögende Familien im Kapitalismus” aus dem Jahr 2021 hat sie analysiert, wie dynastische Familien durch Vererbung zu dauerhaften Machtfaktoren werden. Ihre Diagnose: Vermögen vererbt sich zunehmend, anstatt es sich zu erarbeiten, was gravierende Folgen für die soziale Gerechtigkeit hat.
“Wer nichts hat, kann nichts vererben”
Laut einer repräsentativen Umfrage des Berliner Instituts Steuerpol mit dem Titel "Neid oder soziale Gerechtigkeit?" aus dem Jahr 2022 hat rund ein Drittel der Deutschen bereits geerbt oder rechnet damit, in naher Zukunft zu erben. Doch nicht alle profitieren davon gleichermaßen: „Die untere Hälfte der deutschen Haushalte verfügt nach Abzug der Schulden über quasi kein Vermögen und kann daher auch nichts vererben“, heißt es in der Studie.
Besonders problematisch ist, dass der Großteil der Erbschaften an die obersten 20 Prozent der Vermögenspyramide fließt, oft zusätzlich zu bereits vorhandenem Kapital, Immobilien und Unternehmensbeteiligungen. Laut dem Deutschen Institut für Altersvorsorge (DIA) stieg der Anteil geerbter Immobilien innerhalb von nur fünf Jahren von 40 auf 54 Prozent.
Dabei verfestigt sich nicht nur wirtschaftliche Ungleichheit, sondern auch politische Einflussnahme. „Über das Eigentum an Unternehmen können vermögende Familien strukturellen Einfluss auf die deutsche Wirtschaft ausüben“, analysiert Isabell Stamm. Dieser Einfluss werde durch Erbschaften nicht etwa abgebaut, sondern perpetuiert.
Lange galt das Prinzip „Wer viel leistet, soll auch viel haben“ als moralischer Pfeiler der Sozialen Marktwirtschaft. Doch dieses Narrativ bröckelt. Besonders sichtbar wird dies an der Spitze: Laut der bereits zitierten Studie der Deutschen Bank aus dem Jahr 2024 basiert ein erheblicher Teil des heutigen Milliardärsvermögens nicht auf unternehmerischem Aufbau, sondern auf Erbschaften.
OECD: Deutschland ist Steueroase fürs Erbe
Während in Frankreich, Großbritannien und den USA seit vielen Jahren über progressive Erbschaftssteuern und Sozialdividenden debattiert wird und bis zu 40 Prozent der Erbmasse in die öffentliche Hand fließen (in Großbritannien und den USA ab rund 325.000 Pfund bzw. 13,6 Millionen Dollar und in Frankreich ab etwa 1,8 Millionen Euro innerhalb der Familie), fallen die Belastungen in Deutschland deutlich geringer aus. „Im Durchschnitt werden Erbschaften mit rund 2,5 Prozent besteuert“, kritisiert das Steuerpol-Institut.
Eine politische Neuausrichtung hat bislang nicht stattgefunden. Im April 2025 legte die neue Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD ihren Koalitionsvertrag mit dem Titel „Verantwortung für Deutschland“ vor. Aussagen zu einer Reform der Erbschaftsteuer bleiben darin jedoch vage. In einem begleitenden Positionspapier der CDU/CSU-Fraktion heißt es: „Die Erbschaftsteuer darf Familienunternehmen nicht gefährden. Freibeträge müssen so gestaltet sein, dass Substanz und Arbeitsplätze gesichert bleiben.“
Bereits im Jahr 2021 stellte die OECD fest, dass Deutschland im internationalen Vergleich nur einen Bruchteil des möglichen Aufkommens aus Erbschaften abschöpft. In vielen Mitgliedstaaten liegen die Einnahmen aus Erbschaftsteuern bei bis zu einem Prozent des Bruttoinlandsprodukts, in Deutschland hingegen nur bei rund 0,2 Prozent.
Darum lehnen die Deutschen höhere Erbschaftsteuern ab
Zwar orientieren sich politische Reformvorschläge zur Erbschaftsteuer zunehmend an diesen ökonomischen Realitäten, doch die gesellschaftliche Akzeptanz bleibt ein Hindernis. Die von vermögenden Unternehmerkindern getragene Initiative „taxmenow“ fordert deshalb eine Neujustierung: Betriebsvermögen soll durch Freibeträge geschützt werden, nichtbetriebliche Vermögensanteile hingegen sollen regulär besteuert werden.
Doch Vorschläge dieser Art stoßen nicht nur auf politischen Widerstand. Auch in weiten Teilen der Bevölkerung ist die Bereitschaft zu mehr Umverteilung gering. Eine Umfrage der DZ BANK aus dem Jahr 2022 hat gezeigt, dass bereits damals 63 Prozent der Bevölkerung die Erbschaftsteuer selbst bei hohen Vermögen als ungerecht empfinden. Das hat auch strukturelle Gründe: „Die Ablehnung der Erbschaftsteuer speist sich vielfach aus dem Gefühl, der Staat habe über andere Steuerarten bereits genug Zugriff auf das private Vermögen genommen“, heißt es in der Steuerpol-Analyse.
Neben einem diffusen Misstrauen gegenüber staatlicher Umverteilung spielten laut Steuerpol zudem kulturelle Normen eine Rolle, zum Beispiel die tief verankerte Vorstellung, dass familiärer Besitz grundsätzlich geschützt gehöre. Dies erschwert eine sachorientierte Debatte über Verteilungsgerechtigkeit und Wettbewerbsneutralität im Unternehmensbereich.
„Vermögende Familien schulen Erben als Gesellschafter“
Während Teile der Bevölkerung dem Staat beim Zugriff auf Erbschaften misstrauen, formiert sich im Hintergrund eine neue Realität: Immer mehr Vermögen konzentriert sich in den Händen weniger Familien. Doch was passiert mit dem geerbten Kapital?
Die Antwort lautet selten: Investition in neue Produktivität. Vielmehr werden Immobilienportfolios erweitert, Beteiligungen gestreut, Family Offices gegründet. „Der Verkauf von Unternehmensanteilen ist inzwischen zu einer geteilten Erfahrung vermögender Familien geworden“, schreibt Soziologin Isabell Stamm vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in ihrer Analyse “Vermögende Familien im Kapitalismus”. Das Vermögen bleibe, nur der Verwalter ändere sich.
Dadurch wachse eine neue Klasse von „Gesellschafter-Erben“ heran. Sie führen nicht mehr aktiv Unternehmen, sondern lassen ihr Kapital global, diversifiziert und steueroptimiert arbeiten. „Vermögende Familien bauen heute die Kompetenz ihrer Mitglieder als aktive Gesellschafter auf“, heißt es weiter bei Stamm.
Doch wie nutzen diese Erben ihr Vermögen? Laut dem UBS Billionaire Ambitions Report 2024 setzen viele Nachkommen großer Vermögen auf Werterhalt statt Innovation. Ihr Kapital wird überwiegend in Immobilien, global gestreuten Fonds oder Beteiligungen geparkt – statt in neue Unternehmen investiert. Die Soziologin Isabell Stamm analysiert diesen Trend kritisch: „Die Herausforderung besteht darin, dass Erben strategisch, aber selten gesellschaftlich denken.“ Diese Haltung, so Stamm, bremse die gesellschaftliche Dynamik: Kapital bleibe unbewegt und dringende Herausforderungen unfinanziert.
Bildung reicht nicht: Wenn der Aufstieg am Kapital scheitert
Abseits der Erbschaftsdebatte offenbart sich ein tiefer liegendes Problem: Die soziale Mobilität ist ins Stocken geraten. Während das Bildungssystem formell Chancengleichheit verspricht, dominieren in der Realität Besitzverhältnisse. Laut Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) ist der soziale Aufstieg in Deutschland insbesondere für Kinder aus Haushalten mit niedrigem Einkommen blockiert.
Selbst bei vergleichbarem beruflichem Erfolg erwerben Bildungsaufsteiger, sogenannte Erstakademiker, seltener nennenswertes Vermögen. Die Erklärung dafür ist einfach und strukturell bedingt: Wer kein Startkapital mitbringt, hat geringere Spielräume für unternehmerisches Risiko oder Vermögensaufbau. Das untergräbt nicht nur die Bedeutung individueller Leistung, sondern entwertet auch das Versprechen des Bildungssystems – und damit einen Grundpfeiler der Sozialen Marktwirtschaft.
Vom Generationenvertrag zum Generationsprivileg?
Zurück bleibt eine Frage, die weit über die Steuerpolitik hinausgeht: Was bedeutet Gerechtigkeit in einer Gesellschaft, in der Kapital legal und leistungsfrei weitergereicht wird und damit auch die damit einhergehende Macht?
Der politische US-Philosoph John Rawls schrieb 1971 in seinem Werk „A Theory of Justice”, dass gesellschaftliche und wirtschaftliche Ungleichheiten nur dann gerechtfertigt sind, wenn sie zum größtmöglichen Vorteil der am wenigsten begünstigten Mitglieder der Gesellschaft wirken.
Mit Blick auf das deutsche Erbschaftssystem im Jahr 2025 scheint dieses Kriterium jedoch kaum erfüllt zu sein. Im Gegenteil: Vermögen zementiert zunehmend Herkunft und Status, ohne dass strukturell etwas davon bei den Schwächeren ankommt. So wird die ursprünglich als familiäre Fürsorge über den Tod hinaus gedachte Erbschaft zur Systemfrage für eine Demokratie, die sich Leistung und Chancengleichheit auf die Fahnen schreibt, aber unverdientes Vermögen kaum antastet.