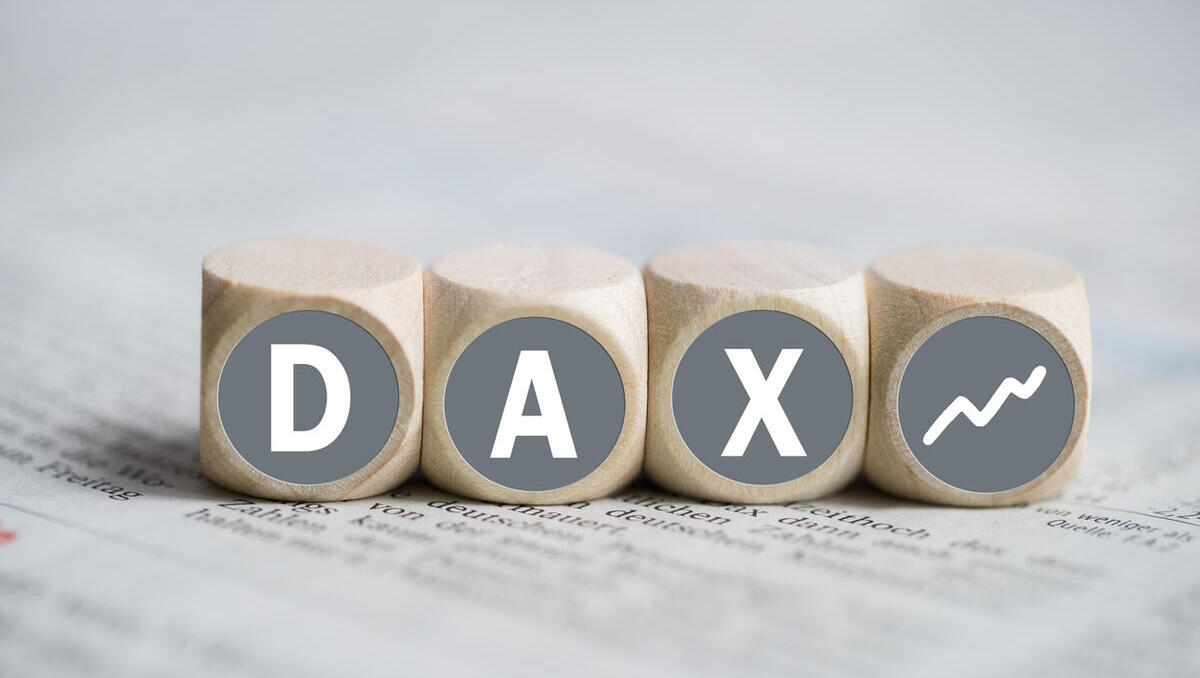Wirtschaftskollaps in Afrika – und Europa schaut weg
Die USA kürzen massiv die Entwicklungshilfe und drohen mit Handelskrieg. In Schwellenländern – darunter viele in Afrika – gefährdet das das Wachstum und birgt die Gefahr neuer Migrationsbewegungen. Die afrikanischen Volkswirtschaften stehen unter Druck. Hunderttausende junger Menschen drängen auf den Arbeitsmarkt – doch ihre Zukunftsaussichten sind düster. Das birgt das Potenzial neuer Flüchtlingswellen Richtung Europa. Das berichtet das Wirtschaftsportal Børsen.
Helfer und Experten schlugen Alarm, als die Trump-Regierung im Januar und Februar ihre Pläne zur Abwicklung der US-Entwicklungshilfeagentur USAID ankündigte. Zunächst wurde jegliche US-Entwicklungshilfe für 90 Tage eingefroren. Danach zeigten durchgesickerte Dokumente: Die Regierung will den Großteil des Budgets und der Aktivitäten von USAID streichen. Die Agentur wird derzeit mit dem Außenministerium zusammengelegt. Zwar sind nicht alle Hilfsprogramme gestoppt – nach Gerichtsurteilen und politischem Druck –, doch viele bleiben ausgesetzt, Tausende Beschäftigte verlieren ihre Stelle. Laut einem Leak an den Guardian werden sämtliche Auslandsstellen gestrichen. Laut einer Zählung der New York Times wurde rund 40 Prozent des Budgets gekappt – das entspricht dem Wegfall von 86 Prozent aller Programme. Internationale Medien zitieren Politiker und Hilfsorganisationen mit der Einschätzung, dass Europa das dadurch entstehende Vakuum kaum füllen könne. Auch viele europäische Staaten kürzen derzeit ihre Entwicklungsetats. Davon betroffen sind auch etliche afrikanische Staaten. Und die stehen ohnehin vor weit größeren Herausforderungen.
Strafzölle und Unsicherheit
Die Weltbank warnte in mehreren Berichten zuletzt eindringlich vor gravierenden Risiken für Schwellen- und Entwicklungsländer. Laut ihren Prognosen werden in den kommenden zehn Jahren rund 1,2 Milliarden Menschen in Entwicklungsländern ins Erwerbsleben eintreten – aber nur etwa 420 Millionen neue Arbeitsplätze werden entstehen. Trump hat zudem neue, hohe Zölle gegen zahlreiche Länder angekündigt – darunter auch in Afrika. Rohstoffe, mit denen viele Schwellen- und Entwicklungsländer bislang Exporteinnahmen erzielen, dürften laut jüngster Weltbank-Prognose weiter im Preis fallen – unter anderem wegen der allgemeinen Wachstumsschwäche und sinkender Nachfrage nach fossilen Energieträgern wie Kohle und Öl. Der Preisverfall werde laut Weltbank das Wachstum in zwei Dritteln der Entwicklungsstaaten dämpfen. Für dieses Jahr erwartet die Bank ein Minus von 12 Prozent, 2025 sollen die Preise um weitere 5 Prozent fallen – auf den tiefsten Stand seit 2020. „Höhere Rohstoffpreise waren für viele Entwicklungsländer ein Segen“, erklärt Indermit Gill, Chefökonom der Weltbank, in einem schriftlichen Kommentar. „Doch derzeit erleben wir die stärksten Preisschwankungen seit über 50 Jahren. Die Kombination aus hoher Volatilität und niedrigen Preisen schafft ernste Probleme.“
In der aktuellen Global Economic Prospects-Studie spricht die Weltbank von „negativen Szenarien“, die derzeit das Bild für die Entwicklungsländer prägen. Nach mehreren globalen Erschütterungen stehe die Weltwirtschaft erneut vor „erheblichem Gegenwind durch wachsende Handelskonflikte und zunehmende politische Unsicherheit“, heißt es in dem Bericht. Die Möglichkeiten der Entwicklungsländer, Einkommensungleichheiten zu verringern, Beschäftigung zu schaffen und extreme Armut zu bekämpfen, seien „unzureichend“. Besonders gravierend: Ausländische Direktinvestitionen in Entwicklungsstaaten seien in den letzten Jahrzehnten stark zurückgegangen und machten nur noch weniger als die Hälfte des Rekordwerts von 2008 aus. „Mit Ausnahme Asiens verwandeln sich viele Entwicklungsländer in entwicklungsfreie Zonen“, schreibt Weltbank-Ökonom Gill.
Mehr Menschen auf dem Weg
Der ehemalige USAID-Direktor Brian Atwood bezeichnete die Schließung der Agentur als „Katastrophe in Zeitlupe“, mit Folgen für Gesundheit, Ernährungssicherheit und Migration. „Viele, viele Menschen werden betroffen sein“ – und: „Es wird deutlich mehr Migration geben“, warnt er. Zwar ist die Zahl neu ankommender Migranten in der EU seit der Flüchtlingskrise 2015/16 stark zurückgegangen. Doch das Thema bleibt akut: 2023 und 2024 wurden jeweils über 200.000 Ankünfte registriert. Auch Nahost- und Nordafrika-Expertin Yasmine Jarhloule, die für Oxford University und die Denkfabrik Carnegie arbeitet, warnt vor neuen Migrationswellen. Die EU habe zwar die Zusammenarbeit mit Transitländern in Nordafrika verstärkt. Doch ohne eine Bekämpfung der Ursachen werde das die illegale Migration nicht aufhalten, schreibt sie. „Mit lokalen Akteuren an der Lösung bewaffneter Konflikte zu arbeiten“ und „die Staaten in ihrer Stabilisierung zu unterstützen“, könne helfen, strukturelle Ursachen anzugehen. Doch in Europa fehle weitgehend der politische Wille, afrikanische Krisen grundlegend zu lösen, so Jarhloule. Gleichzeitig verweist sie auf die Vielzahl der Migrationsursachen – wirtschaftliche wie politische. Auch ohne vollständige Verantwortung übernehmen zu müssen, könne Europa viel tun, schreibt sie. Selbst wenn USAID nicht ersetzt werden könne, müsse die EU versuchen, zur Entwicklung beizutragen. Denn Grenzzäune, Patrouillen und Deals mit Nachbarstaaten reichten allein nicht aus: „Man kann beispielsweise die Privatwirtschaft fördern und Investitionen gezielt in Schlüsselbranchen lenken – wie etwa in die Automobilindustrie Marokkos.“ Solche Maßnahmen, ergänzt durch Ausbildungsprogramme, könnten „lokale Beschäftigung schaffen“ und „Kapitalflucht eindämmen“, so die Forscherin. „Die europäischen Staaten könnten einige der Hauptursachen der Migration bekämpfen – und gleichzeitig den afrikanischen Ländern helfen. Ohne diesen Ansatz ist ein grundlegender Wandel der Migrationsdynamik schwer vorstellbar.“