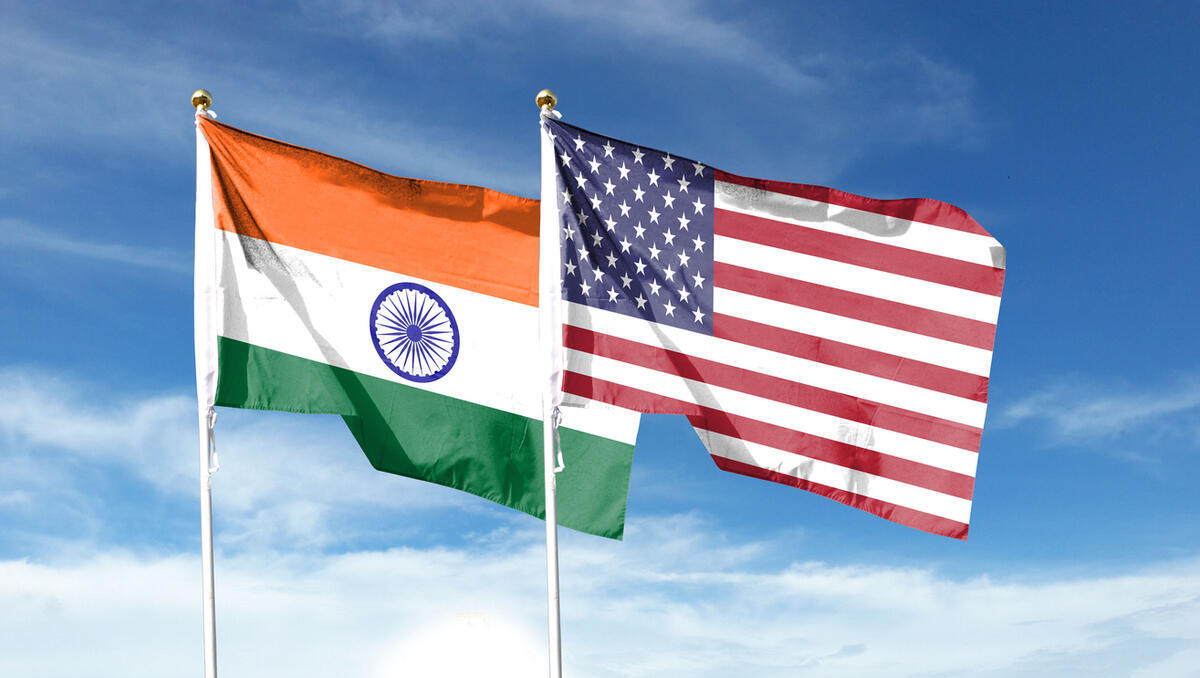Ölpreis rutscht ab
Die Nordseesorte Brent ist auf den niedrigsten Stand der vergangenen fünf Monate gefallen. Am Dienstag sank der Preis auf etwas über 62 US-Dollar pro Barrel (159 Liter). Dieses Niveau wurde zuletzt im Mai erreicht. Analysten führen den Rückgang auf eine Kombination aus schwächerer Nachfrage, wachsender globaler Fördermenge und hohen Lagerbeständen zurück.
Seit Jahresbeginn hat die Brent-Notierung fast ein Viertel an Wert verloren. Im Januar lag der Preis an der Terminbörse ICE noch bei 82,03 Dollar pro Barrel, am 5. Mai fiel er auf 60,23 Dollar und am 14. Oktober schloss er bei 62,39 Dollar. Damit ist der Ölpreis aktuell rund 25 Prozent niedriger als zu Jahresbeginn. Im Kern, so sagen Analysten, liege das Problem auf der Hand: Das weltweite Angebot übersteigt seit Monaten die Nachfrage.
Nachfrageeinbruch durch schwache Wirtschaft
Auf der Nachfrageseite machen Ökonomen vor allem die schwächeren makroökonomischen Rahmenbedingungen verantwortlich. Die Weltwirtschaft zeigt deutliche Anzeichen einer Abkühlung. Das betrifft sowohl China als auch die USA und Europa. Hinzu kommen erneute Handelsspannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China, die zusätzliche Unsicherheit schaffen.
Die jüngste Entscheidung Pekings, Exportkontrollen für Seltene Erden einzuführen, gilt als neue Eskalationsstufe im technologischen Handelskonflikt. Washington reagierte mit der Ankündigung weiterer Strafzölle. Diese geopolitischen Spannungen dämpfen Investitionen und belasten die Aussichten für den globalen Energieverbrauch. Darüber hinaus wirken auch strukturelle Faktoren: energieeffizientere Fahrzeuge, die weniger Treibstoff verbrauchen, sowie die zunehmende Elektrifizierung des Verkehrs verringern den Bedarf an fossilen Brennstoffen.
Überproduktion und Rekordlagerbestände
Auf der Angebotsseite hat sich die Lage deutlich verschärft. Laut dem Oktoberbericht der Internationalen Energieagentur (IEA) lag die weltweite Rohölförderung im September bei 108 Millionen Barrel pro Tag. Das sind 5,6 Millionen Barrel mehr als im gleichen Monat des Vorjahres. Im Durchschnitt wird für dieses Jahr eine Produktion von rund 106 Millionen Barrel täglich erwartet.
Sowohl die Mitgliedstaaten der erweiterten OPEC+ als auch die US-Produzenten haben ihre Fördermengen erhöht. Die Kartellstaaten decken etwa 40 Prozent der weltweiten Ölproduktion ab, während die USA weiterhin Rekordmengen aus Schieferölquellen fördern. Gleichzeitig sind die weltweiten Lagerbestände auf den höchsten Stand seit vier Jahren gestiegen. Allein im August wuchsen die Vorräte um 17,7 Millionen Barrel auf 7,9 Milliarden Barrel. Auch die Menge des auf See gelagerten Rohöls hat laut Bloomberg historische Ausmaße erreicht: Mehr als eine Milliarde Barrel befinden sich derzeit entweder im Transit oder im Stillstand auf Tankern. Die IEA meldet, dass allein im September die sogenannten „tanker stocks“ um 102 Millionen Barrel zunahmen. Solche Werte wurden zuletzt im Jahr 2020 während der Pandemie registriert, als wegen der einbrechenden Nachfrage weltweit Öl auf Schiffen zwischengelagert wurde.
Prognosen: Überangebot bleibt bestehen
Die IEA erwartet, dass die Überproduktion auch im Jahr 2026 anhalten wird. Schon in diesem Jahr rechnet die Agentur mit einem durchschnittlichen Überschuss von drei Millionen Barrel pro Tag – rund zehn Prozent mehr als noch in der letzten Schätzung. Das weltweite Ölangebot wächst schneller als die Nachfrage, die 2024 nur um etwa 0,7 Millionen Barrel pro Tag steigen dürfte.
Für das kommende Jahr prognostiziert die IEA eine weitere Ausweitung der Produktion um 2,4 Millionen Barrel pro Tag. Im Umkehrschluss würde ein anhaltendes Überangebot den Ölpreis weiter unter Druck setzen. Wie stark dieser Effekt ausfallen wird, ist jedoch umstritten. Eine von Reuters durchgeführte Analystenumfrage ergab, dass die tatsächliche Überproduktion 2025 möglicherweise geringer ausfallen dürfte als von der IEA befürchtet, nämlich etwa 1,6 Millionen Barrel pro Tag. Auch die Rohstoffanalysten der UBS halten die Prognosen der Energieagentur für übertrieben. Sie argumentieren, dass sich gerade deshalb der Ölpreis bislang nicht noch stärker abgeschwächt habe. Gleichzeitig warnen die Schweizer Experten, dass geopolitische Risiken den Trend jederzeit umkehren könnten. Ein erneuter Kriegsschub in Russland oder im Nahen Osten könne das Angebot kurzfristig verknappen und die Preise wieder anheben.
Energiepolitik und geopolitische Dimension für Deutschland
Für Europa bleibt der niedrige Ölpreis ein zweischneidiges Schwert. Kurzfristig wirkt er preisdämpfend und entlastet Unternehmen sowie Verbraucher. Mittel- und langfristig jedoch birgt er strategische Risiken: Sinkende Preise verringern die Investitionen in Exploration, Raffinerien und alternative Energien. Damit wächst die Abhängigkeit von Billigimporten und der geopolitische Einfluss von Förderstaaten wie Saudi-Arabien oder den USA.
Zugleich zeigt der Preisrückgang, dass der globale Energiemarkt zunehmend instabil reagiert. Zwischen geopolitischen Konflikten, Handelsstreitigkeiten und strukturellem Nachfragerückgang könnte der Ölpreis in den kommenden Jahren zu einem der wichtigsten Indikatoren für die Verschiebung globaler Machtverhältnisse werden.Die jüngste Entwicklung auf dem Ölmarkt ist mehr als ein zyklisches Preissignal. Sie markiert eine strukturelle Veränderung im Energiesystem. Das Überangebot drückt nicht nur die Gewinne der Produzenten, sondern offenbart auch eine neue strategische Unsicherheit: Der Markt bleibt anfällig für Schocks, politische Entscheidungen und technologische Umbrüche. Ob der Ölpreis stabil bleibt oder weiter fällt, hängt weniger von der Nachfrage ab als von der Frage, welche Macht künftig die Angebotsseite kontrolliert: OPEC+, Washington oder Peking.