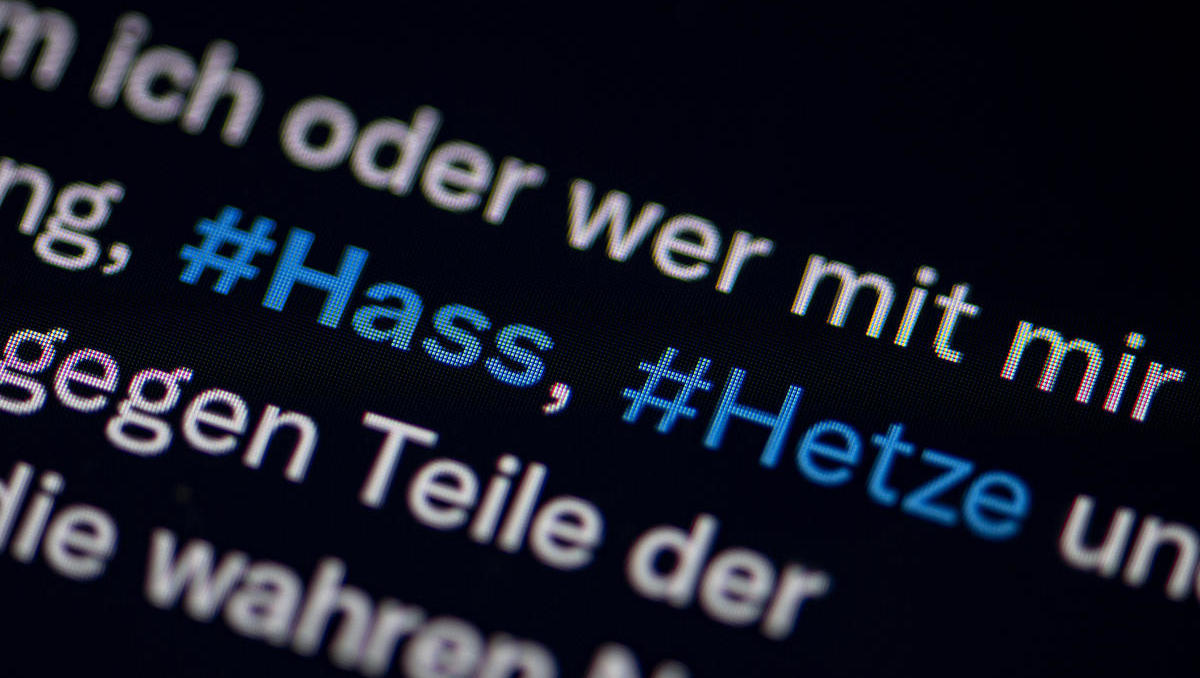Hans-Werner Sinn, der Chef des Münchner Ifo-Instituts, hat viele Gesichter: Wenn er über Target 2 spricht, sieht er den Weltuntergang bereits vor dem Isar-Tor. Wenn er eine Prognose über die Lage der deutschen Wirtschaft abgibt, ist alles paletti.
Ähnlich wolkenverhangen ist seine neueste Analyse der Lage nach der Italien-Wahl. Sinn sagt, vereinfacht: Es ist gut, dass es Berlusconi gibt. Denn dadurch wird der Euro weich und die Italiener tun sich leichter beim Export. Zugleich sagt Sinn: Es ist schlecht, dass es Berlusconi gibt, weil die Finanzmärkte nervös werden (siehe Italo-Bonds - hier). Und schließlich sagt Sinn, die EZB müsse sanft inflationieren, damit sich die Lage stabilisieren könne.
Der Euro brachte billige Kredite und sorgte zur Bildung von „inflationären Wirtschaftsblasen“, die mit dem Ausbruch der Finanzkrise platzten, schreibt Sinn. Dadurch hätten sich die Konditionen für Kredite schlagartig verschlechtert und völlig überteuerte Wirtschaftssysteme seien zurückgeblieben. Frankreichs Wirtschaft werde derzeit die starke Ausrichtung auf Südeuropa zum Verhängnis, so Sinn. Einer Studie von Goldman Sachs zufolge müsste Frankreich 35 Prozent billiger werden als Deutschland, „um im Verhältnis zum Ausland seine Schulden tragen zu können“.
Doch mittlerweile stehe die Euro-Rettungspolitik nun vor einem „fundamentalen Dilemma“. Auf der einen Seite, so der Präsident des Ifo-Instituts, stabilisiere die Geldpolitik der EZB die Zinssätze der Staatsanleihen und stützt damit die Haushaltslage der nationalen Regierungen. Dadurch stärkte sie das Vertrauen in den Euro. Der Eurokurs stieg. Auf der anderen Seite aber gefährdet dieser starke Euro die Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Wirtschaften, also die Realwirtschaft. „Die angebliche Rettungspolitik verschlimmert also die Rezession und erzeugt noch mehr Arbeitslosigkeit, als ohnehin schon vorhanden ist“, schreibt Sinn in seinem ifo Standpunkt „Kollateralschäden der Rettungspolitik“.
Umgekehrt sei es ein „Glück, dass es Silvio Berlusconi gibt“. Denn aufgrund seines Erfolges sank der Wert des Euros. Und dies sei genau das, was der Realwirtschaft nutzen würde. Der unangenehme Nebeneffekt ist jedoch, dass die Finanzmärkte sich destabilisieren, die Zinssätze infolgedessen steigen und somit die Handlungsfähigkeiten der Regierungen einschränken.
Beide Szenarien zeigen Sinn zufolge jenseits aller Ironie, dass das Auf und Ab des Wechselkurses die Grenzen der europäischen Rettungspolitik bestimme. Die EZB könne die „Aufwertung des Euro verhindern, indem sie ausländische Währungen durch Hergabe von Euro erwirbt.“ Sie müsse intervenieren und die eigene Währung inflationieren, bis sie das Vertrauen in den Euro wieder so weit verringert hat, wie sie (die EZB) es durch ihre Garantien erhöht hat.
„Ohne die stümperhaften Rettungsversuche der Politik hätte die Krise den Euro in eine starke Abwertung getrieben“ und so einen Teil der Volkswirtschaften Südeuropas bereits wieder wettbewerbsfähig gemacht, ergänzt Sinn. Durch die Abwertung wäre zudem „auf ganz natürliche Weise Kapital angezogen“ worden. Kapital, dass die Basis für ein neues Wirtschaftswachstum gelegt hätte. „Wenn Berlusconi sonst auch nicht viel Gutes bedeuten mag, so muss man ihm doch zugutehalten, dass er dieser Erkenntnis den Weg bereitet hat.“
Was Sinn nicht sagte: Das Dilemma ist nicht auflösbar, der Euro ist, sobald es kritisch wird, Un-Sinn. Es zeigt sich nämlich nun, dass im Euro zusammengezwungen wurde, was nicht zusammenpasst. Eine Währung muss die reale Wirtschaftskraft eines Landes widerspiegeln. In der Euro-Zone werden strukturell Äpfel mit Birnen verglichen. EZB-Chef Mario Draghi nennt das "Transmission". Wie er das Problem löst, weiß er selber nicht, wie ihm das WSJ neulich in einer Analyse bescheinigte.
Wenn jedoch ein Apfel in einem Korb mit Birnen zu faulen beginnt, ist der ganze Obstsalat am Ende ungenießbar. Vor diesem Dilemm stehen nun die deutsche Sparer, die den Preis für einen synthetischen, nicht zu Ende gedachten Euro-Raum zu bezahlen haben.