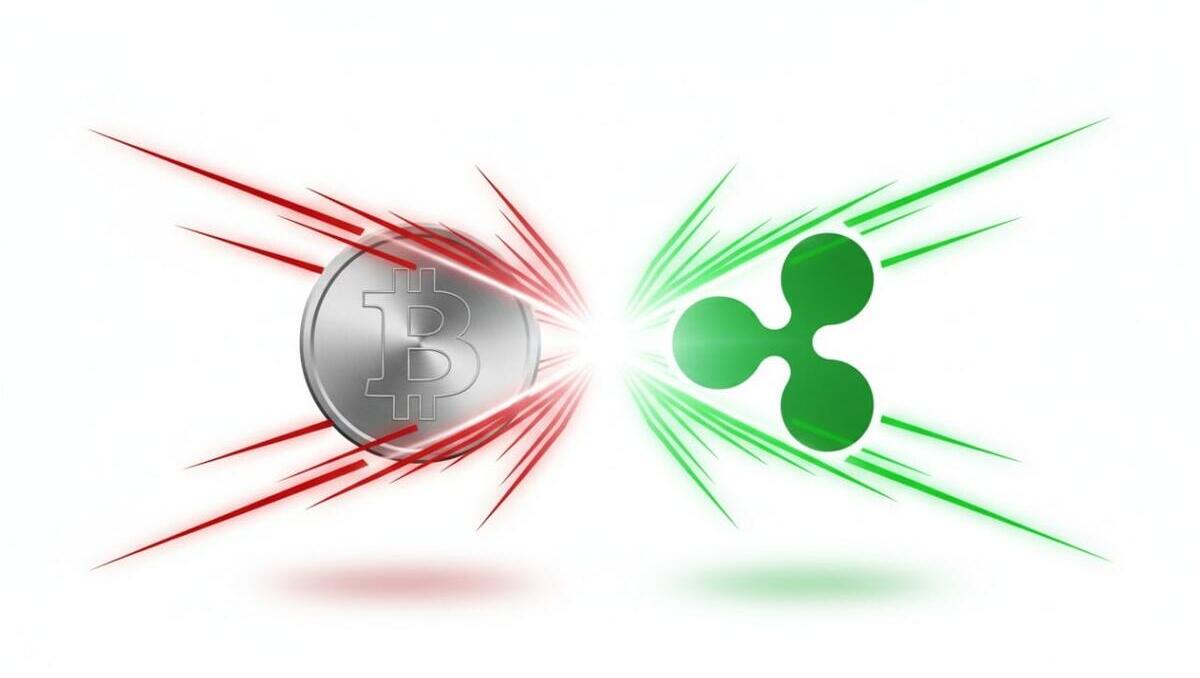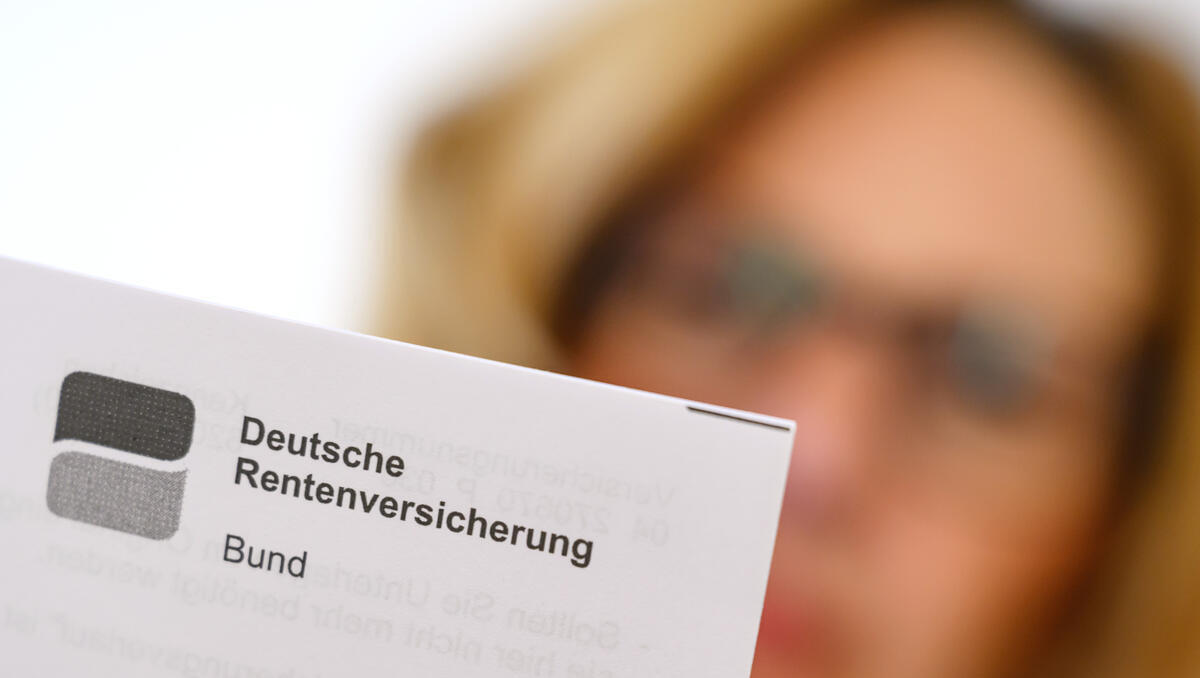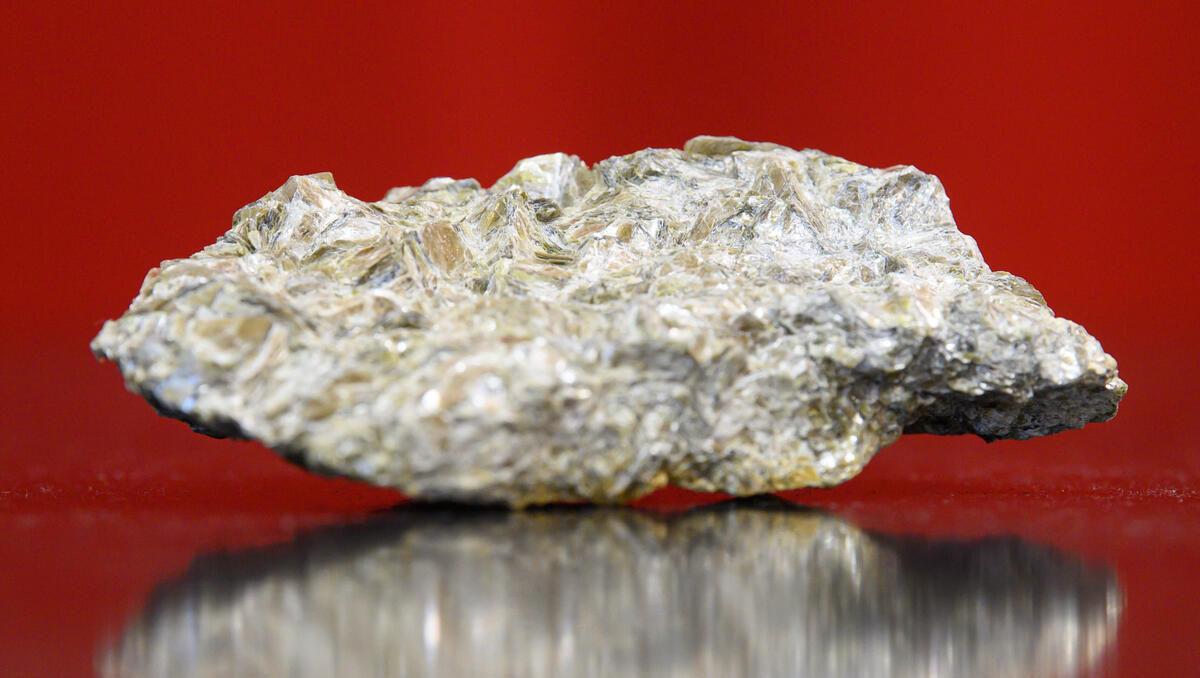Der Beginn eines neuen Jahres und sogar eines neuen Jahrzehnts ist ein guter Zeitpunkt dafür, langfristiger über die Wirtschaftspolitik nachzudenken. In den 2010ern, einer Dekade, die von den Folgen einer einmaligen Finanzkrise geprägt war, war ein starker monetärer und fiskaler Stimulus ganz klar gerechtfertigt. Tatsächlich herrscht heute allgemeine Einigkeit, dass die fast überall stattfindenden großen fiskalen Expansionen und die darauf folgende unkonventionelle Geldpolitik entscheidend dafür waren, dass sich die Große Rezession nicht in eine Wiederholung der Großen Depression der 1930er verwandelt hat.
Aber jetzt, wo die Krise überwunden ist, stellt sich insbesondere für die Politiker der Eurozone die Frage, ob diese Notfallmaßnahmen bis in die 2020er Jahre verlängert werden sollen – und wenn ja, welche langfristigen Folgen zu erwarten wären. Und hier stoßen wir schnell an der Grenze des ökonomischen Wissens.
Sowohl die Wirtschaftstheorie als auch viele Erfahrungen deuten darauf hin, dass Haushaltsstimuli kurzfristig zu höherer Nachfrage und Beschäftigung führen, insbesondere wenn sich die Finanzmärkte in Unordnung befinden. Aber wenn die Märkte normal funktionieren, sind sich die Ökonomen über die Langfristfolgen der Haushaltspolitik grundlegend uneinig. Obwohl die Theorie nahelegt, dass fiskalpolitische Maßnahmen die Ausgaben der Privathaushalte steigern können, werden die Konsumenten langfristig nur das ausgeben, was sie auch verdienen. Darüber hinaus ist die langfristige empirische Datenlage schwach, da nur wenige Länder über Jahrzehnte hinweg große Haushaltsdefizite eingegangen sind.
Das offensichtlichste Beispiel für ein Land, das seine Haushaltspolitik zum Kampf gegen einen andauernden wirtschaftlichen Abschwung eingesetzt hat, ist Japan. Dort begann dies vor fast genau dreißig Jahren, als im Land eine Immobilienblase platzte. Aber obwohl mehrere japanische Regierungen seitdem große Haushaltsdefizite eingegangen sind, blieb das BIP-Wachstum insgesamt schwach. Und obwohl sich Japans Pro-Kopf-Wachstum viel besser gehalten hat, lag es lediglich gleichauf mit dem anderer Industriestaaten mit deutlich geringeren Haushaltsdefiziten.
Manche argumentieren, ohne fiskale Ausweitung wäre das japanische Wachstum noch viel schwächer ausgefallen. Aber diese Annahme kann weder belegt noch widerlegt werden, da wir die letzten dreißig Jahre nicht mit einer anderen Politik wiederholen können.
Der Unterschied zwischen Japans Gesamt- und Pro-Kopf-Wachstumsraten unterstreicht die Bedeutung demografischer Trends für die langfristige Wirtschaftspolitik. Während die japanische Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter in den Boomjahren um etwa ein Prozent jährlich gestiegen ist, nimmt sie nun in einer ähnlichen Geschwindigkeit ab. Unter der Voraussetzung einer konstanten Produktion bedeutet dies, dass die Quote des potenziellen Wachstums im Land um etwa zwei Prozent zurückgegangen sein muss.
Die Eurozone erlebt gerade einen ähnlichen Trend: Es wird vorhergesagt, dass die Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter in ihren 19 Mitgliedstaaten in den nächsten Jahrzehnten um jährlich 0,4 Prozent sinkt.
Obwohl dieser Rückgang weniger ausgeprägt ist als in Japan, soll er sich fortsetzen, was darauf schließen lässt, dass auch die Eurozone vor einem Jahrzehnt geringen Gesamtwachstums steht (obwohl das Pro-Kopf-Einkommen dort weiterhin wachsen wird, weil die Produktivität – wenn auch langsam – steigt).
Die wirtschaftlichen Folgen eines demografischen Rückgangs zu akzeptieren, ist schwierig – vor allem dann, wenn sich die politischen Systeme darum drehen, immer mehr wirtschaftliche Gewinne an die Wähler zu verteilen. Ein logischer Weg dahin, alle durch eine sinkende arbeitsfähige Bevölkerung verursachten
Wachstumsbeschränkungen auszugleichen, besteht natürlich darin, das Renteneintrittsalter zu erhöhen. Angesichts der steigenden gesunden Lebenserwartung sollte dies im Prinzip möglich sein. Aber die aktuelle Streikwelle in Frankreich gegen die von Präsident Emmanuel Macron geplanten Rentenreformen verdeutlicht erneut, wie stark die Öffentlichkeit solche Maßnahmen ablehnt.
Eine politisch besser vermittelbare Art, das lahmende Wachstum in der Eurozone anzukurbeln, scheint darin zu bestehen, die Ausgaben für Infrastruktur zu erhöhen. Würde dies über höhere Schuldenaufnahme finanziert, wäre es haushaltspolitisch schmerzlos. Aber die japanische Erfahrung ist eine Warnung für die Politiker der Eurozone, Investitionen in Infrastruktur nicht als Wundermittel zu sehen. Als Japans Wachstumsraten in den frühen 1990ern zu sinken begannen, steigerten die Regierungen massiv die öffentlichen Ausgaben für Infrastruktur auf bis zu sechs Prozent des BIP – etwa das doppelte Niveau anderer Industriestaaten mit einem ähnlichen Pro-Kopf-BIP. Aber die japanischen Wachstumsraten gingen weiter zurück, und später wurde berichtet, ein großer Teil der zusätzlichen Ausgaben seien dazu verwendet worden, „Brücken ins Nirgendwo“ zu bauen.
Natürlich wird jede Regierung, die heute die Ausgaben für Infrastruktur erhöhen will, behaupten, ihre Investitionen seien viel gezielter und produktiver. Aber dies ist wahrscheinlich ein leeres Versprechen, da in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften einfach nicht mehr viele wirtschaftlich rentable Infrastrukturprojekte übrig sind.
Sogar öffentliche Investitionen in „grüne“ Infrastruktur sind nur als Ausweichmöglichkeit hilfreich und werden nur benötigt, wenn es unmöglich scheint, die Preise für Kohlenstoff stark genug zu erhöhen, um den privaten Sektor dazu zu veranlassen, die Emissionen für die Erfüllung der ehrgeizigen europäischen Klimaziele schnell genug zu verringern. Auf jeden Fall läge der Gewinn aus solchen grünen Investitionen nicht in einem stärkeren BIP-Wachstum, sondern in geringeren Emissionen – gut für den Planeten, aber nicht zur Steigerung der Löhne und Einkommen in Europa.
Insgesamt gehen die Gewinne aus Infrastrukturinvestitionen ziemlich schnell zurück. Obwohl eine mäßige Zunahme der Infrastrukturausgaben nach einer Periode mangelnder Investitionen nützlich sein könnte, sollte man davon nicht mehr als einen kurzfristigen Einfluss auf das Wachstum erwarten.
Ohne eine – politisch nicht durchsetzbare – höhere Einwanderung arbeitsfähiger Migranten hat Europa – und insbesondere die Eurozone – kaum eine andere Wahl, als sich auf ein „Zeitalter der verringerten Erwartungen“ vorzubereiten. Obwohl die Nationalregierungen stark versucht sein werden, die Expansionspolitik, die sich während der Krise anscheinend als effektiv erwiesen hat, zu lang fortzusetzen, werden sie dabei mit den Haushaltsregeln der Eurozone kollidieren. Sicherlich wurde die „drei Prozent des-BIP-Obergrenze für nationale Haushaltsdefizite“ des Maastrichter Vertrags während der Krise häufig kritisiert (und effektiv ignoriert). Aber jetzt kann sich diese Grenze als nützlich erweisen, um die exzessive Schuldenaufnahme der Regierungen zu verhindern, die verzweifelt versuchen, die unausweichlichen Folgen des demografischen Rückgangs auszugleichen.
Auch die Europäische Zentralbank wird ihre Prognosen nach unten korrigieren müssen. Auf dem Höhepunkt der Krise musste die EZB schwören, alles zu tun, „was nötig ist“, um den Euro zu schützen. Aber heute macht es für die Geldpolitiker wenig Sinn, auf zusätzliche Anleihekäufe zu bestehen, um ein schwer fassbares Inflationsziel zu erreichen.
Die 2010er waren ein außergewöhnliches Jahrzehnt, das in der Eurozone eine beispiellose Wirtschaftspolitik nötig machte. Jetzt allerdings müssen die EZB und die Haushaltspolitiker langfristiger denken und akzeptieren, dass die Folgen einer sinkenden Bevölkerung durch anhaltende wirtschaftliche Stimuli kaum ausgeglichen werden können.
Aus dem Englischen von Harald Eckhoff
Daniel Gros ist Direktor des Centre for European Policy Studies.
Copyright: Project Syndicate, 2020.