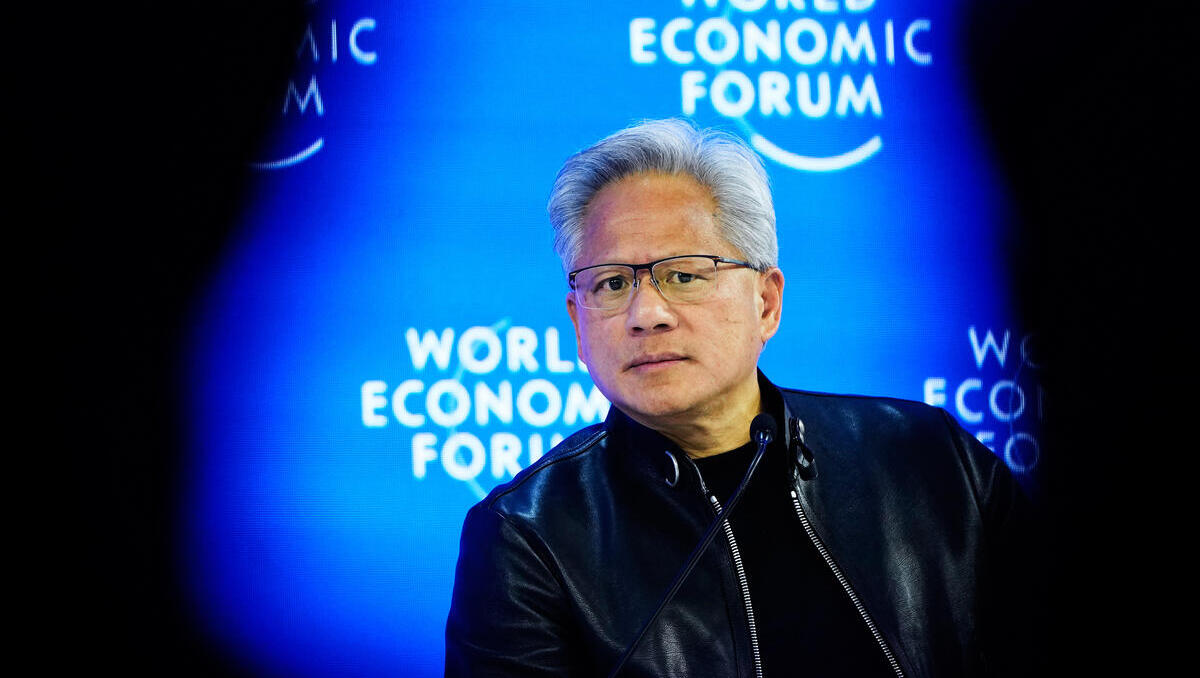In Argentinien mehren sich keine zwei Jahre nach einer Intervention des Internationalen Währungsfonds (IWF) die untrüglichen Anzeichen für neue Schuldenschnitte. So bereitet die neu gewählte Regierung in Buenos Aires derzeit Gespräche mit den Geldgebern vor, um die Rückzahlungskonditionen von Schulden im Gesamtvolumen von rund 100 Milliarden Dollar zu erleichtern – etwa, indem Laufzeiten von Anleihen verlängert werden.
Wie das Wall Street Journal berichtet, bittet der Gouverneur der bevölkerungsreichsten Provinz des Landes, Buenos Aires, zudem um eine Verlängerung der Rückzahlungsfrist für Schulden im Umfang von etwa 250 Millionen Dollar. Eigentlich sollten die Verbindlichkeiten am kommenden Sonntag beglichen werden.
Wenn solche Maßnahmen getroffen oder ausgehandelt werden, handelt es sich in der Fachsprache um je ein Kredit-Ereignis, und dieses hat unweigerlich Aktionen der Rating-Agenturen zur Folge. Kredit-Ereignisse führen auch unvermeidlich zu Neu-Bewertungen der Anleihen in den Büchern der Lebensversicherungen und anderer institutioneller Anleger.
Beide Ankündigungen haben deshalb zu Unruhe bei den Geldgebern geführt, die Preise für Anleihen der Provinz Buenos Aires sowie des Staates Argentinien sanken daraufhin in den vergangenen Tagen deutlich. Im Fall der Provinzanleihen brachen die Kurse zwischen dem 7. Januar und dem 17. Januar von rund 71 Cent für den Dollar auf 56 Cent für den Dollar ein. Die Preise für Staatspapiere dümpeln hingegen weiterhin bei etwa 48 Cent, nachdem sie im Juli 2019 von etwa 83 Cent eingebrochen waren.
Die US-amerikanische Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hatte die Kreditbewertung für Argentinien in lokaler Währung vor wenigen Tagen um eine Stufe gesenkt. Die neue Bewertung lautet "CC", nach zuvor "CCC-", teilte S&P mit. Mit der neuen Einstufung liegt das krisengeschüttelte südamerikanische Land bei S&P noch noch zwei Stufen oberhalb der Bewertung "Default", mit der ein Kreditausfall im Zuge einer Staatspleite gekennzeichnet wird. Dagegen bleibt die Bewertung der Kreditwürdigkeit in ausländischen Währungen unverändert auf der Stufe "CCC-", wie es weiter in der Mitteilung hieß. Außerdem ließ die Ratingagentur den Ausblick für die Kreditbewertung weiter auf "negativ". Damit ist in den kommenden Monaten eine erneute Abstufung möglich.
Den nach wie vor negativen Ausblick für die Kreditbewertung erklärte S&P unter anderem mit den Risiken für die fristgerechte und vollständige Rückzahlung der Staatsschulden. Außerdem verwiesen die Experten der Agentur auf die angespannte wirtschaftliche Lage Argentiniens. Das südamerikanische Land leidet unter einer hohen Verschuldung und steht erneut vor einer Staatspleite. Im vergangenen Jahr hatte sich die Lage zugespitzt, nachdem die Landeswährung Peso im Zuge von Neuwahlen erneut stark unter Druck geraten war. Argentinien gehört zu den Ländern mit der weltweit höchsten Inflationsrate.
Die Mitte-Links-Regierung des neuen Präsidenten Alberto Fernandez will die Zahlungsverpflichtungen nun neu aushandeln. Der Plan der Regierung sieht auch höhere Steuern auf Agrarexporte und Devisenankäufe sowie für sechs Monate eingefrorene Preise für Strom, Gas und Wasser vor.
Angesichts der schweren Wirtschafts- und Finanzkrise ist die Inflation in dem südamerikanischen Land im Jahr 2019 auf den höchsten Stand seit 28 Jahren gestiegen. Die Preise für Waren und Dienstleitungen erhöhten sich im vergangenen Jahr insgesamt um 53,8 Prozent, wie die Statistikbehörde (Indec) Mitte Januar mitteilte. Damit gehört Argentinien zu den Ländern mit der höchsten Inflationsrate weltweit. Befeuert wurde die Teuerung vor allem von der heftigen Abwertung der Landeswährung Peso.
Argentinien ist mit 175 Milliarden Dollar bei ausländischen Gläubigern verschuldet, von denen 71 Milliarden auf den Internationalen Währungsfonds (IWF) und andere multilaterale Finanzinstitute entfallen. Den Rest hat sich die Regierung bei privaten Geldgebern geliehen.
Zu diesen privaten Geldgebern gehören pikanterweise auch deutsche Institutionen. Es gibt einige deutsche Lebensversicherer, die argentinische Staatsanleihen mit einer langen Laufzeit aufgenommen haben, um langfristige Verpflichtungen zu decken. Die gucken jetzt in die Röhre. Im Jahr 2017 haben sich einige sogar an einer Anleihe mit einer Laufzeit von 100 Jahren beteiligt. Was Banken anbelangt: Die haben sich an der Emission nicht beteiligt, für sie würde das auch keinen Sinn machen. Beteiligt sind dafür aber spezialisierte Hedgefonds.
Der Hintergrund: Ein déjà-vu einer zum x-ten Mal gescheiterten Politik
Die Krise in Argentinien läuft wie nach einem in der Vergangenheit vielfach erprobten Skript ab. 2015 war der damals neu gewählte Präsident Macri an die Macht gekommen und hatte eine Politik nach dem Gusto des Washington-Konsensus implementiert. Die "Reformen" schlossen umfangreiche Privatisierungen und Schließungen von Staatsbetrieben, Deregulierungen und Liberalisierungen, Kürzungen der Sozialausgaben, restriktive Budgetpolitik sowie eine Freigabe des Wechselkurses ein.
Das Land verschuldete sich innert kurzer Zeit in enormem Ausmaß im Ausland, verhängnisvollerweise wiederum vor allem in Dollar, d.h. einer Fremdwährung.
Die euphorische Zufuhr von ausländischem Kapital war besonders von wenig mit Investitionen in Schwellenländern vertrauten neuen Investoren getragen. Dazu trug vor allem die Geldpolitik der großen Zentralbanken der Welt bei. Sie zwingt förmlich institutionelle Anleger wie Lebensversicherer oder Pensionskassen in neue, riskante Engagements, um einen genügenden laufenden Ertrag zu erwirtschaften.
Der Zusammenbruch der Rohstoffpreise verhinderte aber die erfolgreiche Entwicklung der Exportindustrie, während der liberalisierte Binnenmarkt von der neu zugelassenen Importkonkurrenz überschwemmt wurde. Beschäftigung und Lebensstandard sanken durch die Importkonkurrenz und die Kürzungen der Sozialleistungen. Die anvisierten Steuereinnahmen blieben hinter den Erwartungen zurück. Durch die Passivierung der Handels- und Leistungsbilanz kam der Peso unter Druck. Und setzte damit die anvisierten Budgetziele endgültig außer Reichweite, denn der Schuldendienst (Zinsen und Kreditrückzahlungen) müssen ja in Dollar entrichtet werden.
Der Internationale Währungsfonds sprang 2018 mit einer Rekordzusage von 57 Milliarden Dollar bei, einem Betrag, der noch nie in dieser Größenordnung für ein einzelnes Land ausgegeben worden ist. Von den zugesicherten 57 Milliarden sind 44 Milliarden bereits bezogen. Über den Rest wird die neugewählte Chefin des Währungsfonds, die Bulgarin Kristalina Georgieva, entscheiden müssen.
Ein weiterer Fehler war, dass der IWF mit dieser Zusage eine Auflage verband, einen flexiblen Wechselkurs des argentinischen Peso und gleichzeitig den Budgetausgleich für 2019 beizubehalten. Die Abwertung des Peso führte direkt zur rasenden Inflation und damit in eine schwere Rezession, wo der Budgetausgleich unmöglich ist.
Graphik: Dollar / argentinischer Peso - Wechselkurs
Quelle: Finanzen 100
Im Ergebnis werden die Anleger den großen Teil ihrer noch frischen Engagements verlieren, und Argentinien dürfte vor einer neuen verlorenen Dekade stehen.