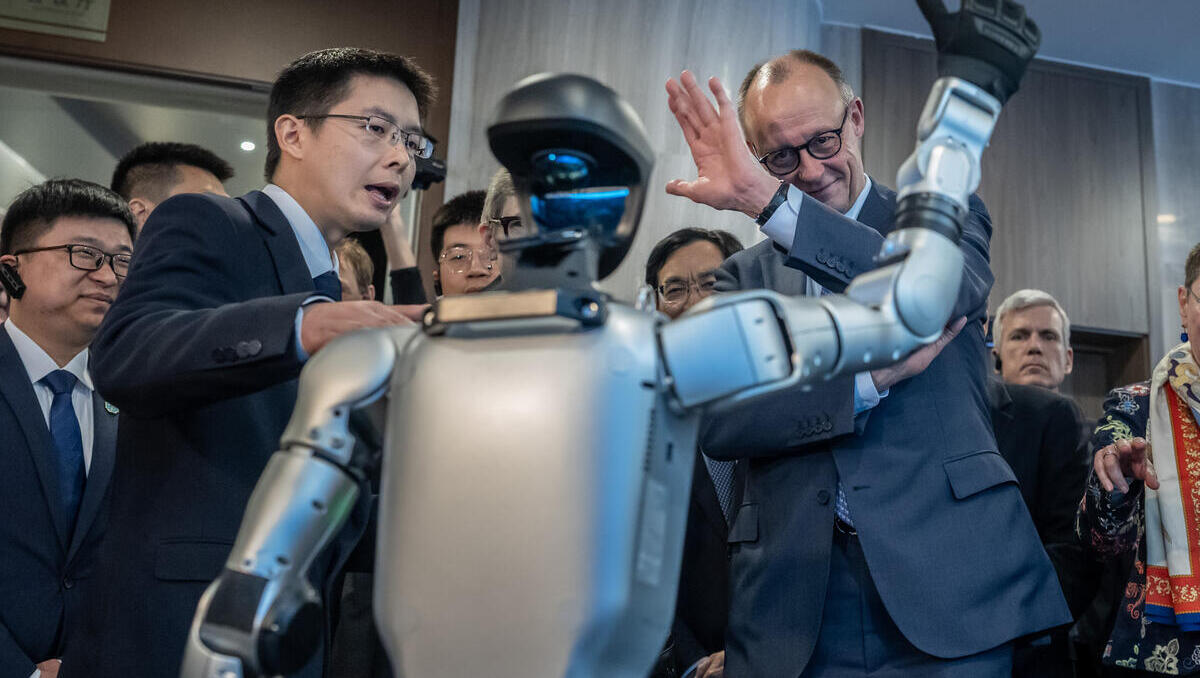„Ich habe meine Worte wohl abgewogen, wenn ich sage, dass dies ein historischer Augenblick ist“, sagte der damalige Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. „In einer Zeit internationaler Handelsspannungen tun wir heute mit unseren Partnern aus dem Mercosur deutlich kund, dass wir für einen auf Regeln beruhenden Handel stehen“, erklärte der Chef der EU-Kommission – nicht ohne einen Schuss Pathos.
Das war vor etwa einem halben Jahr, als die Welt für die Gemeinschaft und für vier Staaten der südamerikanischen Freihandelszone Mercosur noch in Ordnung war: Die Vertreter der EU und ihre Kollegen aus Südamerika hatten gerade ihre Unterschrift unter ein neues Freihandelsvertragswerk gesetzt, das alles bisher Dagewesene sprengen sollte.
Auf einem Wirtschaftsraum mit 770 Millionen Konsumenten, der sich über den Atlantik erstreckt und zwei ganze Kontinente einbindet, sollten die Unternehmen in der Lage sein, fast uneingeschränkt Handel zu treiben. Damit soll ein gemeinsamer Markt entstehen, der über eine Wirtschaftsleistung von fast 17 Billionen Euro verfügt, wobei die EU dazu knapp 85 Prozent beisteuert. Der Vertrag betrifft im Prinzip alle wichtigen Branchen, darunter die Autoindustrie und den Agrarsektor.
Brüssel geht davon aus, dass dadurch für die europäischen Exporteure pro Jahr Abgaben von vier Milliarden Euro wegfallen. Die Gemeinschaft betreibt derzeit mit der südamerikanischen Freihandelszone, die seit 1991 existiert und 75 Prozent der Fläche Südamerikas einnimmt, Handel für rund 90 Milliarden Euro.
Regierung Wallonien: „Abkommen eine Katastrophe für die Landwirtschaft“
Doch nun sieht die Lage vollkommen anders aus, weil sich in Europa zunehmend Widerstand breitmacht, der das Abkommen noch stoppen könnte, welches beide Partner in zwei mühsamen Jahrzehnten ausgehandelt hatten. So hat gerade die grün-sozialistische Teilregierung in der belgischen Provinz Wallonien erklärt, der Vertrag sei „eine Katastrophe für Landwirtschaft und schädlich für die Umwelt und Wirtschaft der Region.“
„Wir erwarten massive Importe von Rindfleisch und von Produkten, die chemisch und mit Antibiotika behandelt worden sind“, erklärte der wallonische Regierungschef Elio Di Rupo. Die politische Führungsspitze um den 69-jährigen sozialistischen Politiker verlangt von den Abgeordneten des Parlaments der Region, in der etwa 3,7 Millionen Einwohner leben, dass sie dem Vertragswerk ihre Zustimmung verweigern. Wallonien gilt unter den drei Provinzen Belgiens als ärmste Region.
Aus ähnlichen Gründen hatte zuvor die neue schwarzgrüne Regierung in Österreich die Freihandelszone abgelehnt. Beide Koalitionspartner haben ihre kategorisches „Nein“ sogar in den Koalitionsvertrag verankert. Das Alpenland gehört zu den Ländern in Europa, wo die Landwirtschaft traditionell eine starke politische Lobby hat.
Kritik: EU hat sich nur der Autolobby gebeugt
Hintergrund: Die österreichische, die wallonische Regierung und andere Kritiker in Europa befürchten, dass der neue Vertrag die relativ hohen Standards aufweicht, die in Europa für landwirtschaftliche Produkte gelten. Aus der Sicht vieler Gegner des Abkommens hat sich die EU nur dem Druck der Autoindustrie gebeugt, die unbedingt in Südamerika neue Absatzmärkte für ihre Fahrzeuge braucht.
Tatsächlich haben insbesondere die deutschen Autohersteller noch viel Spielraum nach oben, wenn es um den Export ihrer Produkte in die vier Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay geht. Denn derzeit beträgt laut der deutschen Wirtschaftsförderungsgesellschaft GTAI der Gesamtwert ihrer Erzeugnisse gerade einmal 1,6 Milliarden Euro pro Jahr. Zum Vergleich: In die USA verkaufen die deutschen Produzenten für 26 Milliarden Euro Autos- und KfZ-Teile – also 16-mal mehr.
Dabei ist Brasilien mit seinen 210 Millionen Konsumenten der wichtigste Absatzmarkt. Gerade dieses Land ist vielen europäischen Kritikern ein Dorn im Auge. Denn gilt es als Großmacht bei der Produktion von Rindfleisch, das damit radikal Gewinne machen will.
Ein Problem aus der Sicht des wallonischen Politikers Di Rupo und anderer Gegner des Vertrages ist, dass gerade im Fleisch aus Brasilien gesundheitsschädliche Rückstände von Antibiotika auftauchen, weil die brasilianischen Bauern nicht unter so strenger Kontrolle züchten wie ihre europäischen Kollegen. Darüber hinaus befürchten die Kritiker, dass Brasilien zum Schaden des Klimas verstärkt den Regenwald rodet, um immer mehr Weideflächen zu schaffen.
„Das Mercosur-Abkommen ist ein schlechter Deal für Umwelt und Klima“, mahnt beispielsweise die sächsische Europa-Abgeordnete der GRÜNEN, Anna Cavazzini. „Die EU wird damit nur billig Fleisch und Ethanol importieren und so die Abholzung des Regenwaldes anheizen“, machte Cavazzini massiv dagegen Front. „Dieses Mercosur-Abkommen darf so nicht kommen, wenn wir unsere Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen ernst nehmen wollen“, erklärte die Europa-Abgeordnete.