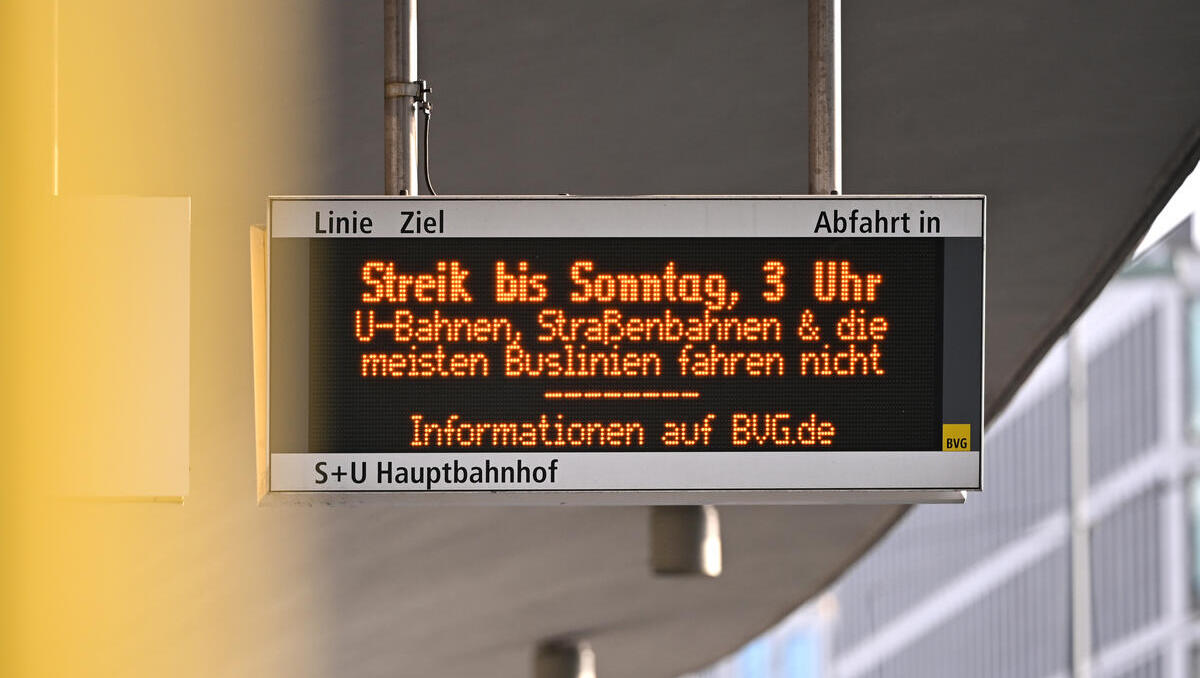Aus einem IWF-Bericht geht hervor, dass dezentrale Kryptowährungen wie Bitcoin nicht unbedingt positiv bewertet werden dürfen.
„Derzeit sind Krypto-Assets zu volatil und zu riskant, um eine große Bedrohung für Fiat-Währungen darzustellen. Darüber hinaus genießen sie aus Sicht der Bürger nicht das gleiche Vertrauen wie Fiat-Währungen: Sie wurden von berüchtigten Fällen von Betrug, Sicherheitsverletzungen und Betriebsstörungen heimgesucht und mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht (…) Einige Krypto-Assets wie Bitcoin weisen im Prinzip ein begrenztes Inflationsrisiko auf, da das Angebot begrenzt ist. Es fehlen ihnen jedoch drei wichtige Funktionen, die stabile Währungsregime erfüllen sollen: Schutz vor dem Risiko einer strukturellen Deflation, die Fähigkeit, flexibel auf vorübergehende Schocks auf die Geldnachfrage zu reagieren und damit den Konjunkturzyklus zu glätten, und die Fähigkeit, als Kreditgeber zu fungieren“, heißt es in dem IWF-Bericht aus dem Jahr 2016.
Da immer mehr Länder digitale Zentralbankwährungen (CBDC) ausgeben oder entwickeln, wird die Aussicht auf eine digitale Währung als Teil des Mainstream-Finanzwesens zunehmend zur Realität. Der IWF fasst mittlerweile die Verwendung von CBDC als Reservewährung ins Auge. Das geht aus einem IWF-Papier hervor, das im November 2020 veröffentlicht wurde. Mit einem Anteil von 61 Prozent an den globalen Reserven dominiert der US-Dollar derzeit die internationalen Reserven. Ein CBDC, das von Ländern ausgegeben wird, die bereits in der Reservekategorie dominieren, könnte ihre Währungen noch leistungsfähiger machen und die Nachfrage nach ihnen erhöhen, argumentiert der IWF.
„Mit anderen Worten, ein digitaler Dollar kann genauso mächtig werden wie sein Fiat-Äquivalent, wenn nicht sogar mächtiger“, so „Investopedia“. Die Autoren des IWF-Papiers schreiben, dass eine solche digitale Reservewährung aufgrund der Glaubwürdigkeit mehrerer Zentralbanken, Erfolg haben könnte. „Computerwoche“ definiert CBDC mit den folgenden Worten: „Bei Central Bank Digital Currency (CBDC) handelt es sich im Gegensatz zu einer Kryptowährung um digitales Zentralbankgeld, welches die gleichen Tauscheigenschaften wie das bekannte Fiatgeld aufweist. Je nach Modell kann es sich jedoch maßgeblich von Fiatgeld unterscheiden. Dieses digitale Geld ist reguliert und verhält sich nicht wie teilweise hoch volatiles, auf Distributed Ledger Technology (DLT) basierendes Kryptogeld. Mittels CBDC sinken die Geldbeschaffungskosten, Bezahlvorgänge zwischen Maschinen – über sogenannte Smart Contracts initiiert – werden rechtssicher und auf die kleinsten Werteinheiten aufteilbar (Stichwort ,Micropayment‘). Geldwäsche wird quasi unmöglich. Zentralisierte IT-Lösungen ermöglichen hier bereits Transfers.“
Die EZB-Chefin Christine Lagarde und weitere Währungshüter hatten zuvor mehrmals Kritik an dezentralen Kryptowährungen geübt. Beispielsweise wäre ein digitaler Euro aus ihrer Sicht eine Antwort auf privatwirtschaftliche Initiativen wie Bitcoin oder das maßgeblich von Facebook getragene Projekt Libra. Der große Unterschied: Im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen stünde ein digitaler Euro unter Aufsicht einer Zentralbank, die die Stabilität der Währung sichert.
Im aktuellen Fiat-Geldsystem gilt die Notenbank als zentrale Instanz. Durch die Reform in Richtung der Einführung von CBDC würde die Notenbank als zentrale Instanz der jeweiligen CBDC beibehalten werden. Somit könnte die jeweilige Notenbank eine enorme Kontrolle über die jeweilige CBDC ausüben – doch ganz digital. Der „Weser Kurier“ wörtlich: „Bargeld kann man heute noch in die Hand nehmen. Das Girokonto bei der Bank wird jetzt zwar auch schon per Computer geführt, ebenso wie die Überweisungen zu anderen Konten digital abgewickelt werden. Die Buchungen sind dabei aber auf den Zentralrechnern der Institute gespeichert, die die Zahlungen garantieren. Das ist ein Unterschied zu den neuen, digitalen Zahlungsmitteln. Deren Buchungsvorgänge werden nicht nur in wenigen Rechenzentren dokumentiert, sondern dezentral auf Millionen Computern weltweit. „Distributed Ledger“ heißt deshalb die zugrunde liegende Technologie („verteilte Register“). Eine Variante ist die Blockchain-Technik, die unter anderem beim Bitcoin zum Einsatz kommt. Das gleichzeitige Ablegen in vielen Speichern gilt als neuer Weg, die Buchungen automatisiert vergleichbar und relativ fälschungssicher zu machen. Allerdings erwägt die EZB ebenfalls ein Verfahren, bei dem die Zahlungsströme des digitalen Euro auf zentralen Rechnern dokumentiert werden.“
Eine unkontrollierte, dezentrale Währung mit anonymisierten Zahlungsvorgängen ist offenbar nicht im Interesse der Notenbanken. Der IWF und viele Banken halten nichts von Investoren, die auf dezentrale Kryptowährungen setzen, weil sie große Geldsummen auf die Bank einzahlen und diese dann an eine „Wallet“ oder einen Broker weiterleiten, der sie in Bitcoin umwandelt.
Eine Kriminalisierung der dezentralen Kryptowährungen steht offenbar bevor. Im Jahr 2018 hatte die damalige IWF-Chefin Christine Lagarde diesen Schritt offen angedeutet. Das geht aus einem Bericht der „BBC“ hervor.
Heute ist sie Präsidentin der EZB und mächtiger denn je.