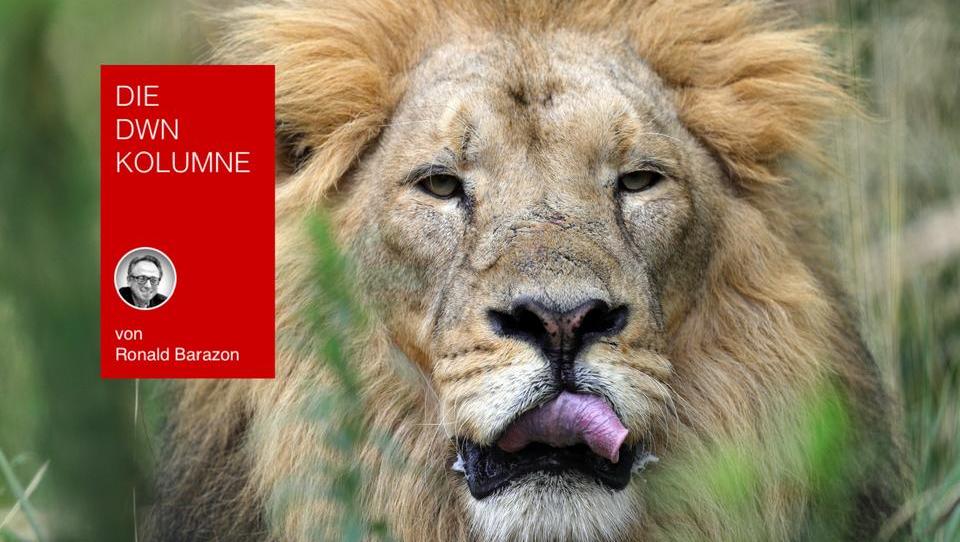Didier Reynders ist bisher durchaus positiv aufgefallen. Der EU-Kommissar für „Justiz und Rechtsstaatlichkeit“ profiliert sich als unermüdlicher Kämpfer für den Rechtsstaat. Der Belgier versucht sogar, die polnische und die ungarische Politik davon zu überzeugen, dass ihre neuen Verfassungen mit den demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen der EU unvereinbar sind. In Warschau und Budapest kümmert man sich allerdings wenig um Botschaften aus Brüssel, und so agiert der Kommissar gleichsam als einsamer Rufer in der Wüste.
Diese Woche ist Didier Reynders erneut aufgefallen, diesmal allerdings überhaupt nicht positiv, im Gegenteil: In einem Interview mit der „Financial Times“ erinnerte er nachdrücklich an den Vorrang des EU-Rechts vor dem nationalen Recht der einzelnen Mitgliedstaaten und erklärte, dass die EU zerbrechen werde, wenn dieses Prinzip missachtet werde.
Ein Verfahren gegen Deutschland, weil Karlsruhe die Europäische Zentralbank kritisierte
Dieser Vorrang hat unter anderem zu der Groteske geführt, dass die EU-Kommission ein Verfahren gegen Deutschland wegen Verletzung der EU-Verträge betreibt, weil die deutschen Verfassungsrichter die hemmungslose Gelddruckerei der Europäischen Zentralbank in Frage gestellt haben und darauf pochen, dass diese Maßnahmen zumindest ausreichend begründet werden. Merke: Aufmucken gegen die EU wird in Brüssel gar nicht gern gesehen und unter keinen Umständen geduldet.
Die EU-Gesetzgebung hat mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wenig gemein
Unter EU-Recht stellt man sich als Durchschnittsbürger besonders wichtige Gesetze vor, die das EU-Parlament beschließt und die aufgrund der EU-Verträge den nationalen Rechtsordnungen übergeordnet sind. Diese Vorstellung hat allerdings mit der Realität wenig zu tun. Tatsächlich kommen EU-Gesetze und sonstige EU-Vorschriften auf eine Weise zustande, die mit demokratischen und rechtsstaatlichen Grundsätzen unvereinbar sind. So lobenswert die Kritik Reynders an Polen und Ungarn ist, der Kommissar für Justiz und Rechtsstaatlichkeit sollte sich lieber um die EU als Ganzes kümmern. Der Vergleich mit dem legendären Augias-Stall, den Herkules ausmisten musste, drängt sich auf.
Gewaltenteilung? I wo! In Brüssel verwandeln sich die Regierungen plötzlich in Gesetzgeber
Die erste, aber keineswegs die einzige Wurzel des Übels liegt darin begründet, dass das EU-Parlament nur sehr beschränkte Kompetenzen hat. Ohne die Zustimmung der Regierungen der Mitgliedstaaten gibt es keine Beschlüsse. Durch diese Regel kommt eine Perversion zustande: Die Regierungen, die in ihren Ländern für die Ausführung der Gesetze zuständig und von den nationalen gesetzgebenden Parlamenten abhängig sind, verwandeln sich in Brüssel zu Gesetzgebern – eine klare Verletzung des Prinzips der Gewaltenteilung. Und dazu kommt noch, dass diese in Brüssel beschlossenen Gesetze Vorrang vor den nationalen Gesetzen haben. Zwar wurde 2004 auf EU-Ebene ein Verfassungsentwurf vorgelegt, der die in Demokratien selbstverständliche Trennung von Gesetzgebung und Verwaltung herstellen sollte. Die Diskussion über den Entwurf, der nie beschlossen wurde, hatte allerdings noch gar nicht begonnen, da wurde von den Regierungen bereits ein Paragraf eingebaut, dass ohne ihre Zustimmung das Parlament keine Beschlüsse fassen darf.
Zur Verwirrung der Öffentlichkeit heißen Gesetze im EU-Parlament nicht Gesetze, sondern entweder „Richtlinien“, die von den nationalen Parlamenten noch angepasst werden können, oder „Verordnungen“, die unmittelbar in der gesamten EU gelten und von den Staaten unverändert angewendet werden müssen.
Die Verletzung der Grundregel, dass Gesetze vom Parlament zu beschließen und von der Regierung und der Verwaltung umzusetzen sind, stellt keineswegs das einzige Defizit dar, das ein Justizkommissar zur Debatte stellen müsste. Seit dem Jahr 2009 hat sich das Demokratie-Defizit der EU nämlich noch dramatisch vergrößert.
Was hinter den Begriffen „prinzipienbasiert“ und „Delegierte Rechtsakte“ tatsächlich steckt
Mit dem im Dezember 2009 in Kraft getretenen „Lissabonner Vertrag“ wurde die Macht des Parlaments zwar vergrößert, allerdings nur scheinbar. Seit 2010 setzt sich nämlich immer mehr die so genannte „prinzipienbasierte“ Gesetzgebung durch. Hinter diesem Ausdruck verbirgt sich die Tatsache, dass die Angeordneten nur mehr „Prinzipien“, Grundlagen, Orientierungen beschließen. Der eigentliche Gesetzestext wird von der EU-Kommission formuliert, die auch das Recht erhalten hat, „Verordnungen“ zu erlassen. In der schwer verständlichen EU-Sprache sind, wie erwähnt, Verordnungen in Wahrheit Gesetze, die in der gesamten EU gelten, und das trifft auch auf die Verordnungen der EU-Kommission zu.
Die sonderbare Situation, dass die Verwaltungsbehörde „EU-Kommission“ die Gesetze macht, beruht auf einer Praxis, mit der sich das EU-Parlament – das zwar regelmäßig pflichtschuldig mehr Macht verlangt, aber stets mit einem lauten Lachen bedacht wird und anschließend rasch den Schwanz einzieht - sich laufend selbst entmachtet: Man überträgt der EU-Kommission im Rahmen sogenannter „Delegierter Rechtsakte“ oder „Durchführungsrechtsakte“ die Aufgabe, die beschlossenen „Prinzipien“ umzusetzen und zu Gesetzen zu machen.
Die dramatischen Konsequenzen der „Delegierten Rechtsakte“ für alle EU-Bürger
Es ist nicht verwunderlich, dass die Öffentlichkeit diesen Dschungel von verschobenen Kompetenzen und verwirrenden Ausdrücken meist nicht durchschaut. Allerdings wurde durch die „prinzipienbasierte“ Gesetzgebung und die „Delegierten Rechtsakte“ die EU zu einem Unrechtsgebilde, das sich immer weiter von einer Demokratie entfernt. Dieses Phänomen muss deutlich gemacht werden:
- Eine Verordnung der EU-Kommission gilt, wie erwähnt, genau wie eine Verordnung des EU-Parlaments, als Gesetz in der gesamten EU. Bei einer Verordnung (!) handelt sich somit um EU-Recht (!).
- Die EU-Kommission ist aber auch die Verwaltungsbehörde der EU, greift in zahlreiche Bereiche ein, entweder direkt oder über ausgelagerte Behörden und Agenturen, gibt Richtlinien aus und verhängt zum Teil extrem hohe Geldstrafen.
- In einer Demokratie ist es selbstverständlich, dass man sich gegen eine Entscheidung einer Verwaltungsbehörde wehren und vor Gericht ziehen kann. In der EU ist hierfür der Europäische Gerichtshof EuGH zuständig. Die Aufgabe des EuGH besteht in der Wahrung des EU-Rechts. Die Urteile müssen daher dem EU-Recht entsprechen. Das EU-Recht wird aber zu einem immer größeren Teil durch die Verordnungen der EU-Kommission auf der Basis der „Delegierten Rechtsakte“ bestimmt. Bürger, die sich gegen Entscheidungen der Kommission zu Wehr setzen, sehen sich beim EuGH mit den Regeln der Kommission konfrontiert, die sie bekämpfen, die aber Teil des EU-Rechts sind und die das Gericht zu befolgen hat. Das heißt, die Recht suchenden Bürger befinden sich in einer Falle, in einer Endlosschleife, aus der es kein Entrinnen gibt.
Im Klartext bedeutet diese Entwicklung: EU-Recht ist in Wahrheit das, was die EU-Kommission als solches erachtet. Wenn also der Herr Justizkommissar erklärt, man müsse den Vorrang des EU-Rechts respektieren, und gleichzeitig verkündet, dass die Missachtung dieses Vorrangs das Ende der EU bedeuten würde, so sagt er sinngemäß, dass alle sich dem Kommando der EU-Kommission unterwerfen müssen.
Regulieren? Nein - der Patient Europa braucht keine Dosis vom falschen Rezept
Die Verordnungen der EU-Kommission sind meist krause Konstrukte, die sich in der Praxis oft als unbrauchbar erweisen. Stellvertretend für die zahllosen Regelungen sei an die Datenschutzgrundverordnung erinnert, die keinen Datenschutz bewirkt, aber unendlich viel sinnlose Bürokratie in allen Bereichen auslöst.
Es ist nicht so, wie Sie sagen, Herr Kommissar, sondern umgekehrt: Nicht die Missachtung des EU-Rechts bedeutet das Ende der Gemeinschaft. Nein, das EU-Recht, wie es derzeit praktiziert wird, läutet das Ende der EU ein.
Derzeit gleicht die EU einem alten Gebäude, das vom Zerfall bedroht ist und mit Eisenklammern und Pölzungen mühsam zusammengehalten werden muss. In der EU-Kommission macht sich nun der Gedanke breit, man müsse mit noch mehr Regulierung aus Brüssel den Haufen der 27 Staaten zusammenhalten und brauche daher die Sicherheit, dass alle brav den Befehlen aus der Zentrale gehorchen. Die Realität sieht anders aus: Genau der seit Jahren betriebene Versuch, alle Mitglieder in ein in Brüssel geschneidertes Korsett zu pressen, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass in den einzelnen Staaten der gemeinsame europäische Weg in Frage gestellt wird. Mit anderen Worten: Die Annahme, auf der die Initiative unseres hochverehrten Justiz-Kommissars Didier Reynders beruht, ist vollkommen falsch. Reynders geht davon aus, dass der Patient Europa mit noch mehr vom falschen Rezept geheilt werden könne – es muss aber weniger sein, viel weniger.
Von allein geschehen keine Wunder: Auch nicht in der EU
Ein Phänomen bedient besonderer Erwähnung:
- Im Laufe der nun sechzigjährigen Geschichte der EU wurde immer wieder davon gesprochen, dass die europäischen Staaten von sich aus organisch langsam zusammenwachsen werden. Es sei also nicht weiter problematisch, dass die Union keine Verfassung habe, es werde sich schon alles von allein fügen. Der Zustand der EU zeigt jedoch, dass dies nicht geschieht, sondern, m Gegenteil, dass vielmehr die Mitgliedstaaten auseinander streben und mit Großbritannien sogar schon ein – ausgesprochen großer und mächtiger - Staat ausgetreten ist.
- Auch eine andere politische Theorie ging davon aus, dass sich eine Entwicklung „von allein“ ergeben werde: Der Kommunismus beruht auf der Annahme einer Entwicklung zu einer solidarischen Gesellschaft, in der der Staat überflüssig werden wird. Tatsächlich hat es aber noch nie eine so allumfassende Präsenz des Staates gegeben wie im Kommunismus.
Dieser Umstand rückt die Realität der EU in den Fokus. In Brüssel wurde nicht nur die Annahme gepflegt, dass die Integration sich organisch ergeben werde. Man bekannte sich auch zu Deregulierung und sagte der Überbürokratisierung der Einzelstaaten den Kampf an. Beliebt war der Satz, dass die EU „mit einem Sturm der Liberalität den Mief aus den Ämtern“ treiben werde. Wie sieht jedoch die Praxis aus? So viel wie jetzt wurde in Europa noch nie reguliert, registriert und kontrolliert – in gewisser Weise erinnert die Gemeinschaft immer stärker an die untergegangene Sowjetunion.
Von allein geschehen keine Wunder. Um einen Erfolg zu erzielen, braucht es solide gemeinsam Arbeit. Groteskerweise hat man in der EU auch tatsächlich den Eindruck, eine unglaublich große und gute Arbeitsleistung zu erbringen. Da nun das Parlament, die Kommission und die als EU-Rat agierenden Regierungen der 27 Mitgliedstaaten sich alle berufen fühlen, wird bei vielen wichtigen Entscheidungen ein so genannter „Trialog“ inszeniert, in dem unendlich mühsam und langsam Kompromisse, nicht selten faule, erzielt werden. Besser als „Trialog“ wäre wohl die Bezeichnung „Trio Infernale“. Wobei im Endeffekt nur einer den Diavolo abgibt: Die Kommission.