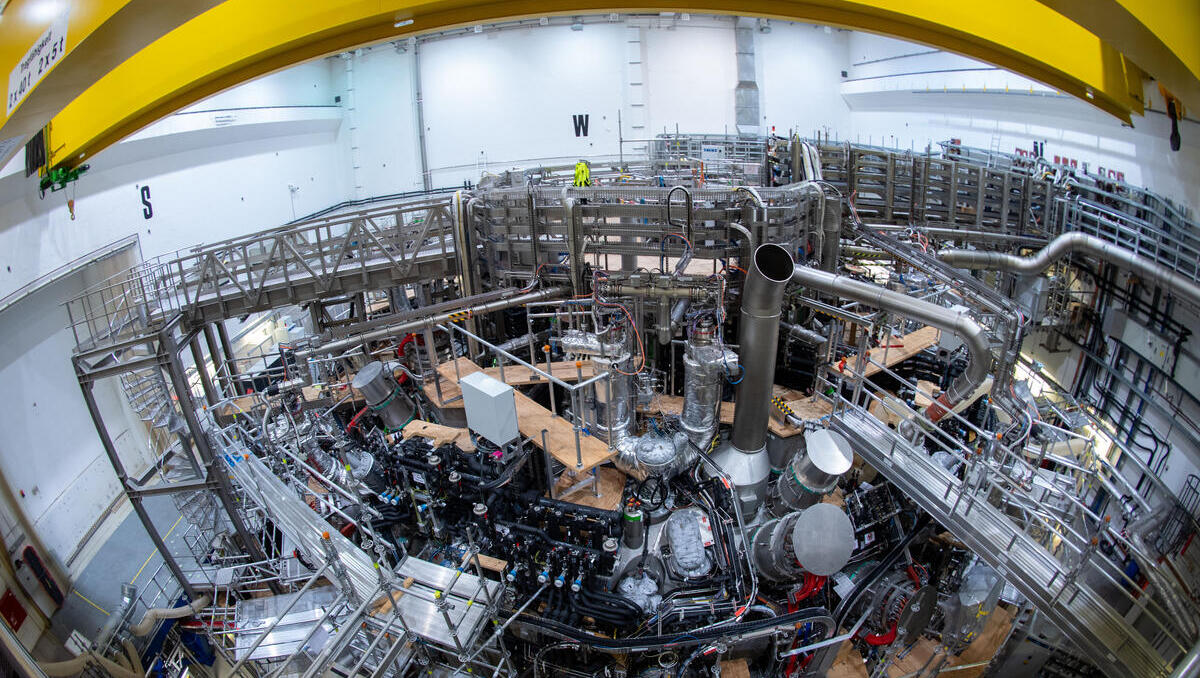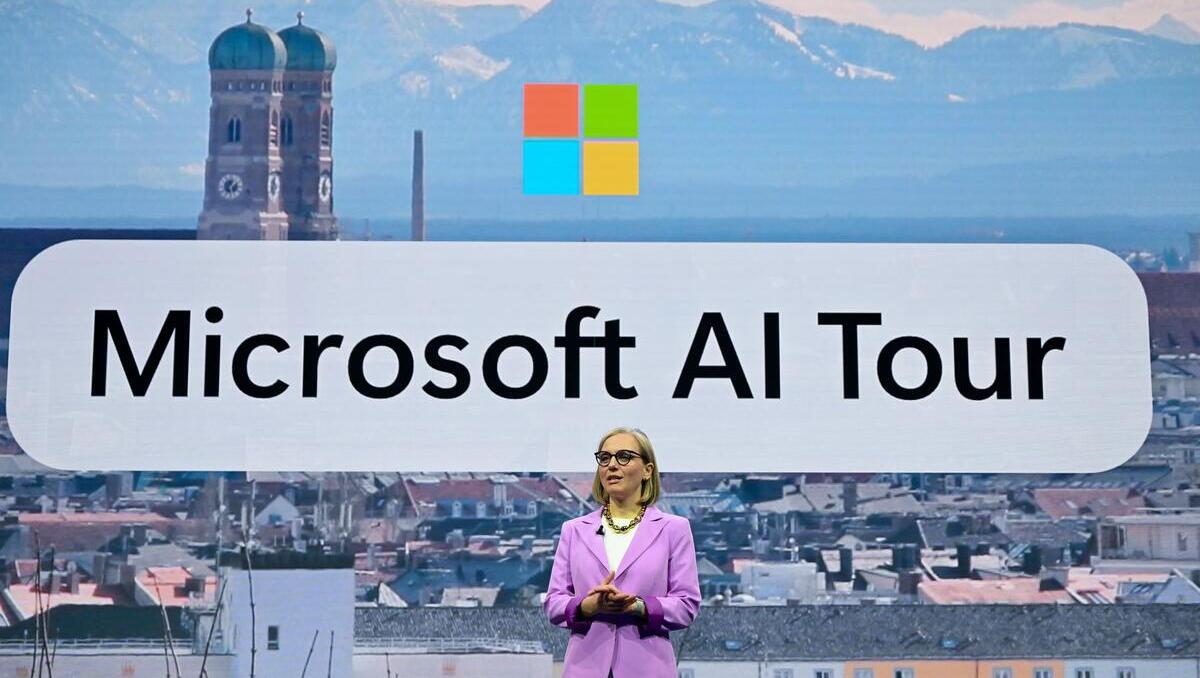Finnland und Schweden haben angekündigt, dass sie Anträge auf Mitgliedschaft in der NATO stellen werden. Doch dürfte der Beitritt zum Bündnis ihre und Europas Sicherheit eher schwächen als erhöhen.
Strategische Neutralität hat Schwedens Unabhängigkeit und Freiheit von Kriegen seit 200 Jahren bewahrt, und Finnlands Unabhängigkeit seit 1948. Ist etwas passiert, was es rechtfertigen würde, diese Neutralität zu beenden?
Die Regierungsvertreter Schwedens und Finnlands verweisen auf zwei Geschehnisse. Im Dezember 2021 sei der Kreml dazu übergegangen, die Neutralität Schwedens und Finnlands nicht mehr nur als wünschenswert zu bezeichnen, sondern sie im Wesentlichen zu fordern. Er habe damit die klare und bedrohliche Botschaft ausgesandt, dass eine unabhängige Außenpolitik für Russlands Nachbarn ein Privileg und kein Recht sei. Wichtiger noch sei, dass Russlands Invasion der Ukraine das Sicherheitsumfeld beider Länder grundlegend verschlechtert habe, denn sie habe das Risiko erhöht, dass Russland sie angreifen könnte oder zumindest versuchen könnte, sie einzuschüchtern. Da sie nicht hoffen könnten, Russland einzeln oder gemeinsam militärisch zu besiegen, müssten sie sich also einer Organisation anschließen, die dazu in der Lage wäre.
Im Expertenjargon ausgedrückt, würde eine NATO-Mitgliedschaft „die Abschreckungsschwelle erhöhen“. Angesichts der Unausweichlichkeit von Vergeltungsmaßnahmen (wenn nötig auch nuklearen) würde Russland sich hüten, Schweden und Finnland anzugreifen oder ernsthaft zu bedrängen. Dieses Argument impliziert in hohem Maße, dass Russland im Falle einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine dort nicht einmarschiert wäre, da, so die schwedischen Außen- und Verteidigungsministerien unisono, „Russland (beziehungsweise die Sowjetunion) noch nie einen NATO-Verbündeten angegriffen hat“. Doch könnten sich Schwedens und Finnland mit ihren Bemühungen zur Stärkung der Abschreckung ins eigene Fleisch schneiden, weil eine NATO-Erweiterung die Schwelle für Russlands Bereitschaft, in den beiden Ländern einzumarschieren, senken könnte – zumindest, bevor sie Mitglieder im Bündnis werden.
Um zu beurteilen, ob eine weitere NATO-Ausweitung klug ist, muss man sich mit zwei Fragen auseinandersetzen. Erstens: Ist Russlands Invasion in der Ukraine - unabhängig davon, wie ungerechtfertigt sie im rechtlichen Sinne ist und wie brutal in der Ausführung - ein Beleg für eine allgemeine expansive Absicht, oder stellt sie eine Ausnahme dar? Zweitens: Was für eine Verantwortung zur Wahrung des Friedens fällt kleinen Ländern zu, die an große Länder grenzen?
Die Geschichte bietet Hinweise zu beiden Fragen. Nach 1945 hätte Stalin Finnland der Sowjetunion einverleiben oder es per Marionettenregime beherrschen können. Finnland hatte in einem Krieg, an dem es auf Seiten der Deutschen gekämpft hatte, eine krachende Niederlage kassiert – etwas, woran die Finnen nicht gern erinnert werden, auch wenn ihr Bündnis mit Hitler erst nach Stalins Invasion 1939 geschlossen wurde.
Doch war Stalin nie daran interessiert, die zaristische Herrschaft über Finnland wiederherzustellen. Seine Überlegungen waren strategischer Art. Nach dem „Winterkrieg“ der Sowjetunion gegen Finnland drückte er es 1940 so aus: „Wir können Leningrad nicht verschieben, also müssen wir die Grenzen verschieben.“ Was er verlangte und letztlich bekam, waren rund zehn Prozent des finnischen Staatsgebietes, darunter ein großes Stück Kareliens in der Nähe von Leningrad (heute St. Petersburg) sowie einige Inseln von strategischer Bedeutung.
Nach diesem Landraub garantierte Stalin im „Freundschaftsvertrag“ von 1948 die finnische Unabhängigkeit unter der Bedingung, dass Finnland versprach, sich jedem Angriff auf die Sowjetunion „über finnisches Gebiet“ militärisch zu widersetzen – bei Zustimmung Finnlands auch mit Hilfe des Kremls. Anders als von ihren osteuropäischen Satellitenstaaten, verlangte die Sowjetunion von Finnland nicht, dem Warschauer Pakt bei dessen Gründung 1955 beizutreten.
Es gibt eine oberflächliche Parallele zwischen der gegenwärtigen Tragödie in der Ukraine und der Situation, in der Finnland sich von 1939-48 befand. Stalin machte die finnische Neutralität zur Voraussetzung für Finnlands Unabhängigkeit, während der russische Präsident Wladimir Putin behauptet, seine wichtigste Forderung sei, dass die Ukraine das Ziel der NATO-Mitgliedschaft aufgebe.
Doch größer sind die Unterschiede zwischen den beiden Fällen. Wenn auch einst Teil des Zarenreiches, war Finnland nie Teil des „historischen“ Russlands, so wie die Ukraine es war, und war nicht die Heimat von großen russischen Minderheiten. Putin betrachtet die Ukraine als „unveräußerlichen“ Teil Russlands und macht Lenins Gründung der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik für das Aufkommen eines ukrainischen Nationalismus verantwortlich. Während für Stalin also wohl primär strategische Überlegungen zählten, muss man davon ausgehen – so wie es die Ukrainer und ihre westlichen Unterstützer tun –, dass Putin die Drohung der NATO-Erweiterung als Vorwand nutzt, um den aus seiner Sicht historischen Fehler Lenins rückgängig zu machen.
Falls Russlands Angst vor der NATO echt ist, werden Schwedens und Finnlands Mitgliedschaftsanträge sie einem Risiko von Vergeltungsmaßnahmen vor dem Beitritt aussetzen, und es ist zumindest fraglich, ob eine NATO-Garantie nach Artikel 5 ihnen real mehr Sicherheit bietet als die Neutralität. Und falls es sich beim russisch-ukrainischen Krieg um ein Spezifikum der russischen Geschichte handelt und die NATO-Erweiterung dabei nur als Vorwand dient, stellt er (der Krieg) keinen Auftakt zu einer unbegrenzten territorialen Ausweitung dar (auch wenn Putins Bemerkungen, in denen er die Eigenstaatlichkeit Kasachstans relativiert, seiner Leugnung des Existenzrechts der Ukraine besorgniserregend ähnlich sehen). So oder so - die Argumente für eine NATO-Mitgliedschaft Schwedens und Finnland sind alles andere als eindeutig.
Das bringt uns zur zweiten Frage: der Verantwortung kleiner Länder für den Frieden. Der ehemalige EU-Diplomat Robert Cooper argumentiert in seinem Buch The Ambassadors (zu Deutsch: Die Botschafter), dass „es aufseiten kleiner Staaten mit großen Nachbarn eines strengen Realismus bedarf“. Und an diesem Realismus scheint es im derzeitigen politischen Denken der schwedischen und finnischen Regierungen zu mangeln. Man denke an folgende Behauptung der Außen- und Verteidigungsministerien Schwedens: „Die russische Führung operiert auf Grundlage … eines Geschichtsbildes, das von dem des Westens abweicht“, und das „das Ziel der Schaffung von Einflusssphären“ einschließe.
Dieses russische Konzept schlicht auf totalitäres Denken zurückzuführen, läuft auf eine Verleugnung jeder besonderen Verpflichtung eines Staates gegenüber seiner Bevölkerung hinaus, die sich aus seiner Lage innerhalb des internationalen Systems ergibt – das Gegenteil von Coopers „strengem Realismus“. Die Doktrin der Einflusssphären mag heutigen internationalen Normen fremd sein, aber nicht internationaler Praxis. Kein mächtiger Staat wünscht sich einen potenziellen Feind vor seiner Haustür. Dieses Prinzip war (und bleibt) nicht zuletzt die Grundlage der Monroe-Doktrin der USA in Bezug auf die westliche Hemisphäre.
Ein Realist in den internationalen Beziehungen zu sein bedeutet, zu akzeptieren, dass einige Staaten souveräner sind als andere. Die Finnen erkannten dies nach dem Zweiten Weltkrieg an. „Strenger Realismus“ erfordert es nun, dass Schweden und Finnland eine Denkpause einlegen, bevor sie sich der NATO in die Arme werfen, und dass das Bündnis einen Schritt zurücktut, bevor es sie aufnimmt. Auch die Ukraine, deren tapferer Widerstand der territorialen Expansion Russlands Grenzen gesetzt hat, muss nun bereit sein, irgendeine Form friedlicher Koexistenz mit ihrem mächtigeren Nachbarn auszuhandeln.
Aus dem Englischen von Jan Doolan
Copyright: Project Syndicate, 2022.