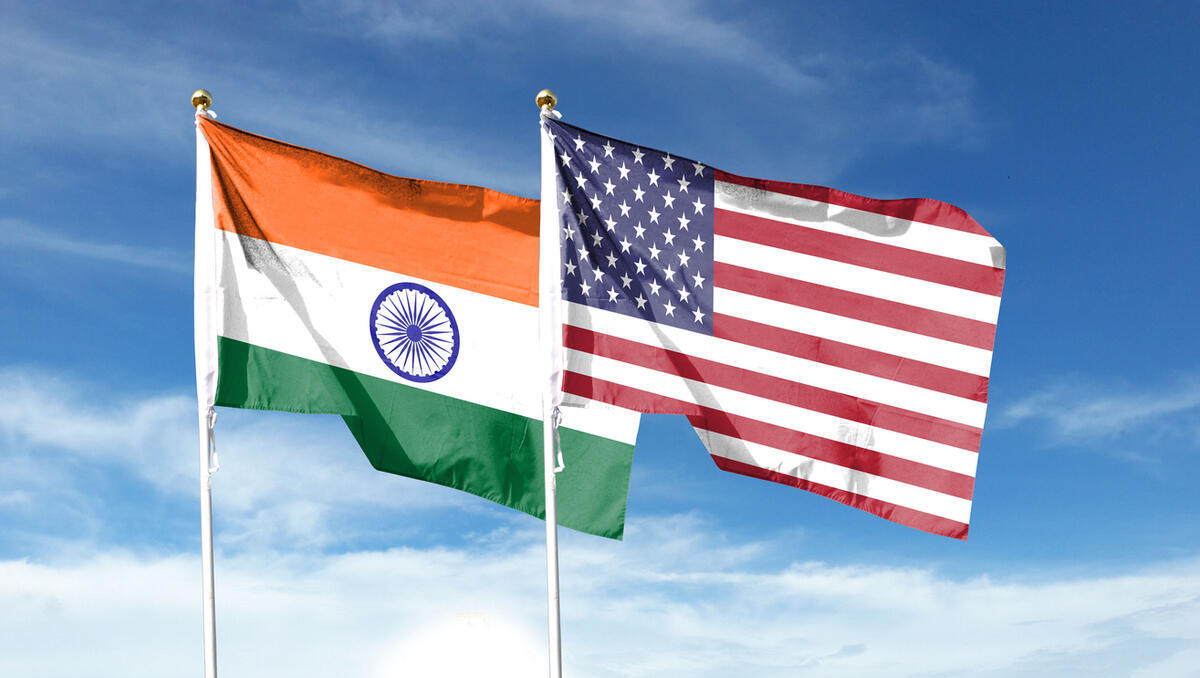Der weiteren Zulassung des umstrittenen Pflanzengifts Glyphosat für die kommenden zehn Jahre scheint nichts mehr im Wege zu stehen. Ein letzter Versuch von EU-Parlamentariern, die Kommission zum Einlenken zu bewegen, ist in dieser Woche im Umweltausschuss gescheitert. Vertreterinnen von Grünen, Sozialdemokraten und Linken im Umwelt- und Gesundheitsausschuss hatten einen Antrag auf Ablehnung einer weiteren Zulassung eingebracht. Der wurde von einer knappen Mehrheit abgelehnt. Damit ist das Thema für die EU-Parlamentarier erstmal durch. „Hier noch etwas zu drehen, ginge nur mit einer massiven Kampagne aus allen möglichen Ländern“, sagt MdEP Michael Bloss (Grüne/DE), doch die sei eher nicht zu erwarten.
Tags zuvor waren in einer Debatte noch einmal die einschlägigen Argumente vorgetragen worden. Die Berichterstatterinnen wiesen erneut auf bedenkliche Leerstellen im Gutachten der europäischen Lebensmittelbehörde EFSA hin, die mit einer Neubewertung im Juli den Weg für eine Neuzulassung frei gemacht hatte. Sie wiesen auf die möglichen langfristigen Gefahren für kleine Säugetiere und somit auch für den Menschen, für die menschliche Gesundheit und für Wasserorganismen hin, und beanstandeten fehlende Untersuchungen über die Auswirkungen von Glyphosat auf die Artenvielfalt. Mögliche Zusammenhänge mit Krebs oder Parkinsonerkrankungen seien zu wenig beachtet, es gebe einen Mangel an toxikologischen Gutachten und ein Risikomanagement, das nicht auf der Höhe der EU-Gesetzgebung sei.
Glyphosat, seit den 70er-Jahren auf dem Markt, ist das meistverkaufte Pestizid der Welt. Pro Jahr werden weltweit etwa eine Million Tonnen des Gifts versprüht, in Deutschland 4000 Tonnen. Als sogenanntes Totalherbizid tötet es jede Pflanze, die nicht entsprechend gentechnisch verändert wurde. Kein Pflanzenvernichter ist so heftig umstritten und gleichzeitig so gut erforscht. Den EU-Prüfern lagen, wie berichtet, mehr als 2400 Studien und wissenschaftliche Artikel zur Begutachtung vor. Die meisten dieser Studien, monieren die Kritiker, seien allerdings von der Industrie beauftragt, was die Unabhängigkeit der Forschung in Frage stelle. Auch Umweltschutzorganisationen wie der BUND und die Weltgesundheitsorganisation WHO warnen weiter vor Gefahren für Mensch, Tier und Umwelt.
Mitgliedstaaten mit Risikomanagement allein gelassen
Damit umzugehen, ist künftig Sache der EU-Mitgliedstaaten. Das Risikomanagement werde auf diese abgewälzt, kritisierte die belgische Abgeordnete Maria Arena (S&D). Denn während die EU-Kommission allein über die Zulassung des Wirkstoffs entscheidet, obliegt die Zulassung von Produkten wie Roundup, die Glyphosat enthalten, den Mitgliedstaaten. Diese müssen also künftig selbst entscheiden, wie sie die möglichen, zum Teil unzureichend erforschten Risiken adressieren und für welche Fälle sie den Gebrauch gegebenenfalls einschränken.
EVP-Vertreter, wie die deutschen Christdemokraten Peter Liese und Christine Schneider, beriefen sich auf die außerordentlich gute Erforschung des Gifts und erinnerten daran, dass man hier rein auf wissenschaftlicher Grundlage entscheiden solle. Auch die EVP befürworte einen „vorsichtigen Einsatz“ des Gifts, sagte Peter Liese. Solange es aber keine angemessenen Alternativen gebe, spreche sie sich für die Zulassung aus. Die Liberalen waren in der Frage gespalten.
Die Entscheidung fiel mit 38 ja, 40 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen knapp aus. Besiegelte aber das vorläufige Ende der Auseinandersetzung des Parlaments mit dem umstrittenen Pestizid. Für die Grünenpolitikerin Jutta Paulus, die in ihrer Fraktion als Expertin zum Thema gilt, ist es bitter, eine mögliche Zulassung nicht verhindern zu können. „Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen“, sagte Paulus im Gespräch mit den DWN. In der Bevölkerung hätte es eine breite Mehrheit für ein Verbot gegeben, weshalb man auf EU-Ebene aktiv geworden sei. Europaweit hatten 2017 eine Million EU-Bürger ein Glyphosat-Verbot gefordert. „Vor sechs Jahren haben wir Glyphosat nur für fünf Jahre verlängert, weil Daten fehlten. Nun wird das trotz immer noch großer Lücken gleich für weitere zehn Jahre durchgesetzt.“ Das Parlament hätte damals mit Mehrheit eine Resolution verabschiedet, dass in dieser Zeit Forschung betrieben werden müsse und auch die Landwirte nach Alternativen suchen sollten.“ Viel geschehen sei dann allerdings nicht. Dabei gebe es erwiesenermaßen Alternativen – auch wenn sie vielleicht etwas aufwendiger seien, als alles tot zu spritzen.
Kommission kann im Zweifel allein entscheiden
Entscheiden konnten die Parlamentarier diese Frage ohnehin nicht. Das kann die Kommission im Zweifel auch im Alleingang, auch wenn sie bei diesem umstrittenen Thema den Rat der Mitgliedsstaaten gern eindeutig auf ihrer Seite hätte. Allein eine qualifizierte Mehrheit im Rat könnte eine Verlängerung der Zulassung verhindern, sagt Jutta Paulus (Grüne/DE). Bei der letzten Sitzung der Kommission mit dem Expertenrat am 13. Oktober war weder dafür noch dagegen eine qualifizierte Mehrheit zustande gekommen. Nur Luxemburg, Österreich und Kroatien hatten sich eindeutig dagegengestellt. Deutschland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Bulgarien und Malta enthielten sich, die restlichen 18 Mitgliedsländer waren für eine Wiederzulassung. Mitte November wird nun im Berufungsausschuss auf der nächsthöheren Ebene verhandelt. „Wir gehen davon aus, dass die Kommission ihren Vorschlag noch einmal modifiziert, um dann eine klare Mehrheit zu bekommen“, sagt Paulus. Das könnte eine kürzere Laufzeit, wie sie Frankreich fordert, oder weitere Anwendungsbeschränkungen betreffen. Die Zeit drängt, am 15. Dezember läuft die Zulassung in der EU aus.
„Unser Vorschlag entspricht der Pflanzenschutzverordnung und geht nicht über die Vollmacht der Kommission hinaus“, verteidigte Kommissionsvertreter Klaus Berend im Ausschuss eine erneute Zulassung von Glyphosat. Für viele der Kritikpunkte hätte die EU-Behörde keine Anhaltspunkte gefunden. „Wir haben tatsächlich einige Einschränkungen vorgenommen, zum Beispiel bei den Abständen zu Wasserflächen und sensiblen Gebieten.“ Was die Entscheidungsfreiheit der Mitgliedsstaaten im Umgang mit dem Stoff angehe, halte man sich hier an den Grundsatz der Subsidiarität.
Entscheidung hat auch Folgen für Deutschland
Einmal beschlossen, wird sich eine erneute Zulassung des Pflanzengiftes auch auf die deutsche Politik auswirken. Im Koalitionsvertrag hatten sich SPD, Grüne und FDP eigentlich verpflichtet, Glyphosat Ende 2023 vom Markt zu nehmen. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hatte sich seither entsprechend positioniert. Doch inzwischen hat die FDP von diesem Beschluss Abstand genommen und auch die SPD machte sich zu Paulus‘ Enttäuschung nicht mehr stark dafür. Das führte im Expertenrat zu der Enthaltung Deutschlands.
Dass 61 Prozent der Bundesbürger gegen eine Wiederzulassung sind, wie eine aktuelle repräsentative Civey-Umfrage im Auftrag des BUND zeigt, und sich 57 Prozent der Befragten sogar für ein nationales Glyphosat-Verbot aussprechen, auch wenn der Wirkstoff auf EU-Ebene wieder zugelassen werden sollte, hilft da wenig. Denn nach einer Zulassung des Wirkstoffs durch die EU-Kommission kann Deutschland ihn nicht mehr einfach verbieten. Damit ist in der Vergangenheit schon Luxemburg gescheitert, wo im März 2023 ein Glyphosat-Verbot aus dem Jahr 2021 vom Verwaltungsgericht kassiert wurde. Der Bayer-Konzern hatte dagegen geklagt. Özdemir kann dann also nur noch mit Einschränkungen bei bestimmten Produkten arbeiten und wird das wohl auch tun. Schon jetzt ist in Deutschland die Anwendung bei bestimmten landwirtschaftlichen Verfahren, auf nicht-landwirtschaftlichen Flächen und im privaten Bereich verboten.