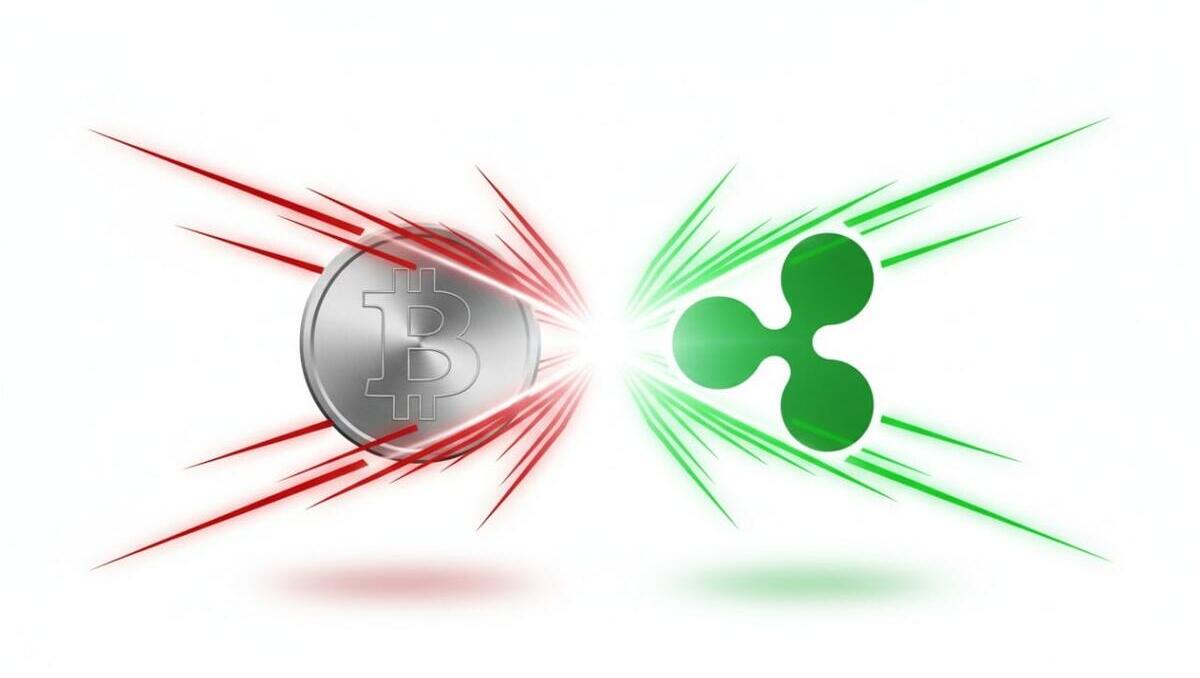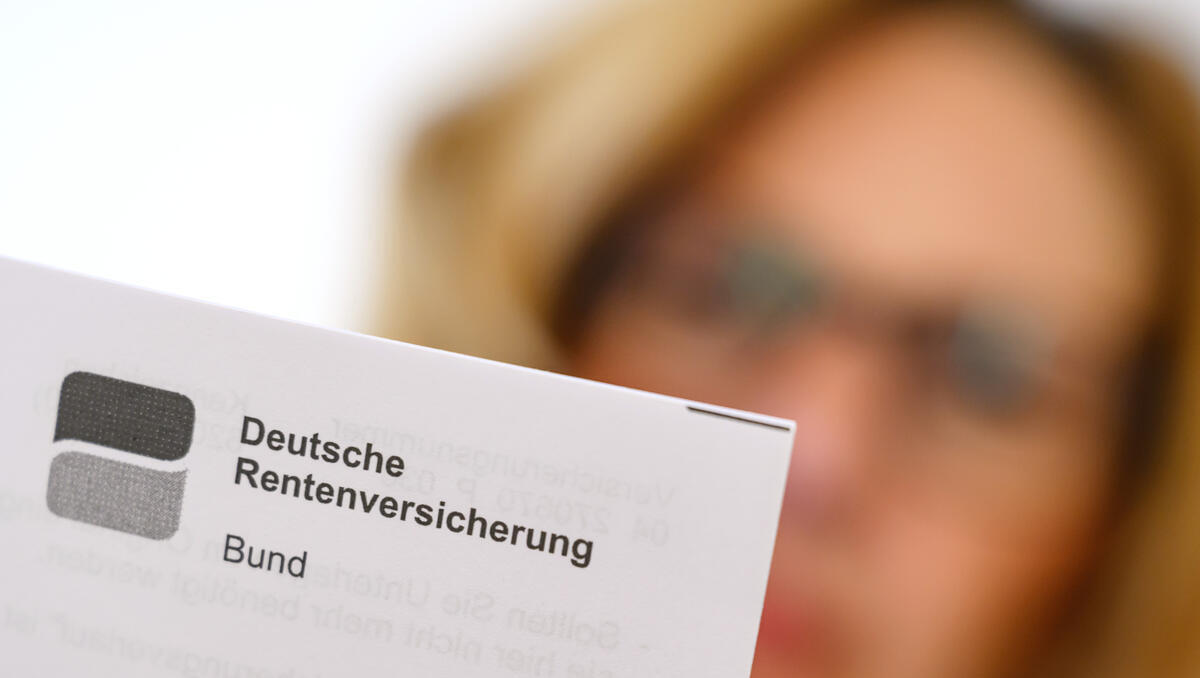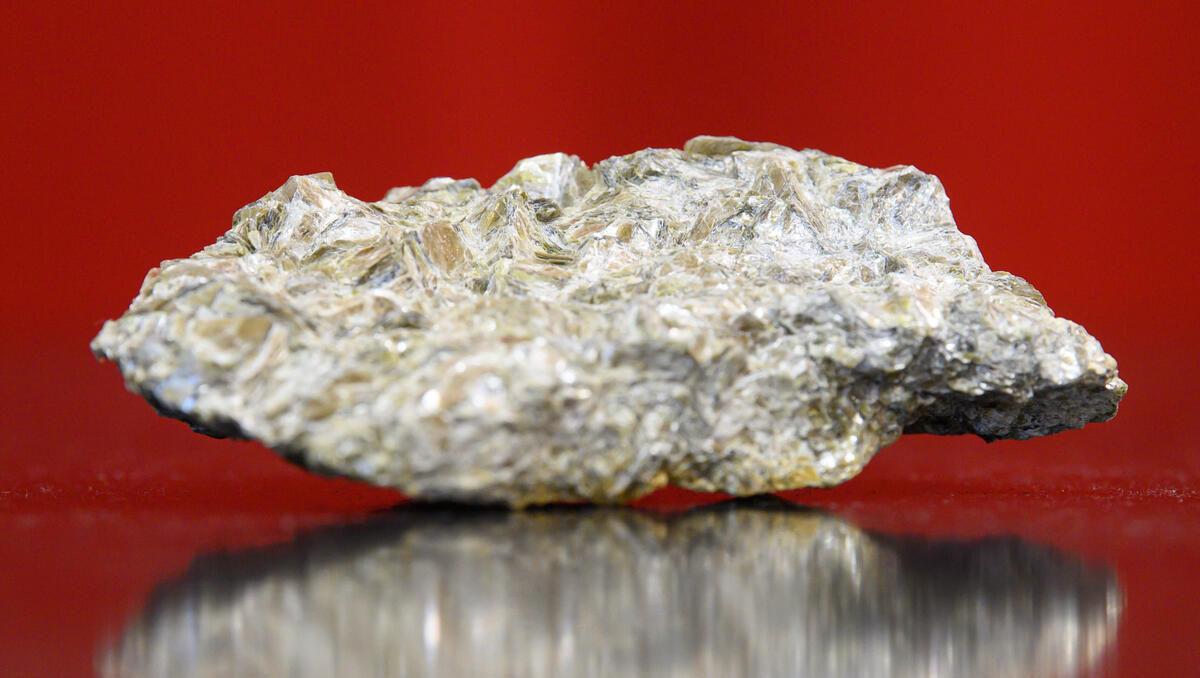Die „Industriepolitik“ ist in den Mittelpunkt wirtschaftlicher und sogar sicherheitspolitischer Debatten gerückt – von den USA bis hin in die Europäische Union. Doch kann der Begriff in die Irre führen, und zwar nicht nur, weil er von seiner Bedeutung her ziemlich vage ist, sondern auch, weil er die wahren Notwendigkeiten, mit denen politische Entscheidungsträger konfrontiert sind, nicht erfasst.
Der Begriff Industriepolitik bezieht sich auf den Einsatz einer breiten Palette von Instrumenten – von Subventionsregeln bis hin zu Steueranreizen –, um das Wirtschaftswachstum insgesamt zu unterstützen oder die Dynamik in bestimmten Sektoren zu fördern. Industriepolitik ist so alt wie der Staat. Geht man 2000 Jahre zurück bis zur Han-Dynastie in China, wird man feststellen, dass die Eisenherstellung dort ein Staatsmonopol war.
Auch in Europa haben industriepolitische Maßnahmen eine lange Geschichte. Jahrhundertelang unterstützten die europäischen Regierungen wichtige – insbesondere stark kriegsrelevante – Branchen und Technologien, um sich einen Vorsprung vor ihren Feinden zu bewahren, die häufig auch ihre Nachbarn waren. In jüngerer Zeit verfolgten sie gemeinsame Industriepolitiken, um ihre Integration voranzutreiben, statt einander zu bekämpfen.
Der grundlegende Wandel begann 1950 mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl. Statt die Chancen von Ländern im Kriegsfall zu verbessern, verfolgte diese europaweite Industriepolitik zur Bündelung der Kohle- und Stahlproduktion das Ziel, Kämpfe auf dem Kontinent zu verhindern. Indem man Kohle und Stahl – die beide für die Produktion von Panzern und Waffen unverzichtbar sind – unter die Kontrolle einer gemeinsamen Hohen Behörde stellte, wurde verhindert, dass ein Land gegenüber den anderen aufrüsten konnte. Zugleich unterstützte diese Politik die wirtschaftliche Erholung nach dem Zweiten Weltkrieg.
Auch andere wichtige Schritte auf dem Weg zur europäischen Integration lassen sich als Industriepolitik beschreiben. Die EU wie wir sie heute kennen begann 1958 mit einem Programm zur Abschaffung von Binnenzöllen durch die Schaffung einer Zollunion. Dem folgten später umfassende Bemühungen zur Verringerung des bürokratischen Aufwands an den europäischen Grenzen durch Harmonisierung von hunderten von Vorschriften; dies gipfelte in der Binnenmarktakte von 1992.
Die europäischen Mitgliedsstaaten verfolgen auch jeweils eigene Industriepolitiken. Dabei wird ihr Spielraum freilich durch strenge EU-Kontrollen über staatliche Beihilfen eingeschränkt, die verhindern sollen, dass länderspezifische Subventionen Unternehmen einen unfairen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Doch investieren die nationalen Regierungen nach wie vor in Forschung und Entwicklung, fördern die technische Bildung und errichten die notwendige Infrastruktur.
Die meisten Ökonomen sind sich einig, dass derartige Interventionen Wachstum und Dynamik steigern können. Hitzig wird die Debatte über die Industriepolitik bei der Frage, ob Regierungen durch Förderung einzelner Sektoren direkt in die Wirtschaft eingreifen sollten. Eine aktuelle Studie von Réka Juhász, Nathan J. Lane und Dani Rodrik hat zusätzlich Öl ins Feuer gegossen. Sie zeigt, dass staatliche Maßnahmen sehr langfristige Auswirkungen auf den Standort bestimmter Branchen haben können.
Freilich steht die Industriepolitik heutzutage nicht aufgrund der wirtschaftswissenschaftlichen Forschung weit oben auf der Tagesordnung der Regierungen. Vielmehr sind die Regierungen hauptsächlich von geopolitischen Spannungen motiviert: Sowohl die USA als auch China haben offizielle industriepolitische Strategien verabschiedet, die die Notwendigkeit betonen, Sektoren zu unterstützen, die als für die nationale Sicherheit zentral angesehen werden. So gesehen nimmt sich der heutige industrielle Konkurrenzkampf zwischen den Großmächten sehr wie das alte, kriegsgeplagte Europa aus.
Doch was ist mit einer europaweiten Industriepolitik? Die Europäische Kommission hat kürzlich eine Liste kritischer Technologien veröffentlicht. Aber bei der Umsetzung einer Industriepolitik im Stile jener der USA oder Chinas sieht sich Europa mit einem Paradox konfrontiert: Das Bemühen der EU, die Nutzung der Industriepolitik als geopolitisches Werkzeug zwischen den europäischen Ländern zu beenden, hat den Spielraum ihrer Mitgliedsstaaten, auf geopolitisch motivierte Industriepolitiken anderer zu reagieren, erheblich eingeschränkt.
Sicherlich hat sich die EU um Sektoren im Niedergang gekümmert. Als 1978 die Stahlindustrie Probleme hatte, setzte die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft den sogenannten Davignon-Plan um, der die Produktion den in europäischen Ländern in etwa proportional beschränkte. Aber hat die EU nie eine aktive Industriepolitik verfolgt. Das hat den schlichten Grund, dass sie anders als China und die USA keinen Bundeshaushalt hat, aus dem große Subventionen für spezifische Sektoren bereitgestellt werden könnten.
Es ist daher verständlich, dass sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für einen neuen europäischen Souveränitätsfonds ausgesprochen hat. Aber es ist auch nachvollziehbar, dass die nationalen Regierungen, die diesen Fonds finanzieren müssten, zögern, das Geld ihrer Steuerzahler an die EU abzugeben, um industrielle Entwicklung anderswo zu fördern.
In Ermangelung einer Finanzierung auf EU-Ebene für eine gemeinsame Industriepolitik lockert die Europäische Kommission derzeit die Regeln für staatliche Beihilfen. So kann die Kommission etwa im Rahmen des europäischen Chip-Gesetzes gezielte nationale Fördermaßnahmen für große Halbleiterfabriken genehmigen. Aber ob man glaubt, dass die neu gewonnene Fähigkeit der Mitgliedsstaaten, bestimmte Industrien zu unterstützen, den gewünschten Effekt haben wird, hängt davon ab, auf welcher Seite der industriepolitischen Debatte man steht.
Wer glaubt, dass die Regierungen Sektoren mit Potenzial für positives Wachstum ermitteln können, wird den Ansatz der EU begrüßen – insbesondere, weil sich die Kommission das Recht vorbehält, zu beurteilen, ob vorgeschlagene nationale staatliche Beihilfen proportional und effizienzsteigernd wären. Die Skeptiker andererseits glauben, dass die nationalen Regierungen wahrscheinlich „nationale Champions“ oder politisch bequeme Projekte finanzieren werden und dass die EU-Bürokraten nicht gut aufgestellt sind, komplexe Lieferketten zu entwirren und die Sektoren mit dem größten Potenzial zu ermitteln.
Vergangene Erfahrungen, die den Einfluss nationaler Champions auf die Politik beleuchten, deuten darauf hin, dass die Sicht der Skeptiker womöglich die realistischere ist. Andererseits kann und sollte es bei der Industriepolitik um viel mehr gehen als darum, großen Unternehmen Milliarden von Euros zuzuschieben, um im eigenen Land High-Tech-Fabriken zu errichten. Eine Erhöhung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung würde eine bessere Grundlage für die High-Tech-Industrie im Allgemeinen darstellen.
Diese indirekte Unterstützung könnte immer noch gezielt erfolgen. So würde etwa die Mikrochip-Industrie von der Schaffung spezialisierter technischer Hochschulen und der Förderung lokaler Expertise in Schlüsselbereichen des Chip-Herstellungsprozesses profitieren. Ein solcher Ansatz ist mehr Strategie als Politik – und dürfte Europa viel mehr nutzen, als wenn man einen Haufen öffentlichen Geldes in ein paar Mega-Fabriken steckt.
Aus dem Englischen von Jan Doolan
Copyright: Project Syndicate, 2023.