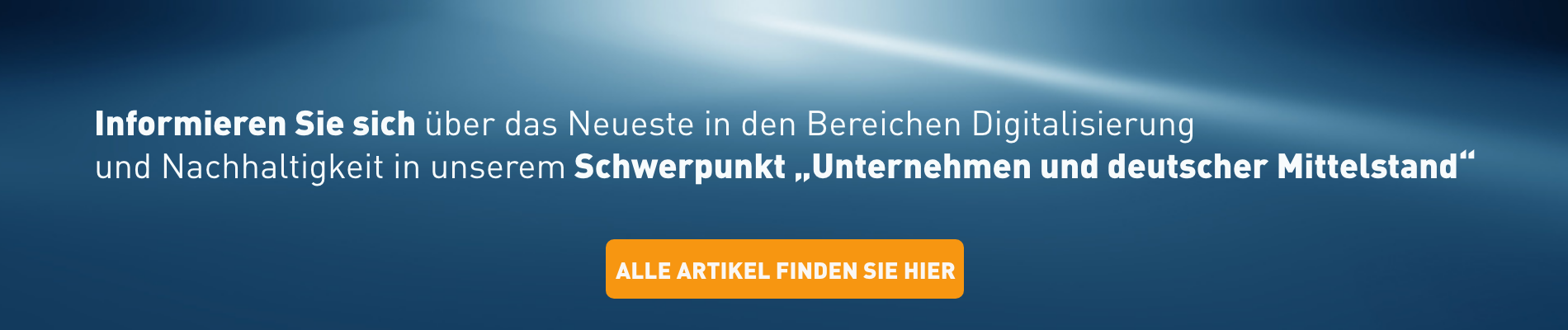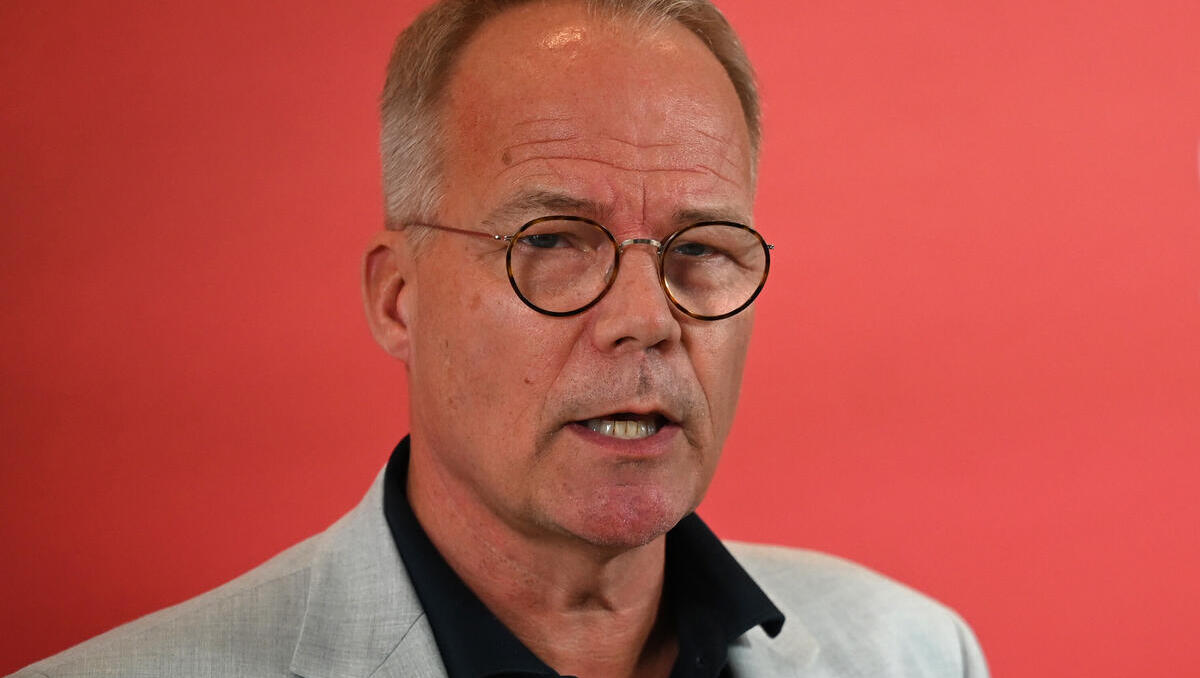Es hat allen Anschein, als würde sich der Klimawandel beschleunigen. Nicht nur die Sommer werden heißer; auch Extremwetterereignisse werden zunehmend häufiger. Die tropischen Regengüsse, die Europa verheert haben, und die starken Orkane, die die Karibik und die USA immer früher im Jahr treffen, belegen dies beispielhaft. Und doch scheint die Europäische Union, die sich seit langem als Vorreiter im Kampf gegen den Klimawandel positioniert hat, kurzsichtige Überlegungen über fundierte wirtschaftliche Logik zu stellen.
Die EU hat gezeigt, dass sie bereit ist, im Kampf gegen den Klimawandel zu handeln, selbst wenn dies politisch schwierig ist. Aber in einigen Bereichen steht sie sich selbst im Weg. Man denke etwa an das Verbot des Verkaufs neuer CO2-emittierender Autos ab 2035. Es ist ein mutiger Schritt, der durch eine rasche Erhöhung des Marktanteils von Elektrofahrzeugen die Emissionen reduzieren würde. Aber es war auch höchst umstritten, nicht zuletzt, weil Elektrofahrzeuge derzeit viel mehr kosten als herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.
Das müsste nicht sein: China produziert Elektrofahrzeuge, die die Europäer halb so viel kosten könnten wie die, die derzeit in der EU angeboten werden. Doch statt kostengünstige Elektrofahrzeuge aus China zu begrüßen, hat die EU diese jüngst in widersinniger Weise mit hohen Zöllen von zwischen 17 % und 38 % belegt.
Die offizielle Begründung hierfür lautet, dass die ökologische Wende „nicht auf unfairen Einfuhren zulasten der EU-Industrie beruhen“ dürfe. Doch bei Anwendung des Konzepts der „offenbarten Präferenzen“ – Ökonomen-Sprech dafür, dass Taten lauter sprechen als Worte – zeigt die Entscheidung zur Verhängung derart hoher Zölle auf chinesische Elektrofahrzeuge, dass der Europäischen Kommission die Sicherung von Arbeitsplätzen und die Gewinne der Automobilindustrie wichtiger sind als der Kampf gegen den Klimawandel.
Die EU ist durchaus kein Einzelfall. Tatsächlich wirken die EU-Zölle bescheiden im Vergleich zu dem Zoll von 100 %, den US-Präsident Joe Biden kürzlich ankündigte – eine Abgabe, die chinesische Elektrofahrzeuge praktisch vom US-Markt ausschließen wird. Andere Länder mit bedeutender heimischer Automobilindustrie – wie die Türkei und Brasilien – haben ebenfalls hohe Zölle verhängt, und auch Kanada erwägt einen solchen Schritt.
Angesichts des großen Überangebots der EU an Elektrofahrzeugen ist schwer ersichtlich, wie Einfuhren chinesischer Elektrofahrzeuge die europäische Automobilindustrie bedrohen. Wichtiger ist, dass ein Wettlauf zur Entwicklung umweltfreundlicher Technologien angesichts der vom Klimawandel ausgehenden existenziellen Gefahr für die Welt wünschenswert sein sollte und alle Länder umweltfreundliche Industrien, einschließlich des Sektors für Elektrofahrzeuge, unterstützen sollten. Doch werden die Vorteile einer derartigen Unterstützung – von einer schnelleren technologischen Entwicklung bis hin zu niedrigeren Preisen – weitgehend ausbleiben, wenn sich jedes Land gegen den Import von Waren wehrt, die mit Hilfe umweltfreundlicher Subventionen entwickelt wurden.
Das Standardargument für Schutzzölle lautet, dass neue Industrien Zeit brauchen, um sich zu entwickeln und Skaleneffekte zu erzielen, bevor sie ungebremster globaler Konkurrenz ausgesetzt werden. Die Anwendung dieses Arguments auf die Automobilindustrie, die es schon seit über einem Jahrhundert gibt, ist allerdings nicht plausibel.
Darüber hinaus besteht ein großer Unterschied zwischen einem allgemeinen Zoll, der auf alle Importe angewendet wird, und einem diskriminierenden Zoll, der nur auf Importe aus einem bestimmten Land Anwendung findet. Das Problem bei Letzterem ist, dass er zu Verlagerungen von Handelsströmen führt: Mit schwindender Wettbewerbsfähigkeit der Importe aus dem Zielland steigen die Einfuhren aus Drittländern. Und weil die Importe aus dem Zielland jetzt teurer sind, können die Drittländer ihre Preise erhöhen, ohne an Wettbewerbsfähigkeit einzubüßen.
Wenn europäische Verbraucher aufgrund von Zöllen höhere Preise für chinesische Elektrofahrzeuge zahlen, bleibt das Geld in Europa und fließt effektiv in die Kassen der EU. Dasselbe gilt, wenn europäische Verbraucher höhere Preise für in Europa hergestellte Elektrofahrzeuge zahlen, nur dass in diesem Fall die europäischen Produzenten von den erhöhten Gewinnen profitieren. Aber wenn die europäischen Verbraucher mehr Elektrofahrzeuge aus Drittländern kaufen, fließt ihr Geld ins Ausland. Gegen Subventionen gerichtete Zölle, die per se diskriminierend sind, sind daher mit hohen wirtschaftlichen Kosten verbunden.
Diese Kosten wären nicht weiter problematisch, wenn die EU keine oder nur wenige alternative Quellen für Importe von Elektrofahrzeugen hätte. Aber obwohl es die wichtigste Quelle für Importe von Elektrofahrzeugen in die EU ist, entfällt auf China nur knapp die Hälfte des Gesamtvolumens. Im letzten Jahr, als die Regierungen der EU über einen „Anstieg“ chinesischer Importe von Elektrofahrzeugen lamentierten und sogar eine Untersuchung dazu einleiteten, sank der Anteil Chinas an den europäischen Importen von Elektrofahrzeugen im Vergleich zu 2022 sogar, da die EU mehr Elektrofahrzeuge aus anderen Ländern – darunter aus Japan, Südkorea und dem Vereinigten Königreich – importierte als aus China.
Leider verbieten die Regeln der Welthandelsorganisation (WTO) gegen Subventionen gerichtete Zölle nicht, und zwar selbst dann nicht, wenn derjenige, der sie verhängt, selbst Subventionen eingeführt hat. Und trotz der weltweiten Vorteile, die wettbewerbsorientierte umweltfreundliche Märkte durch Unterstützung des Kampfes gegen den Klimawandel hätten, sorgen die Regeln auch nicht dafür, dass umweltfreundliche Güter von handelspolitischen Abwehrmaßnahmen ausgenommen sind. Der viel gepriesene Versuch des Jahres 2014, derartige Ausnahmen in Form eines Umweltgüterabkommens umzusetzen, scheiterte in der Verhandlungsphase.
Konflikte zwischen Handelspartnern über Subventionen in ein und derselben Branche sind nicht neu. Jahrzehntelang beschwerten sich die EU über US-Subventionen für Boeing und die USA über europäische Subventionen für Airbus. Schließlich einigten sich beide Seiten im Wesentlichen darauf, das Recht der anderen Seite zur Subventionierung ihres Flugzeugsektors zu respektieren. Da beide Seiten ihr Bekenntnis zur Bekämpfung des Klimawandels proklamieren, sollten die EU und China eine ähnliche Vereinbarung über Elektrofahrzeuge anstreben.
Aus dem Englischen von Jan Doolan
Copyright: Project Syndicate, 2024.
www.project-syndicate.org