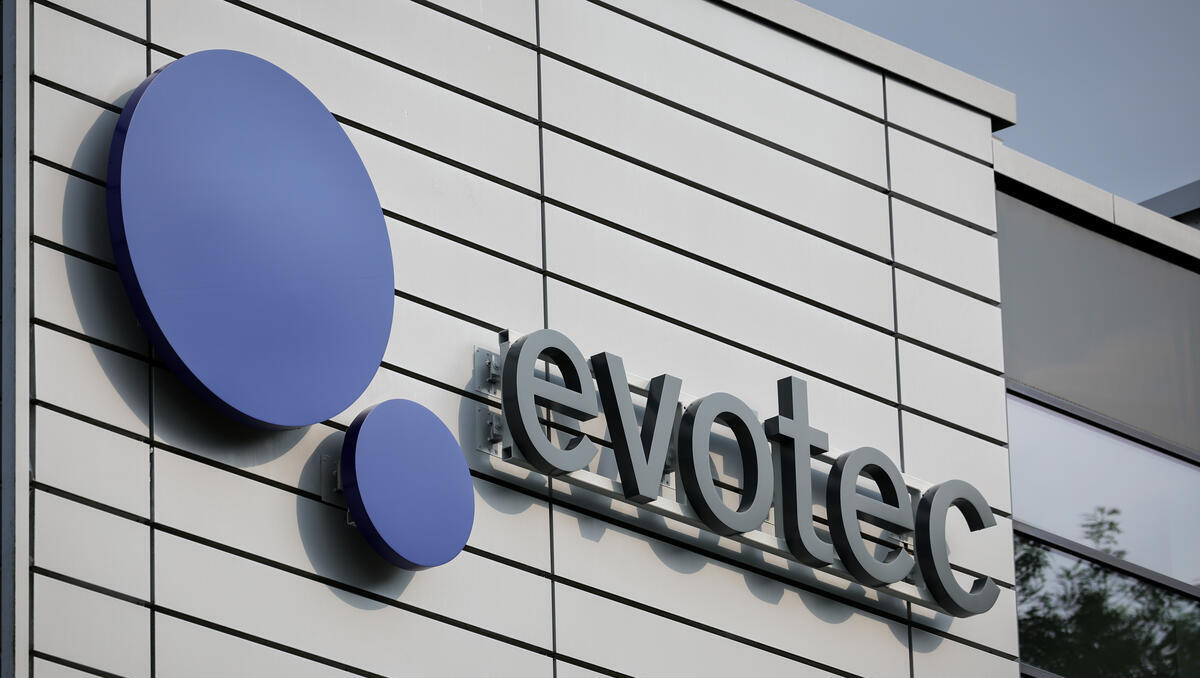Die Vergabe des Friedensnobelpreises 1994 an Jassir Arafat, Schimon Peres und Izchak Rabin war von großen Hoffnungen geprägt. Mit dem Oslo-Abkommen hätten die palästinensischen und israelischen Politiker "wichtige Beiträge zu einem historischen Prozess" geleistet, der "Krieg und Hass" durch "Frieden und Zusammenarbeit" ersetzen sollte, verkündete das Nobelkomitee damals hoffnungsvoll.
Im Sinne des Testaments von Alfred Nobel (1833-1896) würdigte das Komitee den Mut, mit dem diese führenden Politiker des Nahen Ostens neue Chancen für eine friedliche Zukunft geschaffen hätten. "Es ist die Hoffnung des Komitees, dass der Preis all den Israelis und Palästinensern als Ermutigung dient, die sich für dauerhaften Frieden einsetzen", hieß es in Oslo.
30 Jahre später ist diese Hoffnung auf Frieden – wieder einmal – zerschlagen. Nach dem Terrorangriff der Hamas herrscht erneut Krieg. Vor der Bekanntgabe des diesjährigen Friedensnobelpreisträgers am kommenden Freitag (11. Oktober) scheint ein Ende des Nahost-Konflikts ferner denn je.
"Frieden ist eine Frage des Willens"
Kein Konflikt ist unlösbar. "Frieden ist eine Frage des Willens. Alle Konflikte können gelöst werden, es gibt keine Entschuldigung, sie ewig bestehen zu lassen", sagte der Friedensnobelpreisträger Martti Ahtisaari 2008 in seiner Nobelrede. Frieden erfordert jedoch Politiker, die – wie einst Arafat, Peres und Rabin – stark genug sind, den Teufelskreis von Hass und Gewalt zu durchbrechen und einen Weg zur Versöhnung zu finden.
Doch derzeit gibt es von keiner Seite diese Bereitschaft, meint der Direktor des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri, Dan Smith. Um eine friedliche Koexistenz zu schaffen, seien gegenseitiger Respekt und Führer nötig, die sich an den Verhandlungstisch setzen und an Lösungen arbeiten. "Frieden ist immer möglich", sagt Smith zwar. Doch ob dies im Nahost-Konflikt tatsächlich eintreten wird, ist für ihn fraglich.
Trotzdem hält Smith die Vergabe des Friedensnobelpreises an Arafat, Peres und Rabin für gerechtfertigt. Damals gab es einen großen Durchbruch und die Hoffnung, nach der Verleihung des Preises an Nelson Mandela und Frederik Willem de Klerk im Jahr zuvor, den nächsten großen Friedensprozess zu unterstützen. Doch die Erwartungen waren wohl zu hoch, schätzt Smith heute ein.
Friedensnobelpreis: Ein Friedenspreis in unsicheren Zeiten
Die Frage, ob der Friedensnobelpreis erneut an Nahost-Politiker vergeben wird, stellt sich in diesem Jahr nicht. Die Welt scheint generell in einem katastrophalen Zustand: Neben dem Nahost-Konflikt wütet der russische Krieg gegen die Ukraine, und auch im Sudan sowie an vielen anderen Orten herrscht Gewalt. Gibt es in einer so schwierigen Zeit überhaupt geeignete Kandidaten für den wichtigsten Friedenspreis der Welt?
Laut der Zahl der Nominierungen lautet die Antwort: Ja, es gibt sie, aber deutlich weniger als zuvor. Dieses Jahr wurden 197 Einzelpersonen und 89 Organisationen nominiert. Im Vergleich zu den 351 Nominierten des Vorjahres ist das eine Reduktion von fast 20 Prozent.
Auch in den vergangenen Jahren war die Weltlage düster. Das Nobelkomitee entschied sich deshalb, Menschenrechtler auszuzeichnen: 2023 ging der Friedensnobelpreis an die inhaftierte Iranerin Narges Mohammadi, 2022 an Ales Bjaljazki sowie die Organisationen Memorial und das Center for Civil Liberties.
Kein Frieden – kein Friedensnobelpreis?
Und in diesem Jahr? Der prominente russische Menschenrechtler Alexej Nawalny, oft als Favorit genannt, ist seit acht Monaten tot. Zudem gibt es keine Friedensperspektiven in den laufenden Konflikten.
"Die Welt steht vor enormen Herausforderungen", stellt Smith fest. Das gilt nicht nur für die Situation im Nahen Osten, in der Ukraine und im Sudan, sondern auch für etwa 50 weitere bewaffnete Konflikte weltweit. Das Nobelkomitee könnte die dramatische Weltlage dadurch widerspiegeln, dass es erstmals seit über 50 Jahren keinen Friedensnobelpreis vergibt.
"Es wird nicht genug für den Frieden getan", kritisiert Smith. "Vielleicht wäre es in diesem Jahr die stärkste Botschaft, den Preis nicht zu vergeben." Dies wäre ein Signal an die Welt, dass es Zeit zum Handeln ist.
Es wäre nicht das erste Mal, dass der Friedensnobelpreis nicht vergeben wird. Seit der ersten Verleihung im Jahr 1901 gab es 19 Jahre ohne Preisträger, darunter 13 Jahre während der Weltkriege und zuletzt 1972.
Organisationen unter den Favoriten
Das Osloer Friedensforschungsinstitut Prio sieht hingegen internationale Organisationen als mögliche Preisträger. Prio-Direktor Henrik Urdal nennt das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) der OSZE als Favoriten. Auch der Internationale Gerichtshof (IGH), das UNRWA und die UNESCO gehören zu den Organisationen, die in Urdals Auswahl stehen.
Wie sich das Nobelkomitee entscheiden wird, bleibt wie immer ein Geheimnis. Die Namen der Nominierten werden traditionell 50 Jahre lang unter Verschluss gehalten. Die Bekanntgabe des Friedensnobelpreisträgers erfolgt am 10. Dezember, Nobels Todestag. Dann wird der Preisträger mit dem Friedensnobelpreis und einem Preisgeld von elf Millionen schwedischen Kronen (ca. 970.000 Euro) ausgezeichnet – falls es diesmal einen Preisträger gibt.