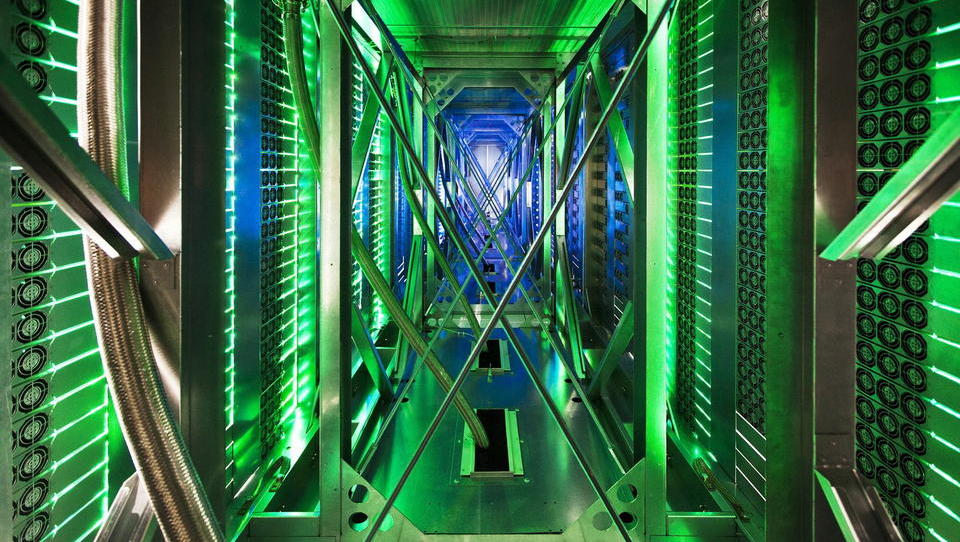Die verschwenderische Vielfalt in der Kulturbranche ging lange Jahre gut und lockte zunehmend mehr Touristen in die deutsche Hauptstadt. Doch die Wirtschaftskrise des Landes hat auch Theater, Museen und Opern erfasst. Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner (CDU), und sein schwarz-roter Senat hoffen deshalb verzweifelt auf zusätzliche Mittel des Bundes. Kann die von Friedrich Merz in Aussicht gestellte Lockerung der Schuldenbremse die Kulturszene der Stadt vor ihrem Untergang retten?
Wirtschaftsfaktor Kultur: Kommen nun Entlastungen durch Bundeszuschüsse?
Für die einen gibt es eine direkte, unmittelbare Verbindung zwischen Kultur und Demokratie. Für die anderen ist das Angebot von Bühnen und Museen weitgehend entbehrlich und in Zeiten knapper öffentlicher Kassen ein Posten für den Rotstift. Die Bundeshauptstadt Berlin ist dafür - pars pro toto - das beste Anschauungsbeispiel. Der Tourismus ist auf einen üppigen Kulturkalender angewiesen. Theaterkarten verkaufen auch Hotelbetten und Abendessen in der Stadt. Doch Finanzsenator Stefan Evers (CDU) plagt sich mit einem Milliardendefizit in seinem Haushalt und sieht sich gezwungen, mit dem Rasenmäher die erst in den vergangenen Jahren aufgestockten Etats zu barbieren. Nachdem der Etat für das Jahr 2025 bereits um 130 Millionen Euro abgesenkt werden musste, sollen im kommenden Jahr nochmals 15 Millionen Euro gestrichen werden, teilte die Berliner Kulturverwaltung im Februar mit.
Für das Jahr 2026 sehen die Eckwerte des Senats zwar nominell drei Millionen Euro mehr vor. Allerdings sind auch Mittel nötig, um drohende Tarifsteigerungen aufzufangen. Der Berliner Kulturhaushalt wird 2025 mit 964 Millionen Euro beziffert. 2026 wird er auf 949 Millionen Euro sinken müssen, für 2027 sind dann vorerst 967 Millionen Euro in den Büchern vorgesehen.
Im Landeshaushalt sollen 2026 und 2027 insgesamt 1,6 Milliarden gespart werden, wie die Koalition aus CDU und SPD bei ihren Beratungen errechnet hat. Alle Verwaltungen sind demnach zum Sparen verpflichtet. Nur Bildung, Wissenschaft und Inneres werden der Höhe nach besser gestellt und verschont. Als Kultursenator Joe Chialo von der CDU die Vertreter der Kultureinrichtungen über die Sparbeschlüsse informierte und klar stellte, dass diese nicht zu verhandeln seien, reagierte die Szene mit erpresserischem Entsetzen.
Als Theater und Varietés noch von Eintrittskarten lebten und Berlin trotzdem Kulturstadt war
Ein kurzer Rückblick: Historisch gesehen, war die Berliner Kulturlandschaft mal nicht viel anders aufgestellt als die von New York. Es gab zwar stets Staatstheater wie die Oper Unter den Linden oder das Konzerthaus am Gendarmenmarkt. Kurzweiliges Theater und frivoler Tingeltangel indessen waren noch unter dem großen Intendanten Max Reinhardt und der Nationaltheater AG sowie anderen Impresarios stets ein privates Geschäft, dass auf den Verkauf von Eintrittskarten und nicht Subventionen basierte. Mit Machtergreifung der Nazis wurde die Kultur verstaatlicht und dadurch ans Gängelband gelegt. Zensur durch Goebbels` Reichspropagandaministerium und Almosen für die deutsche Kunst wurden zu zwei Seiten der selben Medaille.
Richtig erholt hat sich die Szene davon auch nach über 80 Jahren danach noch nicht. Die Staatsferne ist zwar hehres Ziel mit Verfassungsrang. Doch praktisch handelt es sich nun um eine freiwillige Selbstkontrolle. Diese Erfahrung macht man plötzlich wieder in den ostdeutschen Klein- und Mittelstädten wie Stendal in Sachsen-Anhalt, wo Kommunalpolitiker der AfD neuerdings wieder ihren persönlichen Geschmack für die Richtschnur halten. Ohne Zuschüsse des Stadtkämmerers oder von Vater Staat geht es eben nicht. Schon gar nicht in Berlin, wo beinahe überall in der Stadt Einrichtungen dem Hehren und Schönen und Wahren verpflichtet sind - oder dies zumindest vorgeben.
In Zeiten von Wachstum und Aufschwung haben die Kulturschaffenden vom stets sprudelnden Füllhorn der dynamisch wachsenden Bundesrepublik profitiert. Sie konnten dabei stets selbstbewusst sogar auf Eigenständigkeit pochen und jegliche politische Einflussnahme weitgehend verhindern. Das ging zum Schluss so weit, dass als andere Art von Beschäftigungsprogrammen und ich-freiberuflichen AGs zuletzt beinahe jede Form von Off-Kultur gleichermaßen bezuschusst wurde und immer mehr alternative Spielstätten in den Rang von städtischen Kulturhäusern erhoben worden - konzentriert in der Bundeshauptstadt. Selbst die Filmbranche ist vom beschaulichen München letztlich ins hippe Berlin abgewandert.
Doch in der Wirtschaftskrise zeigt sich, dass dies so nicht weitergehen kann. Deutschland hat sich mit seiner breiten Kultur- und Kunstförderung übernommen - nirgends trifft dies eine Stadt so hart wie Berlin. Nirgendwo ist der Aufschrei und Protest so groß wie in Berlin, wo ein breiter Bodensatz von Künstlern, Schauspielern und Selbstdarstellern (in Ermangelung von Industrie und Fertigung) inzwischen das Rückgrat der bestimmenden urbanen Dienstleistungsgesellschaft bildet. Die Stadt hat sich als „arm, aber sexy“ zu den führenden Kultur-Metropolen hochgekämpft und muss sich nun - nolens, volens - fragen (lassen), ob diese Rechnung weiter aufgeht.
Kein Bereich der schönen (darstellenden wie bildenden) Künste, der sich deshalb nicht im vergangenen Winter des Unvergnügens mit Protestnoten, Warnungen und Mahnungen an die Öffentlichkeit gewandt haben in Berlin. Auch die Berliner Verlage wie Suhrkamp, Ullstein und Wagenbach, insgesamt 50 Häuser an der Zahl, kritisierten per offenem Brief: „Kultur ist kein Luxus!“ Die drastischen Sparvorgaben tangierten die gesamte Stadt, und „ein kulturell verarmtes Berlin ist ein unattraktives Berlin“. Die Berliner Akademie der Künste sowie ihr Pendant die Darmstadt, die Akademie der Sprache und Dichtung appellieren, die Kürzungspläne ganz grundsätzlich zu überdenken und spricht in ihrem öffentlichen Aufruf von „lebensnotwendigen Investitionen“ in die Kultur zur Erhaltung der Demokratie, „für Dialog und Begegnung“ und „gesellschaftlichen Zusammenhalt“.
Der Kulturkalender ist überbordend voll - Unterhaltungsprogramm regiert das Land
Denn nicht nur in Berlin muss gespart werden. Auch andere Großstädte wie München, Köln, Dresden und Hannover haben in der Not erkannt, dass Festivals und Eventreihen, Pop-up-Shows und Performances mittlerweile überbordend sind im Kultur-Kalender. Man könnte fast schon sagen, die Deutschen amüsieren sich zu Tode. Mehr Unterhaltung war nie! Gleichzeitig war der Spardurck noch nie nie so evident. Die Feststellung der Akademien, Kulturförderung sei „keine Subvention, die je nach wirtschaftliher Lage beschnitten werden kann", ist insofern schon ziemlich gewagt. Nicht wenige Politiker bundesweit regt inzwischen regelrecht auf, wie rücksichtslos und selbstverliebt die Kulturszene inzwischen öffentlich agiert. In Berlin haben sich die Ausgaben seit 2016 quasi verdoppelt. Dennoch klingt es in den Kiezen der Hauptstadt so, als nagten alle Künstler bereits am Hungertuch.
Vor allem die Theater-Szene geriet geradezu in helle Aufruhr und nutzte ihre Reklameflächen, um gegen das Spardiktat zu stänkern. Kultursenator Joe Chialo, der als Manager aus der Musikbranche eigentlich endlich mal ein Sachverständiger ist, wurde en den Pranger gestellt, denn er habe sich nicht hinreichend zur Wehr gesetzt. Widerstand mit nicht geringem Erfolg: So muss die Schaubühne statt 1,8 Millionen nur noch eine Million Euro kürzen. Brechts altes Berliner Ensemble am Schiffbauerdamm soll Einsparungen von einer Million statt 1,75 Millionen Euro bewerkstelligen. Das Konzerthaus Berlin hat die Lücke auf 400.000 Euro reduziert. Der Zuschuss für die renommierte Berliner Philharmonie werde nun doch nicht gesenkt - ursprünglich sollten hier zwei Millionen Euro zusammengeklaubt werden. Dennoch wird sich Chialo gut gemerkt haben, wie sein Klientel wirklich tickt. Wer weiß, welche Schlussfolgerungen er aus den Scharmützeln des Winters zieht, sollte ausgerechnet er der neue Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien werden - das richtige Parteibuch hat Chialo ja. Ob die Kultur ies noch schafft, als Staatsziel im Grundgesetz verankert zu werden, wie es die Ampel der Szene versprochen hatte, wird sich zeigen. Gut möglich ist aber auch, dass CDU und CSU ihren Begriff der Leitkultur genauer definieren und die Fördermilliarden gezielt und verstärkt dafür einsetzen.
Warum nicht die Philharmoniker über Sponsorengelder und Mäzenatentum finanzieren?
Wird es nicht allmählich Zeit, out of the box zu denken. Schon der Umgang mit den Philharmonikern in Berlin zeigt, dass die Politik es am liebsten allen gleichermaßen recht machen möchte und sich selbst an die Erbhöfe nicht herantraut, die eigentlich auch durch Sponsorengelder gestopft werden könnten. So wie es etwa die Met in New York und andere große Häuser auf der Welt hinbekommen, ohne dass ihre Qualität und Souveränität leiden. Wer, wenn nicht die Philharmoniker, sollte denn sonst im deutschen Kulturbetrieb in der Lage sein, sich mutig und zuversichtlich selbst finanzieren zu können? Doch derlei Gespräche sind unangenehm, und die Politik sucht bekanntlich den geringsten Widerstand.
Und deshalb gehört auch die Atelierförderung zu einer der größten Einsparpositionen in Chialos gerupfter Kulturbilanz. Für Arbeitsräume von freien Künstlern sollen von 21,35 Millionen radikal auf 3,225 Millionen zusammengestrichen werden. Einigermaßen leicht fiel es desweiteren, sechs Millionen Euro für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz einzusparen, schon allein weil sie als Kofinanzierung von Bundesmitteln im Haushalt verbucht war und unterdessen der Bund seinen Beitrag bereits gestrichen hat. Kosmetische Streichungen, die künftig wohl der Bund anderweitig ausgleichen muss.
Nicht jede Laienspielschar, die nach Unterstützung ruft, muss gleich institutionell gefördert werden
Es sei denn, Berlin kann sich durch die geplante Lockerung der Schuldenbremse berappeln, auf die die CDU und SPD bei ihren Sondierungsgesprächen verständigt zu haben scheinen. Gut möglich, dass die fehlenden Millionen im Berliner Kulturetat so schon recht bald ausgeglichen werden und der Bund sich weiterhin exorbitant für die kulturellen Leuchttürme in Berlin engagiert.
Die große Hoffnung, nicht gleich jede Laienspielschar mit Subventionen oder gar einer institutionellen Förderung zu versehen und zu versteitigen, werden sich die Steuerzahler hingegen wohl abschminken müssen. Friedrich Merz und seine Mannschaft sind letztlich Pragmatiker und ja nicht Mitglieder der (bis zum bitteren Ende) dem Sparen verpflichteten) FDP. Die ist womöglich für lange Zeit aus dem Bundestag raus und wird insofern kaum noch eine Rolle spielen, wenn es darauf geht, die Kultur zu beschneiden und erst dadurch - wie einen Rosenstock - zur wahren Blütenpracht zu bringen.
Ob ein Kultursenator deshalb Punkte in der Kultur-Szene Berlins macht, darf gleichwohl bezweifelt werden. Die jungen Wilden sind nicht nur alle auf günstigen Wohnraum angewiesene Mieter, sondern oft zugleich auch (Lebens)-Künstler. Das Berliner Prekariat wählt künftig wahrscheinlich lieber die Linke.
Und auch auf Bundesebene wird es letztlich wohl zu einem Umdenken kommen. Nicht alles, erfordert gleich den Millionen teuren Bau weiterer Dokumentationszentren. Claudia Roth von den Grünen hätte im Kanzleramt gerne noch Prestigeprojekte wie das Polnische Haus gegenüber vom Reichstagsgebäude oder gar einen extra Erinnerungsort zur Aufarbeitung des deutschen Kolonialismus gebaut - da ließen sich fast eine halbe Milliarde Euro einsparen und anderweitig verwenden.