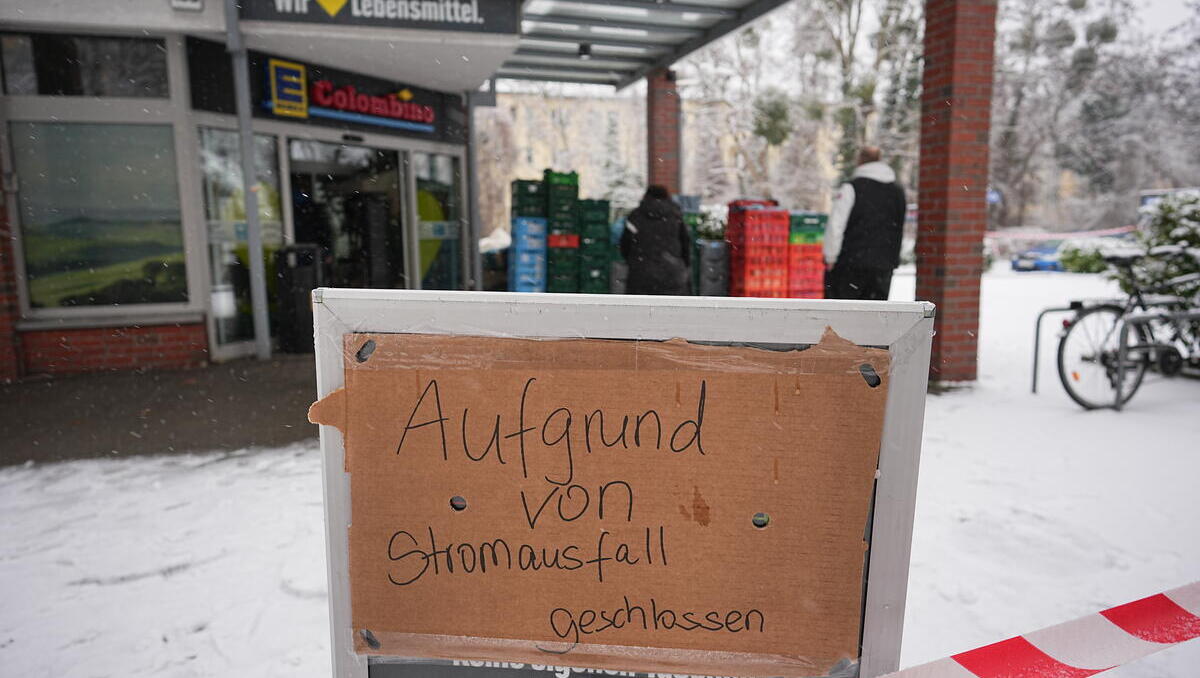Deutschlands Erfindergeist – ein Blick zurück
Buchdruck, Automobil, Aspirin, Glühbirne, Fernsehen, Kernspaltung, Telefon, Computer, das MP3-Format – die Liste der Erfindungen aus Deutschland ist beindruckend. Und noch viel länger. Klar ist, dass das Land der Dichter und Denker einiges entdeckt hat, was unsere moderne Welt prägt. Besonders die deutschen Ingenieursleistungen waren lange Zeit international gefragt. Doch wird das so bleiben? Schaut man sich den aktuellen Niedergang der exportabhängigen Verbrennerindustrie an, mit allen dazugehörigen Arbeitsplätzen, kann schon einmal die Frage aufkommen, wann „Made in Germany“ nun von „Made in China“ abgelöst wird – gerade im Bereich Elektromobilität. Oder ob dies nicht schon längst geschehen ist.
Ein Land im Stillstand?
Denn Deutschland steckt fest. Eine alternde Gesellschaft, die langsam den Glauben an die eigene Zukunftsfähigkeit verliert. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass ein neues Konjunkturbarometer die Stimmung weiter drückt. Es scheint, als habe sich das Land eingerichtet in einer Mischung aus Melancholie und Weiter-so. Doch vielleicht lohnt es sich, an genau diesem Punkt innezuhalten. Und sich zu erinnern: Deutschland war einmal ein Land der Erfinder. „Made in Germany“ – ursprünglich ein Warnhinweis britischer Herkunft – wurde zum globalen Gütesiegel für Ingenieurskunst und Innovationskraft. Und auch heute noch genießt deutsche Technik in vielen Teilen der Welt höchstes Ansehen.
Das Rückgrat der Wirtschaft: der Mittelstand
Diese Technik floriert vor allem im Mittelstand, dem flexiblen und soliden Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Rein statistisch werden alle Unternehmen mit weniger als 500 Beschäftigten als Mittelständler betrachtet. Oft werden aber auch deutlich größere Unternehmen dazu gezählt, wenn diese „mittelständisch“ geführt sind. Gemeint ist damit, dass der Inhaber oder die Inhaberin die unternehmenspolitisch relevanten Entscheidungen weitgehend selbst trifft – und Risiko und Haftung übernimmt. Mehr als 99 Prozent der deutschen Unternehmen zählen damit zum Mittelstand. Das Spektrum reicht von kleinen, innovativen Software-Schmieden über global aktive Maschinenbauer zu traditionsreichen Handwerksunternehmen. Und noch viel weiter.
Hidden Champions: Weltmarktführer aus der Provinz
Viele Unternehmen im „German Mittelstand“ sind – ganz in der deutschen Tradition des Erfindens und Tüftelns – technologiegetrieben. Hauptverkaufsargument ihrer Produkte und Dienstleistungen ist in der Regel nicht der Preis, sondern die Qualität sowie der hohe Grad an umgesetzten Innovationen. Eine große Zahl dieser Firmen ist europa- oder weltweit Marktführer in ihrer Branche. Bei den meist überschaubaren Strukturen in den Firmen sind in die Innovationsprozesse viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Disziplinen wie Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und Service eingebunden und tragen so zur Innovation bei.
Neuheiten kommen häufig von den sogenannten „Hidden Champions“, das sind überwiegend weithin unbekannte Mittelständler, die auf ihren Spezialmärkten aber zu den drei stärksten Unternehmen der Welt gehören.
Deutschlands Volkswirtschaft profitiert von rund 1.600 solcher Hidden Champions. Auch weil sie oft versteckt in der deutschen Provinz sitzen und produzieren, wird ihr Erfolg manchmal unterschätzt. Nicht wenige Hidden Champions beschäftigen mehrere Tausend Mitarbeiter. Als Arbeitgeber sind sie geschätzt, weil sie ihre Geschäfte langfristig ausrichten und oft sichere sowie gut bezahlte Jobs bieten.
Erfindungsreichtum: Die Statistik spricht für sich
Deutschland ist immerhin noch Europameister im Erfinden. 25.033 Patente wurden im vergangenen Jahr in Deutschland angemeldet – von Erfindern, Forschern und Unternehmen. Weltweit bleibt Deutschland damit auf dem zweiten Platz. Im Vergleich zum Vorjahr konnte Deutschland um 0,4 Prozent zulegen und liegt damit hinter den USA, aber vor Japan, China und Südkorea. Die meisten Erfindungen aus Deutschland kamen aus dem Bereich Transport. Das umfasst die Automobilbranche, aber auch den Schienenverkehr und die Luft- und Raumfahrt. Traditionell sind hier die großen Automobilhersteller wie Mercedes Benz oder BMW besonders erfinderisch. Für Forschung und Entwicklung wird immer noch viel ausgegeben – im Jahr 2023 waren es 129,7 Milliarden. Laut Statistischem Bundesamt waren das mit 8,3 Milliarden Euro sieben Prozent mehr als im Vorjahr. Damit setzte sich der langjährige, nur im Corona-Jahr 2020 unterbrochene Trend steigender Forschungs- und Entwicklungsausgaben fort.
Die verpasste Digitalisierung
Gleichzeitig hat die deutsche Wirtschaft den digitalen Wandel nur teilweise gemeistert. Künstliche Intelligenz, Halbleiterproduktion, Cloud-Infrastruktur – in all diesen Bereichen liegt Deutschland zurück. Die industrielle Stärke des Landes – Maschinenbau, Automobilindustrie, Chemie – droht damit, zur Hypothek zu werden. Herausforderungen dabei sind die Bürokratie, hohe Steuern und Energiekosten, geringe Investitionen, und der sich zuspitzende demografische Wandel.
Hoffnung aus der Werkstatt
Und doch: Der Weg aus der Krise muss nicht zwangsläufig durch das Silicon Valley führen. Vielleicht liegt er näher als gedacht – nämlich in den Ingenieursbüros, den Laboren und Werkstätten des Landes. Denn wer den Anspruch aufgibt, bloß aufzuholen, kann beginnen, eigene Wege zu gehen. Ein Beispiel: die Energiewende. Kaum ein Industrieland ist bei der Umstellung auf erneuerbare Energien so ambitioniert wie Deutschland – und kaum eines kämpft dabei so sehr mit sich selbst. Doch auch hier wirkt er noch, der deutsche Ingenieurgeist. Mittelständler entwickeln hocheffiziente Wärmepumpen, Start-ups tüfteln an grünem Wasserstoff, Universitäten forschen an Power-to-X-Technologien. Es ist ein Flickenteppich, ja – aber einer, der zeigen könnte, wie sich eine hochtechnisierte Volkswirtschaft tatsächlich klimaneutral aufstellen lässt, ohne auf Wohlstand zu verzichten.
Bildung als Rohstoff
Hinzu kommt ein weiterer Faktor: Deutschlands Bildungssystem, so kritikwürdig es im Detail auch sein mag, bringt nach wie vor kluge Köpfe hervor. Ingenieure, Techniker, Informatiker – sie alle sind international begehrt. Das Problem ist nicht der Mangel an Intelligenz, sondern an Entfaltungsspielräumen. Bürokratische Hemmnisse, fehlende Risikobereitschaft, ein unterfinanziertes Innovationssystem – das sind die eigentlichen Bremsklötze. Statt sich weiter mit regulatorischer Detailverliebtheit selbst zu lähmen, könnte die Politik gezielt Freiräume schaffen für mehr Gründungen und Mut für Neues.
Der Ingenieur als Gestalter der Zukunft
Vielleicht braucht es also ein neues Bild des deutschen Ingenieurs. Nicht als Hüter des Status quo, sondern als Gestalter der Zukunft. Der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen – ökologisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich. Es wäre ein Bild, das zurückgeht auf die großen Zeiten des deutschen Erfindergeistes – aber gleichzeitig nach vorn weist. Denn was dieses Land auszeichnete, war nie nur Präzision. Es war auch der Mut, querzudenken. Systeme zu hinterfragen. Technisch voranzugehen, wo andere noch zögerten.
Der stille Fortschritt
Vielleicht wirkt all das klein im Angesicht der globalen Krisen. Aber genau in dieser Kleinheit liegt eine Chance. Deutsche Ingenieurskunst war nie laut, nie spektakulär. Sie war gründlich, pragmatisch, oft unscheinbar. Sie zeigte sich in durchdachten Lösungen, nicht in markigen Versprechen. Wenn dieses Denken wieder Raum bekommt – nicht als rückwärtsgewandte Nostalgie, sondern als kraftvolle Zukunftserzählung – dann könnte es sein, dass sich der graue Nebel lichtet. Und dass wir erkennen: Die Werkzeuge, um diese Krise zu bewältigen, haben wir längst in der Hand. So sollten wir einen Neuanfang wagen.