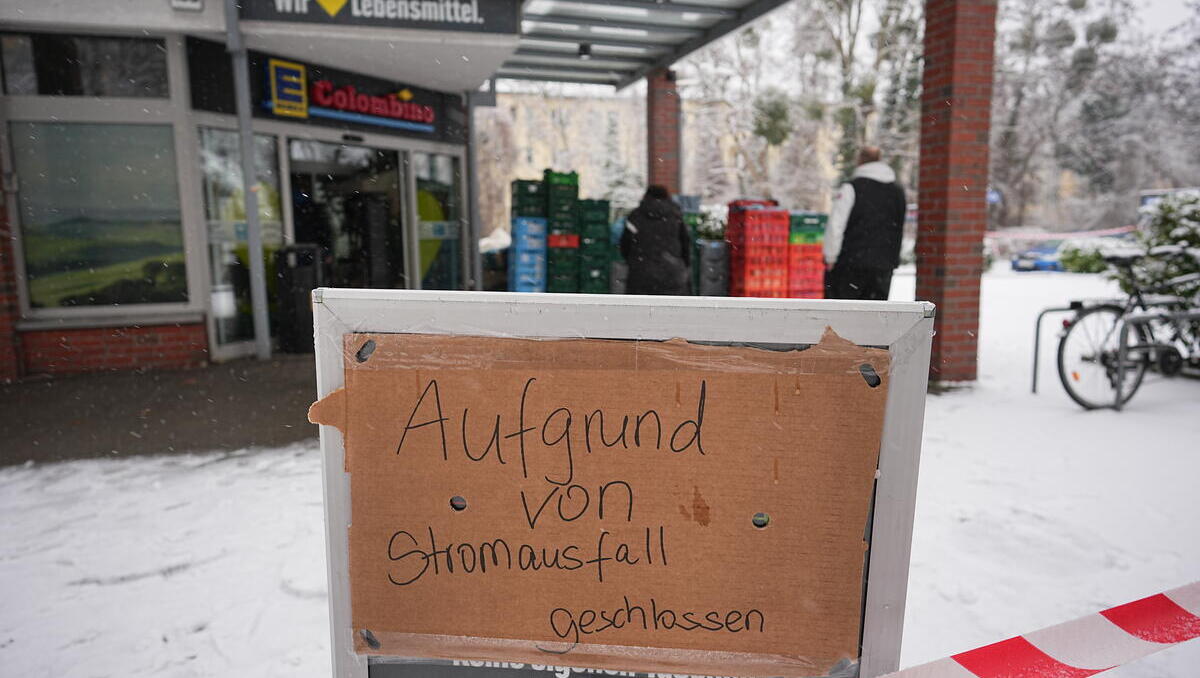Im globalen Innovationswettlauf droht Europa den Anschluss zu verlieren. Nur 8-Prozent der weltweit am schnellsten wachsenden Scale‑ups – bereits kräftig expandierende Jungunternehmen – haben ihren Sitz in der EU; Nordamerika kommt auf beachtliche 60-Prozent.
Das Finanzierungsgefälle ist noch größer: Europas Anteil am weltweiten Venture‑Capital-Volumen – also dem Risikokapital, das Fonds und wohlhabende Privatanleger jungen Tech‑Firmen gegen Unternehmensanteile bereitstellen – liegt bei lediglich 5-Prozent. US-Start‑ups kassieren über die Hälfte, chinesische Gründer rund 40-Prozent (Quelle: EU‑Kommission).
Der Brüsseler Plan im Überblick
Die EU‑Kommission reagiert mit einer neuen Startup‑ und Scale‑up‑Strategie. Europa soll zum „weltweit besten Ort für technologieorientierte Unternehmen“ werden. „In Europa gegründete Unternehmen müssen in Europa wachsen“, betont Stéphane Séjourné, Exekutiv‑Vizepräsident für Wohlstand und Industriestrategie.
Finanzierung in Wochen statt Monaten
Erster Hebel: Tempo. Antrags‑ und Prüfverfahren beim European Innovation Council (EIC) sollen so verschlankt werden, dass Gründer nicht mehr monatelang auf eine Förderzusage warten (heute oft > 200 Tage). Für Start‑ups mit knapper Burn‑Rate – also hohem Bargeldverbrauch – kann eine rasche Finanzspritze über Erfolg oder Scheitern entscheiden. Für spätere Wachstumsphasen plant Brüssel zudem einen Scale‑up Europe Fund, der frisches Kapital bereitstellen soll, damit junge europäische Firmen nicht weiter Richtung Übersee abwandern.
Rentenvermögen wird für Wagniskapital geöffnet
Ein European Innovation Investment Pact soll institutionelle Investoren wie Pensions- und Versorgungswerke stärker für Venture Capital gewinnen. Laut Bundesbank verwalten diese Einrichtungen rund 700 Mrd. € – ein kleiner Prozentanteil genügte, um Milliarden in den Start-up-Kreislauf zu pumpen. Konkrete Anlage- oder Risikolimits stehen noch aus.
Steuerliche Anreize in Arbeit
Zudem schlägt die Kommission europaweit koordinierte Steuererleichterungen für Seed‑Investitionen vor, um privates Kapital schon in der Frühphase zu mobilisieren. Denkbar sind Abzugsmöglichkeiten bei der Einkommensteuer oder Bonusregelungen für besonders forschungsintensive Deep‑Tech‑Projekte. Die Details liegen bei den Mitgliedstaaten – denn Steuerhoheit bleibt national.
Das freiwillige 28th Regime – ein EU‑Pass für Produkte
Zur Entbürokratisierung präsentiert die Kommission das 28th Regime: Unternehmen können sich für eine einzige digitale Marktzulassung entscheiden, die in allen 27 EU‑Staaten gilt. Separate Prüfungen, Übersetzungen und Gutachten entfielen. Ob der Bürokratieabbau wirkt, hängt davon ab, wie viele Hauptstädte mitziehen.
Blue Carpet für Talente
Mit dem Blue‑Carpet‑Visum will Brüssel Spitzenkräfte leichter nach Europa holen. Vorgesehen sind beschleunigte Visa‑ und Arbeitserlaubnisverfahren sowie attraktivere Mitarbeiterbeteiligungen, bei denen Steuern erst anfallen, wenn die zugrunde liegenden Aktien verkauft werden.
Ein Ökosystem aus Test‑Beds und Campus‑Netzen
Neben Kapital und Talenten adressiert die Strategie den Infrastrukturmangel. Mietfreie Test‑Beds, 5G‑Campusnetze sowie Labor‑ und Pilotfabriken sollen Gründern ermöglichen, Prototypen zu erproben, ohne hohe Anfangsinvestitionen zu schultern.
Das Programm „Lab to Unicorn“ verknüpft Universitäts‑Spin‑offs direkt mit Kapitalgebern, damit Forschung schneller in marktreife Produkte mündet.
Die Schwachstellen der EU‑Offensive
Ob das Paket greift, entscheidet die Praxis – und genau dort zeigen sich die Schwachstellen. Weil weder die Teilnahme am 28th Regime noch Steuer‑ oder Investitionsquoten verbindlich sind, könnten nationale Alleingänge den Plan verwässern. Verweigern Schwergewichte wie Frankreich oder Polen etwa den EU‑Pass, entsteht ein neuer, uneinheitlicher Rechtsrahmen, der Investoren abschreckt. Hinzu kommt das alte Problem überlasteter Behörden: Ohne zusätzliche Digital‑ und Personalressourcen verlagert sich der Genehmigungsstau lediglich von den Hauptstädten nach Brüssel.
Noch heikler ist die Finanzierung: Werden Pensionsvermögen plötzlich zu Wagnisgeld, reichen durchschnittliche Abschreibungen, um Löcher in die Bilanzen zu reißen. Ein Beispiel: Legt ein Versorgungswerk zehn Milliarden Euro an und investiert davon 10-Prozent in Venture‑Fonds, fehlen bei einem Drittel Ausfall rund 330 Millionen Euro – bislang ohne Haftungsnetz.
Kostenfalle Wohnen, Behördenschwäche – und die Gefahr des Kapitalexports
Auch die Test‑Beds bergen Risiken. In Feldern wie Biotech oder Quantenhardware dürfte die Nachfrage das Angebot bald übersteigen. Buchen Großkonzerne bevorzugt Slots oder rüsten Mitgliedstaaten nur ausgewählte Regionen auf, wartet der Mittelstand erneut monatelang. Hinzu kommen hohe Betriebskosten: Ohne dauerhaftes EU‑Budget droht den Einrichtungen rasch der Investitionsstau, sodass die bereitgestellte Infrastruktur in wenigen Jahren technisch veraltet.
Ein weiteres Hemmnis: Die Kostenfalle Wohnen. In Tech‑Metropolen wie Berlin oder Amsterdam liegen Warmmieten für 60 bis 80 Quadratmeter mittlerweile bei 1 500 – 2 500 Euro. Bleiben flankierende Wohnraum‑ und Gehaltsmaßnahmen aus, verpufft der Blue‑Carpet‑Effekt.
Warum „Silicon Brussels“ ohne Reformen scheitert
Kurzum: Brüssel hat eine ambitionierte Strategie geliefert. Entscheidend sind europaweit gültige Steueranreize, einheitliche Zulassungen, tragfähige Renten‑Leitplanken, solide finanzierte Test‑Beds und bezahlbarer Wohnraum. Bleiben diese Stellschrauben locker, bleibt „Start-up‑Förderung“ ein Schlagwort – Kapital und Talente wandern weiter ab.
Schicksalsjahr 2026: So kann „Silicon Brussels“ Wirklichkeit werden
Gelingt den Mitgliedstaaten jedoch, verbindliche Regeln zu beschließen, kann die Offensive echte Zugkraft entfalten. Gründer und Investoren äußern vorsichtigen Optimismus, dass Brüssel diesmal mehr liefert als Schlagzeilen. Bis Frühjahr 2026 sollen Rat und Parlament über die Vorschläge entscheiden – ein enger Zeitplan, aber eine Chance für ein europäisches „Silicon Brussels“.