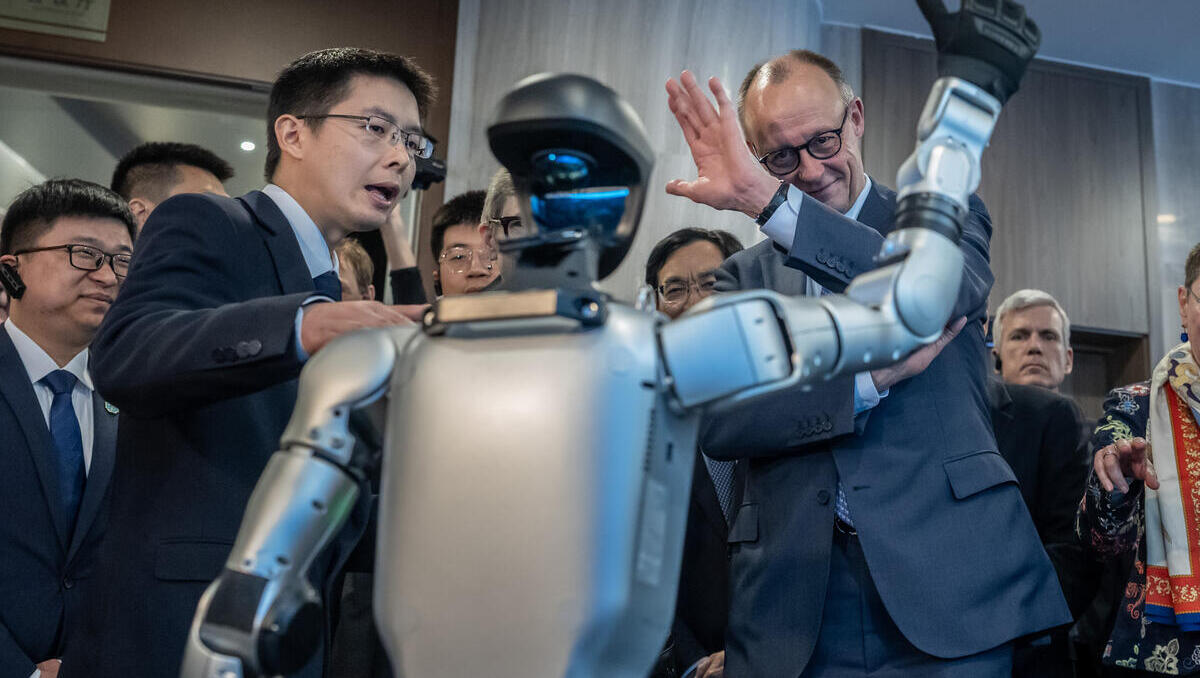Ohne Regionalbank leidet die regionale Wirtschaft. Nur stellt sich die Frage, ob folgende Formel noch gilt: Für den Gewerbebetrieb, das Handelsunternehmen, den Privathaushalt nebenan sind die kleinen Institute vertraute Ansprechpartner, die großen Banken sind zuständig für die Industrie und die vermögenden Kunden. Oder genauer formuliert: Sind die Volksbanken, Raiffeisenbanken und Sparkassen noch die kleinen Regionalbanken? Stimmt noch das Bild von den unabhängigen Genossenschaften im Dienste der Mitglieder, die einen engen Bezug zu „ihrer“ Bank haben? 1999, also vor nur zwanzig Jahren gab es in Deutschland über 2.000 Genossenschaftsbanken, jetzt sind es weniger als 900 und die Zahl wird weiter sinken. In dieser Periode ist die Zahl der Sparkassen von noch fast 600 auf unter 400 gesunken.
Das Bild von der kleinen Bank nebenan wird eifrig gepflegt
In der Werbung wird das überlieferte Bild der Bank von nebenan in Deutschland derzeit eifrig gepflegt. Die geringere Anzahl bedeutet, dass aber die verbleibenden Institute größer werden und oft weit verstreute Filialnetze betreuen. Meist werden nach und nach mehrere Banken fusioniert, sodass die „Region“ ein immer größeres Gebiet umfasst und die Filialen sich kaum noch von Außenstellen einer Großbank unterscheiden. Damit nicht genug: Alle kleinen oder mittlerweile schon gar nicht mehr so kleinen Banken haben Verbundeinrichtungen auf Landes- und auf Bundesebene, die geschaffen wurden, um die Institute zu unterstützen, wenn Aufgaben anfallen, die man selbst nicht bewältigen kann. Und in allen Verbundeinrichtungen ist die Tendenz zu beobachten, die Welt auf den Kopf zu stellen. Manche Verbund-Manager sehen sich gerne als Leiter einer Konzernzentrale, als Chefs der Kleinen und nehmen ungern zur Kenntnis, dass die „Kleinen“ ihre Chefs sind.
In der Schweiz: Der Aufstand der selbstständigen Raiffeisenkassen
In diesem Zusammenhang kam vor wenigen Tagen ein positives Signal aus der Schweiz. In den vergangenen Jahren hatte das Verbundmanagement in St. Gallen, wo „Raiffeisen Schweiz“ den Sitz hat, agiert wie die Generaldirektion eines Konzerns. In einer Delegiertenversammlung haben am vergangenen Samstag die 229 selbstständigen Raiffeisenbanken klar gemacht, dass sie die Eigentümer sind und „Raiffeisen Schweiz“ als Dienstleister für die Mitglieder zu agieren hat. In den Gremien bestimmen künftig wieder die Raiffeisenbanken. Fraglich ist nur, wie, angesichts der Rahmenbedingungen, die Praxis aussehen wird.
Wenig plausible Argumente für Größe und Zentralisierung
Der Druck, die unabhängigen Regionalbanken in einen Konzern zu pressen, kommt nicht nur aus der Eitelkeit und der Machtgier mancher Verbundmanager. Es gibt auch sachliche Argumente, die vermeintlich nicht zu entkräften sind und den Weg in die Fusion zu immer größeren Einheiten weisen.
- Paradoxer Weise wird an erster Stelle der Regulierungswahn der EU-Behörden genannt. Die Bewältigung der tausenden, laufend geänderten Vorschriften erfordere unglaublich viel Personal, das in einer kleineren Bank nicht zur Verfügung steht. Alle, außer den Erfindern und Verwaltern der Regelwerke in den Aufsichtsbehörden, wissen, dass die meisten Auflagen sinnlos sind.
Statt diesen Wust zu beseitigen, fusioniert man Regionalbanken zu Großbanken und baut die Verbundstellen aus, die die Verwaltung der Regelwerke besorgen sollen.
- Das nächste, ebenfalls nicht überzeugende Argument ist die Digitalisierung. Man brauche doch keine Filialen mehr, wenn immer mehr Menschen die Bankgeschäfte online erledigen. Dass nicht mehr mühsam am Schalter mit Zahlscheinen hantiert wird oder aufwändig Kleinbeträge aus- oder eingezahlt werden, ist ein Fortschritt. Elektronische Überweisungen und Geld-Automaten entlasten die Bankmitarbeiter. Diese hätten also mehr Zeit für eine bessere Kundenbetreuung und somit für Geschäfte, die der Bank mehr Ertrag bringen als das Zählen von Münzen.
Die Geschäftsmöglichkeiten der Banken wurden eingeschränkt
Womit man beim Kern des Problems angelangt ist, das aber erstaunlicher Weise in der Diskussion weniger präsent ist. Die Banken haben im Gefolge der EU-Regularien immer weniger Geschäftsmöglichkeiten und in erster Linie aus diesem Grund kommt es zur Schließung von tausenden Bankstellen, die zur Kündigung von abertausenden Mitarbeitern führt.
- Die EU-Behörden produzieren eine Vorschrift nach den anderen, die nicht nur die Verwaltung der Banken sinnlos aufblähen, sondern vor allem die Vergabe von Krediten extrem erschweren. Die Flut an Regelungen, die die Ursachen der Finanzkrise 2008 bekämpfen sollten, ist zur Gänze in den regionalen Instituten angekommen, die aber den geringsten Beitrag zur Krise geleistet haben.
- Weil Großbanken Milliarden-Verluste bei Spekulationen erlitten haben, gibt es heute gigantische Hürden, wenn ein Gewerbebetrieb 35.000 Euro Kredit für eine neue Maschine braucht. Oder ein junges Ehepaar eine Wohnung kaufen will, aber nicht beweisen kann, dass es in den nächsten dreißig Jahren immer gut verdienen wird.
- In Zukunft werden die Banken die Kreditnehmer noch vollends in die Krise treiben müssen: Die neueste Vorschrift besagt, dass die Bank bei Schwierigkeiten der Kunden prompt die Sicherheiten zu verwerten hat, also Grundstücke und Wertpapiere verkaufen und Sparbücher einziehen muss.
- Für zusätzlichen Ärger sorgt das Vorschriften-Bündel unter dem Namen MiFID, das das Wertpapiergeschäft behindert.
Das solide Kreditgeschäft ist nicht nur die Existenzbasis der Regionalbanken, sondern ein wesentliches Element des Erfolgs der kleinen und mittelständischen Unternehmen, die die Stütze der Volkswirtschaft bilden.
Haftungsverbünde sorgen für die Installation mächtiger Revisoren
Doch zurück zu den Gründen, die als unbestreitbare Argumente für den Zug zu größeren Einheiten und insbesondere zur Stärkung der Verbundeinrichtungen präsentiert werden.
- Die Sektoren müssen, das ist in den EU-Bestimmungen wie in den nationalen Gesetzen verankert, Sicherungseinrichtungen haben. Die Umsetzung ist nicht einheitlich, stets gilt aber, alle Mitgliedsbanken müssen für alle anderen haften und im Krisenfall einspringen.
Nebenbei: Die EU-Kommission möchte diese Regel gerade auf alle europäischen Banken ausdehnen, die für alle Banken haften sollen.
- Wie bei allen Varianten, die einen Haftungsverbund darstellen, will und soll auch keine Raiffeisen- oder Volksbank oder Sparkasse für eine andere haften, wenn man das Risiko nicht kennt. Also wird zwangsläufig in Verbindung mit einem Haftungsverbund eine Kontrolleinrichtung geschaffen, die als Revision in den einzelnen Banken agiert.
- Diese Revision hat in jüngster Zeit eine neue Dimension entwickelt, die die unternehmerische Freiheit der Manager in den an und für sich selbstständigen Banken stark einengt:
o Die eine Dimension besteht in der traditionellen Aufgabe einer Revision, somit in der Feststellung von Mängeln.
o Die zweite allerdings ist mit dem Begriff „Unabhängigkeit“ schlecht vereinbar. Die Kontrolleure haben den Auftrag, die künftige Geschäftspolitik zu beurteilen und vor Risiken zu warnen.
- Bei Volksbanken-Raiffeisen in Deutschland wird die Revision von den Verbänden der Mitgliedsbanken besorgt. Zur Illustration die Aufgabe eines Verbandes: „Beratung, Bildung, Interessenvertretung und Prüfung der Mitgliedsgenossenschaften in genossenschaftlichen, rechtlichen, steuerrechtlichen und wirtschaftlichen Angelegenheiten. Der Verband prüft Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht, aber auch die wirtschaftlichen Verhältnisse und die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung der Mitglieder.“
- Angesichts dieser Position ist es nicht verwunderlich, dass so mancher Verbandsmanager Machtgelüste entwickelt. Dies war vor einigen Jahren stark spürbar. Neuerdings herrscht die Klugheit vor, nach außen laut von den selbstständigen Regionalbanken zu sprechen, nach innen aber die geschilderten Funktionen auszuüben. Auch gibt es nur mehr wenige Verbände, da es laufend zu Fusionen und zu weiteren Machtkonzentrationen kommt.
- Bei den Sparkassen sammeln 13 regionale Sicherungseinrichtungen Daten und geben gemeinsam mit Wirtschaftsprüfern den Managern Richtlinien vor. Im „Deutsche Sparkassen- und Giroverband e.V. (DSGV)“ wünscht man sich, bisher ohne Erfolg, ein Zentralinstitut, das alle Sparkassen verbinden soll, und eine Fusion der regionalen Verbände mit dem DSGV.
Die Revisoren der Verbände sind nicht die einzigen, die in die Geschäftsführung der Banken eingreifen: Auch die Mitarbeiter der Bankenaufsicht haben das Recht und sogar die Pflicht, Aktivitäten, die ihrer Meinung nach dem Institut schaden können, zu kritisieren und unter Umständen zu unterbinden.
Die bestehenden Strukturen müssen dringend hinterfragt werden
Dargestellt wird diese Konstruktion als selbstverständlich und notwendig im Interesse der Sicherheit der Kunden.
- Nur: Warum muss ein eigenständiges Institut für andere haften? Vor allem angesichts der Tatsache, dass die meisten „kleinen“ nach einigen Fusionen eine beachtliche Größenordnung erreicht haben.
- Warum hat ein Zentralverband das Recht, die Qualität einer Geschäftspolitik zu beurteilen? Sitzen in einem Verband klügere Banker? Sind Revisoren die besseren Manager?
- Warum kann eine Bank nicht von unabhängigen Wirtschaftsprüfern geprüft werden? Möglichst von zwei Kanzleien?
- Und wieder ein kleiner Hinweis auf die Schweiz: In der Eidgenossenschaft ist die internationale Firma PwC der Prüfer und nicht eine Zentralstelle. Nichts ist perfekt: PwC ist schon viel zu lange im Einsatz, seit 2005. Um frischen Wind in das System zu bringen, wäre ein Wechsel längst empfehlenswert.
Ob EDV-Kolosse tatsächlich immer die besten Programme haben?
Zur Abrundung des Pakets von nur beschränkt überzeugenden Argumenten, die eine offene oder versteckte Zentralisierung begünstigen, der ultimative Schlachtruf: Die Digitalisierung überfordert eine einzelne Bank, da muss es eine zentrale Einrichtung geben, die alle betreut. Subtil: Es ist schon richtig, dass nicht jede Bank die EDV für sich erfinden soll, umfassende, übergreifende Systeme bieten sich selbstverständlich an. Systeme. Die Mehrzahl ist zu betonen, um einen Wettbewerb zu sichern. Schließlich macht die Digitalisierung laufend Entwicklungssprünge. Doch: Warum müssen beispielsweise alle Volksbanken und Raiffeisenbanken an den Giganten GAD angeschlossen sein? Um die Zentrale noch stärker zu machen?
Für eine Stärkung tatsächlich unabhängiger Regionalbanken
Nach außen agieren in der Schweiz, seit einer Woche besonders deutlich, und in Deutschland die regionalen Banken als unabhängige Institute und haben noch einen gewissen Freiraum in der Gestaltung der Banken. In den Niederlanden ist die Geschichte der eigenständigen Regionalbanken seit der Fusion aller Genossenschaften in der Rabobank im Wesentlichen zu Ende. In Österreich wird die Illusion der Selbstständigkeit gepflegt, doch die Volksbanken wurden unter dem Druck der Politik nach einer Krise in eine konzernähnliche Struktur gezwungen, die Sparkassen sind durch einen engmaschigen Haftungsvertrag gebunden und in der Raiffeisen-Organisation sorgen mehrerer Sicherheitseinrichtungen und einige so genannte „Institutsbezogene Sicherungssysteme (IPS)“ für engste Bindungen.
Fazit: Die unabhängige Regionalbank, die nur die Förderung ihrer Mitglieder und Kunden, also die Entwicklung der Region verfolgt, ist durch viele Faktoren in Frage gestellt. Im Interesse einer gedeihlichen Volkswirtschaft wäre die Beseitigung der vielfältigen Hindernisse dringend geboten.